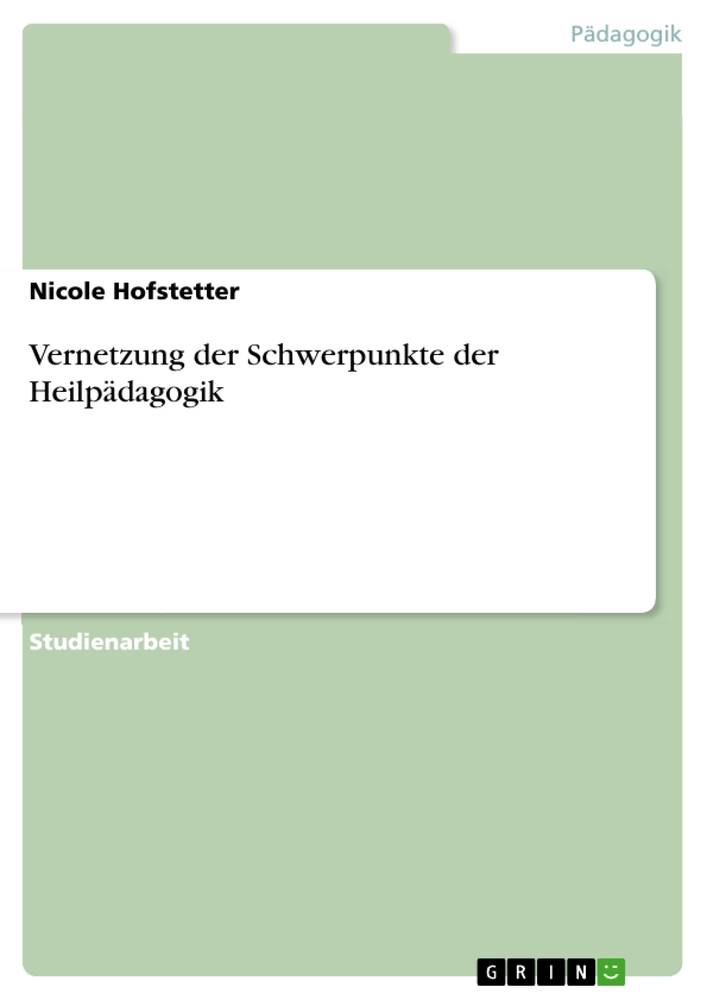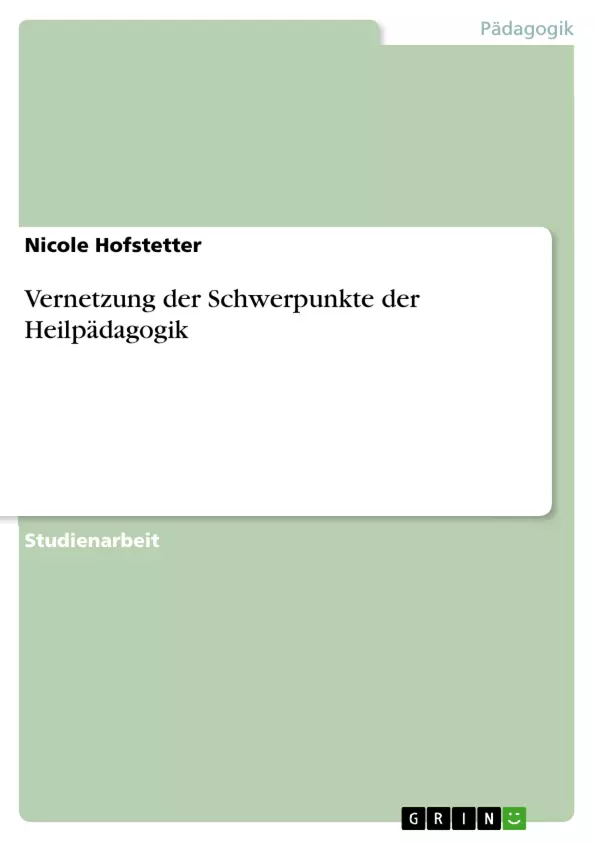Die nachfolgende Quintessenz bezieht sich auf die gelesenen Reflexionen im den Bereichen Erziehung-, und Bildungsinhalte und –ziele, Förderplanung, Didaktischen und Interaktive Konzepte und unterstützende Umweltfaktoren. Entstanden sind sie im Anschluss an die Praxis-Shadowings der Tandemgruppen in den verschiedenen heilpädagogischen Tätigkeitsfeldern.
Die Quintessenz erörtert Gemeinsamkeiten und grundsätzliche Differenzen der verschiedenen Tätigkeitsfelder der Heilpädagogen und zeigt den Handlungsbedarf für Schulen im Umgang mit Vielfalt und Heterogenität auf.
Abstract
Die nachfolgende Quintessenz bezieht sich auf die gelesenen Reflexionen im den Bereichen Erziehung-, und Bildungsinhalte und –ziele, Förderplanung, Didaktischen und Interaktive Konzepte und unterstützende Umweltfaktoren. Entstanden sind sie im Anschluss an die Praxis-Shadowings der Tandemgruppen in den verschiedenen heilpädagogischen Tätigkeitsfeldern.
Die Quintessenz erörtert Gemeinsamkeiten und grundsätzliche Differenzen der verschiedenen Tätigkeitsfelder der Heilpädagogen und zeigt den Handlungsbedarf für Schulen im Umgang mit Vielfalt und Heterogenität auf.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1. Einleitung
2. Gemeinsamkeiten der verschiedenen heilpädagogischen Praxisfelder
3. Grundsätzliche Unterschiede der verschiedenen Praxisfelder
4. Handlungsbedarf für Schulen im Umgang mit Heterogenität
5. Literatur
1. Einleitung
Die Tätigkeitsbereiche der Gruppenmitglieder der virtuellen Vernetzungsgruppe 11 zeigen die mannigfaltigen Beschäftigungsbereiche der Heilpädagogen auf. Die Bereiche erstrecken sich von Institutionen wie Sonderschulheimen und Heilpädagogische Schulen über alle Stufen in der öffentlichen Schule mit verschiedenen Schulungsformen wie der Regelklasse, Kleinklasse, Integrierter Schulungsform (ISF) und Integrierter Sonderschulung (ISS) bis hinzu pädagogisch-therapeutischen Diensten wie die des Audipädagogischen Dienstes. In allen Arbeitsfeldern sind die Beteiligten auf dem Weg von der Separativen Beschulung der Kinder zur Integrativen. Dieser Weg zeichnet sich durch Gemeinsamkeiten, aber auch grundsätzliche Unterschiede und einen Handlungsbedarf für eine Erfolg versprechende Weiterentwicklung jedes einzelnen Praxisfeldes aus.
2. Gemeinsamkeiten der verschiedenen heilpädagogischen Praxisfelder
Als allseitige Gemeinsamkeit der Arbeitsfelder fällt das lernförderliche Klima, in Form einer wohlwollenden, wertschätzenden Haltung und gegenseitigen Akzeptanz auf (Meyer, 2005).
Alle heilpädagogischen Fachpersonen fördern ressourcenorientiert, setzen an den Stärken der Schüler an (Egger, 2007). Inkludiert in die ressourcenorientierte Förderung ist allen gemeinsam die Förderplanung. Die Förderplanung hat überall Einzug gehalten, die Ausgestaltungsformen sind unterschiedlicher Art.
Im Bereich der unterstützenden Umweltfaktoren ist die Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogen und weiteren beteiligten Fachpersonen gemein. Einzig die Zusammenarbeit mit den Eltern differiert von Setting zu Setting sehr. Die Öffentlichkeitsarbeit, die einen wichtigen Stellenwert in der Tätigkeit der Heilpädagogen einnimmt, gehört ebenfalls zu den Gemeinsamkeiten. Der individualisierte Unterricht nimmt bei allen eine zentrale Stelle innerhalb der Didaktischen Konzepten ein.
3. Grundsätzliche Unterschiede der verschiedenen Praxisfelder
Die Bildungsinhalte und-ziele variieren in den verschiedenen Praxisfeldern am meisten. In allen integrativen Settings ist die ganzheitliche Förderung, ausgestaltet durch die Förderung der Sach-, Sozial-, und Selbstkompetenz zentral. In den separativen Systemen nimmt die Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz, in Form der Beschäftigung mit Verhaltensauffälligkeiten und oder Förderung des selbständigen Handelns im Alltag einen gewichtigeren Stellenwert ein.
Die Rolle der Heilpädagogin verfügt über verschiedene Ausprägungsformen. In den separativen Arbeitsfeldern geht es in Richtung pädagosich-therapeutisches Arbeiten. Das Teamteaching gehört in der IF, ISF und ISS als Didaktisches Konzept zum Alltag, in Kleinklassen kennt man dies zum Beispiel nicht.
Die Akzeptanz der Heilpädagogen ist ebenfalls sehr unterschiedlich. In der Integrativen Schulungsform steht man den Heilpädagogen eher kritisch gegenüber. In der Separativen Schulungsform ist es akzeptiert und sogar erwünscht, dass spezifische Fachpersonen unterrichten und fördern. Die Akzeptanz hat direkte Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen wie Pensendotation, verfügbare Materialien und Räumlichkeiten. Der Paradigmenwechsel hat noch nicht überall stattgefunden. So ist das Verständnis für die Tätigkeit von Heilpädagogen nicht flächendeckend vorhanden.
4. Handlungsbedarf für Schulen im Umgang mit Heterogenität
„ Seit den 80-er Jahren haben sich integrative Schulformen in der Schweiz mehr und mehr Raum verschafft.-…“, erörtert Wyss (2007, S.27). Dies bedeutet weg von der Homogenität hin zum Umgang mit Heterogenität. Den Umgang mit Heterogenität beschreibt Wyss (2007) mit folgendem prägnanten Satz: „Lehrpersonen sind wie Reiseleiterinnen und –leiter, die den Auftrag haben, eine Reisegruppe von Schwerstbehinderten bis Hochleistungssportlerinnen und –sportlern in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst geringem Aufwand durch unwegsames Gelände, Sonne, Regen und Wind so zu führen, das niemand verloren geht und alle gemeinsam an einem Ziel ankommen“ (S.27).
Diese prägnante Beschreibung lässt uns erkennen, dass Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen besteht. Reiseleiter geniessen eine hohe Akzeptanz und grosses Vertrauen. Durch intensivierte Öffentlichkeitsarbeit der Heilpädagogen auf Klassen-, Team-, Schul- und Gemeindeebene ist die Akzeptanz der heilpädagogischen Tätigkeit im Integrativen Setting zu erhöhen. Gleichzeitig muss der Paradigmenwechsel von „alle sind gleich“ hinzu „ es ist normal, verschieden zu sein“ persönlich verinnerlicht werden. Die Bildungsinhalte und –ziele bedürfen der Handlung in Richtung ganzheitlicher Förderung. Dem Merkmal des hohen Anteils echter Lernzeit in der Förderung von Sach-, Sozial-, und Selbstkompetenz parallel, soll so vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden. Grundsätzlich besteht die Idee der Integrativen Beschulung aller Kinder am Wohnort. Doch erscheint es mir sehr wichtig, jedes Kind als individuelles Wesen zu betrachten und im Sinne der Individualisierung die für das Kind optimale Schullaufbahn zu wählen. Das didaktische Mittel des Teamteachings soll in allen Settings, egal ob separativ oder integrativ, vermehrt zum Einsatz kommen.
Der Weg von der Separation zur Integration kann als Übergang bezeichnet werden. Übergänge sind komplexe, ineinander übergehende Wandlungsprozesse, bei denen das Individuum Phasen von beschleunigten Veränderungen und eine lernintensive Zeit durchmacht (Coradi, 2009). Übergänge bringen Veränderungen mit sich. Veränderungen brauchen Zeit, Raum für Reflexion und Austausch, Hilfestellung von aussen, setzen positive wie negative Energien frei, bergen Überraschungen und ganz wichtig, bedürfen der Freiwilligkeit aller Beteiligten (Wyss, 2007).
Dies allem muss genügend Aufmerksamkeit im Umgang mit Heterogenität auf dem Weg zur Integration gewährleistet werden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Gemeinsamkeiten heilpädagogischer Praxisfelder?
Gemeinsam sind allen Feldern ein lernförderliches Klima, eine wertschätzende Haltung, ressourcenorientierte Förderung sowie die Anwendung der Förderplanung.
Worin unterscheiden sich integrative und separative Schulungsformen?
In integrativen Settings steht die ganzheitliche Förderung im Vordergrund, während separative Systeme oft einen stärkeren Fokus auf Sozial- und Selbstkompetenz sowie den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten legen.
Welcher Handlungsbedarf besteht für Schulen im Umgang mit Heterogenität?
Es ist ein Paradigmenwechsel nötig: Weg von „alle sind gleich“ hin zu „es ist normal, verschieden zu sein“. Zudem muss die Akzeptanz heilpädagogischer Arbeit durch Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden.
Welche Rolle spielt das Teamteaching in der Heilpädagogik?
Teamteaching ist ein zentrales didaktisches Konzept in integrativen Formen (IF, ISF, ISS), sollte aber laut der Arbeit in allen Settings vermehrt zum Einsatz kommen.
Wie wird der Übergang von der Separation zur Integration beschrieben?
Der Übergang ist ein komplexer Wandlungsprozess, der Zeit, Raum für Reflexion, Austausch und die Freiwilligkeit aller Beteiligten erfordert.
- Quote paper
- MA in Special Needs of Education Nicole Hofstetter (Author), 2010, Vernetzung der Schwerpunkte der Heilpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201169