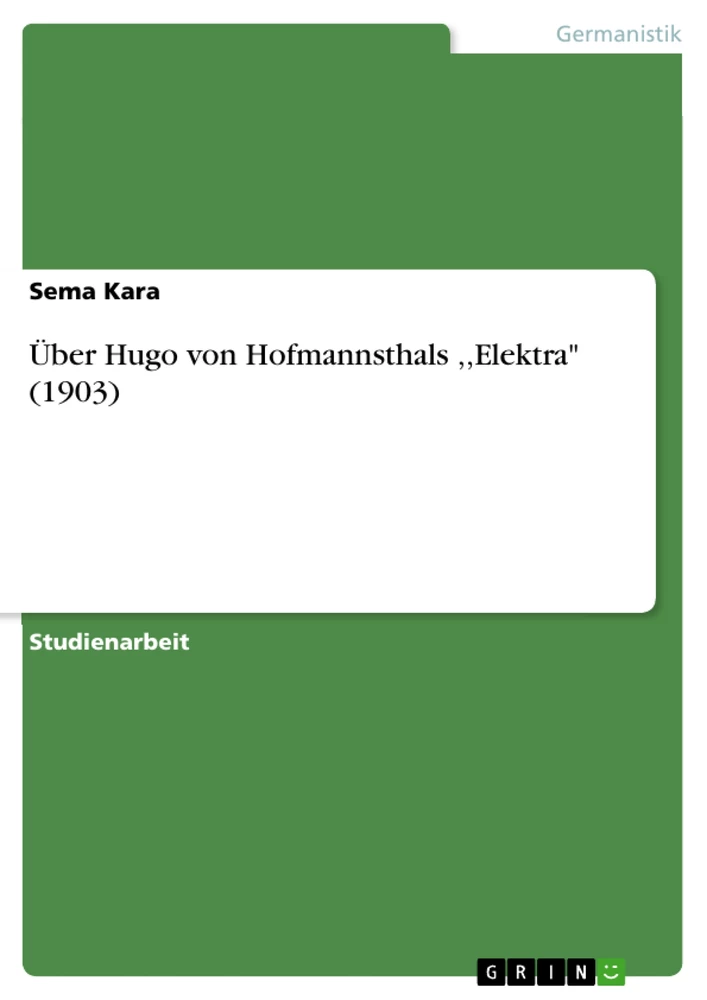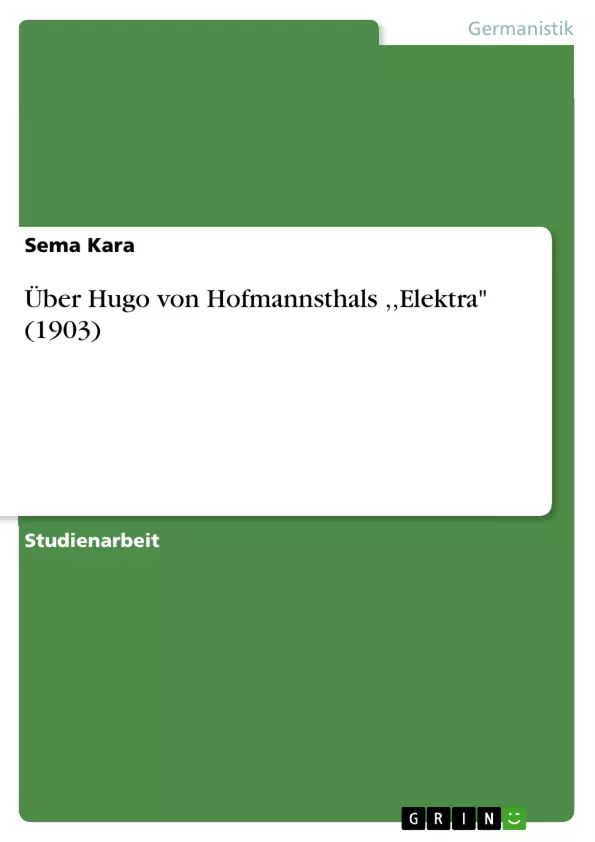„Als Stil schwebte mir vor, etwas gegensätzliches zur Iphigenie zu machen, etwas worauf das Wort nicht passe: >>dieses gräcisierende Product erschien mir beim erneuten Lesen verteufelt human.<< (Goethe an Schiller)“ (v. Hofmannsthal 1997, S.400).
Dieses Zitat ist neben den „Szenischen Vorschriften zu ‚Elektra‘‘‘ nur ein weiterer Beleg für die antiklassizistische Herangehensweise Hofmannsthals an den antiken Atriden – Mythos und die Figur der Elektra, der Protagonistin des vorliegenden Stückes. Im Spiegel seiner Zeit wollte er den „‘Schauer‘ des antiken Mythos“ (Eder 2009, S.127) neu erschaffen, aus einem bildungsbürgerlichen Stück gleichsam ein Werk kreieren, das eher an die Gefühlswelt als an den Intellekt seiner Leser appellieren sollte (vgl. v. Hofmannsthal 1997, S. 309).
Anhand einer psychologischen Neuinterpretation des antiken Sujets gelang es ihm, den Mythos als Gefäß zu nutzen, um dieses mit zeitgenössischen Inhalten zu füllen. Neben der Psychologisierung der Handlung und der Charaktere ist der Einfluss von Friedrich Nietzsches Werk „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ (1872) in der Hofmannsthalschen Version erkennbar.
Auf beide Aspekte soll in nachfolgender Arbeit in Grundzügen eingegangen werden, wobei die Psychologisierung der Charaktere ausschließlich anhand der Protagonistin Elektra dargelegt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hofmannsthals Neubearbeitung im Unterschied zu den antiken Prätexten
- Formale Unterschiede
- Hofmannsthals Figurenkonzeption
- Tod und Wiedergeburt der Tragödie in „Elektra“
- Abschaffung des antiken Chors
- Das komödiantische Moment als Mittel zur Subversion
- Verkörperung des Tragischen in den Frauenfiguren und Wiedergeburt einer neuen Tragödie
- Psychologisierung des antiken Sujets
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Hofmannsthals „Elektra“ als Neuinterpretation des antiken Atriden-Mythos zu analysieren, indem sie die psychologische Dimension des Stücks und den Einfluss von Nietzsches „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ auf Hofmannsthals Werk beleuchtet. Dabei wird insbesondere die Figur der Elektra im Hinblick auf ihre Radikalität und ihre psychische Verfassung betrachtet.
- Die Neubearbeitung des antiken Stoffes durch Hofmannsthal und die formalen und inhaltlichen Unterschiede zu den ursprünglichen Prätexten, insbesondere zu Sophokles „Elektra“
- Die Rolle des komödiantischen Moments in Hofmannsthals Tragödie als Mittel zur Subversion traditioneller tragischer Elemente
- Die psychologisierte Figurenkonzeption, insbesondere die Analyse der drei weiblichen Figuren: Elektra, Chrysothemis und Klytämnestra
- Die Verbindung von antiker Mythologie und moderner Psychologisierung in Hofmannsthals „Elektra“
- Der Einfluss von Friedrich Nietzsches „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ auf die Gestaltung von Hofmannsthals Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und stellt den Kontext für Hofmannsthals „Elektra“ dar, indem sie die antiklassizistische Herangehensweise Hofmannsthals an den Atriden-Mythos und die Figur der Elektra beleuchtet.
Kapitel 2 untersucht die Unterschiede zwischen Hofmannsthals „Elektra“ und den antiken Prätexten, insbesondere Sophokles „Elektra“. Dabei werden formale Unterschiede wie die Reduktion der Handlung und die Abschaffung des Chors, sowie die veränderte Figurenkonzeption mit der Fokussierung auf die drei weiblichen Figuren Elektra, Chrysothemis und Klytämnestra herausgearbeitet.
Kapitel 3 analysiert das komödiantische Moment in Hofmannsthals „Elektra“ und seine Rolle als Mittel zur Subversion traditioneller tragischer Elemente. Darüber hinaus werden die drei weiblichen Figuren als Verkörperung des Tragischen in ihrer individuellen Radikalität und psychologischen Tiefe beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht die Psychologisierung des antiken Sujets und die Verbindung von Mythologie und moderner Psychologie in Hofmannsthals Werk. Dabei wird der Einfluss von Friedrich Nietzsches „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ auf die Gestaltung von Hofmannsthals „Elektra“ beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem antiken Atriden-Mythos, insbesondere mit der Figur der Elektra und der Rezeption des Mythos in der Moderne. Zentrale Themen sind die Neuinterpretation von antiken Stoffen, die Psychologisierung der Figuren und die Frage nach dem Tragischen in der modernen Welt. Hofmannsthals "Elektra" wird in Verbindung mit Friedrich Nietzsches Werk "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" betrachtet, wobei der Einfluss von Nietzsches Ideen auf die Gestaltung des Stückes beleuchtet wird.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Hugo von Hofmannsthals "Elektra"?
Es ist eine moderne Neubearbeitung des antiken Atriden-Mythos, die sich auf die psychologische Tiefe und die extreme Gefühlswelt der Protagonistin Elektra konzentriert.
Welchen Einfluss hatte Friedrich Nietzsche auf das Werk?
Hofmannsthal orientierte sich an Nietzsches "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik", insbesondere an der Rückkehr zum dionysischen "Schauer" des Mythos abseits klassizistischer Ideale.
Wie unterscheidet sich Hofmannsthals Version von Sophokles?
Hofmannsthal schaffte den antiken Chor ab, reduzierte die Handlung und legte den Fokus auf die psychologische Zerrüttung der Charaktere sowie auf eine dichte, bildhafte Sprache.
Warum wird das Stück als "antiklassizistisch" bezeichnet?
Weil Hofmannsthal bewusst auf die "humane" Ausgeglichenheit (wie in Goethes Iphigenie) verzichtete und stattdessen das Grausame, Triebhafte und Hysterische des Mythos betonte.
Welche Rolle spielen die Frauenfiguren Elektra, Chrysothemis und Klytämnestra?
Sie verkörpern unterschiedliche psychologische Reaktionen auf das Trauma der Ermordung Agamemnons: Rachebesessenheit (Elektra), Verleugnung/Lebensdrang (Chrysothemis) und quälende Schuldgefühle (Klytämnestra).
Was bedeutet das "komödiantische Moment" in dieser Tragödie?
Die Arbeit analysiert, wie Hofmannsthal durch subversive Elemente traditionelle tragische Strukturen aufbricht, um eine neue Form der modernen Tragödie zu schaffen.
- Arbeit zitieren
- Sema Kara (Autor:in), 2012, Über Hugo von Hofmannsthals ,,Elektra" (1903), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201224