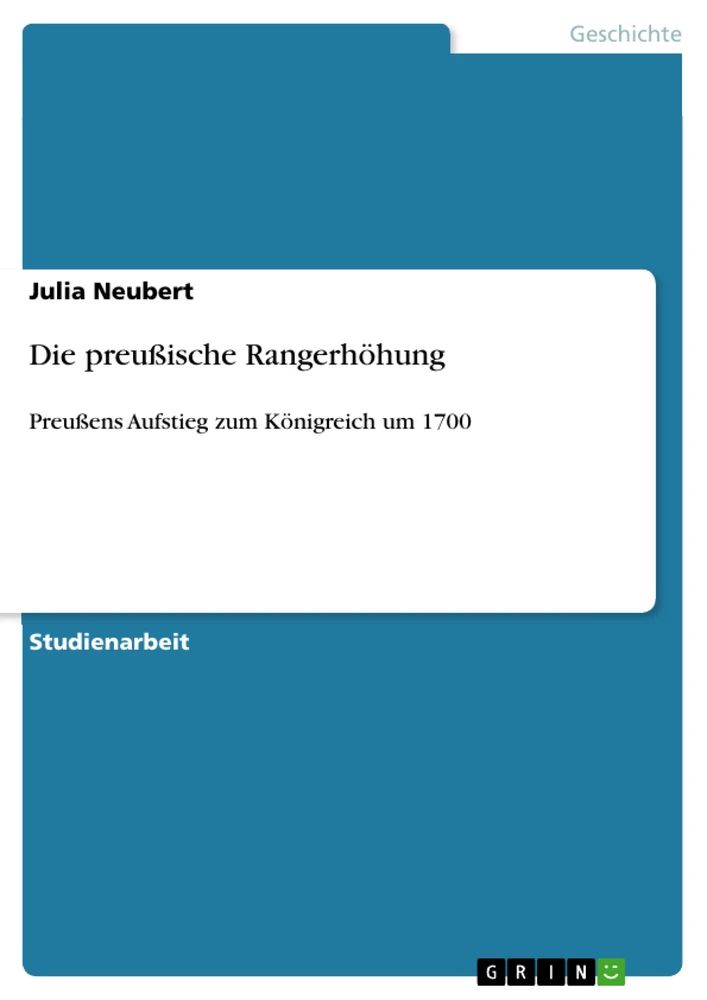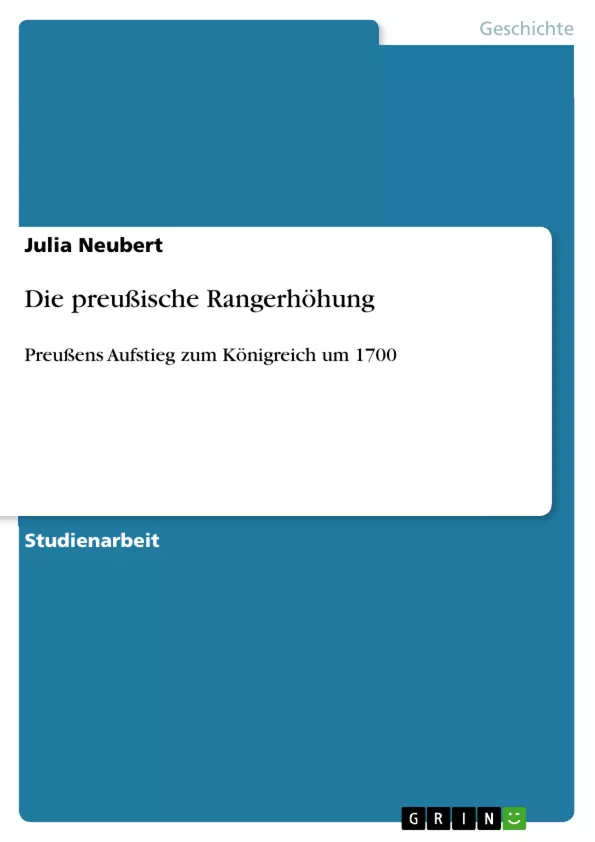Die Königskrönung in Königsberg am 18.01.1701 war das Ergebnis jahrelanger strategischer Überlegungen des Kurfürsten Friedrich III. und seiner politischen Vertreter. Nach Entledigung Eberhard von Danckelmanns, der lange Zeit preußischer Oberpräsident und engster Berater Friedrichs war, aber die Pläne von der Rangerhöhung nicht unterstützte , verwirklichte letztlich sein Nachfolger, Kolbe von Wartenberg, Friedrichs Wunsch nach „königlicher Dignität" .
Der Weg zur Königskrone war allerdings ein mehr als beschwerlicher. Er strengte zum einen jahrelange diplomatische Verhandlungen an und war zum anderen immer wieder vom drohenden Scheitern der Pläne Friedrichs gekennzeichnet. Einen herben Rückschlag erlitten die kurfürstlichen Bemühungen um die Rangerhöhung z.B. mit den Friedensverhandlungen von Rijswijk 1697, die nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg das Gebiet unter den Siegermächten aufteilten und in denen Brandenburg-Preußen trotz seiner aktiven Unterstützung der kaiserlichen Truppen als einer der wenigen Beteiligten ‚leer ausging‘. Für Friedrich zeigte sich wieder einmal, welch niedriges Ansehen Brandenburg-Preußen beim Kaiser und den ihm verbündeten Mächten genoss.
Seine Position durch eine Rangerhöhung zu festigen war für Friedrich fortan die einzige Möglichkeit vor allem nachhaltig Souveränität für Brandenburg-Preußen zu schaffen. Dabei sicherten in letzter Instanz finanzielle Abkommen mit Leopold I. sowie den wichtigsten europäischen Höfen, wie England, den Niederlanden und Polen, die Krönung. Die Motivation Friedrichs III. zur Rangerhöhung lag vor allem darin, das geerbte Reich unter einem Herrscher zu vereinen. Preußen und die Mark Brandenburg nach dem Ableben des Vaters, Kurfürst Friedrich Wilhelm, 1688 als ein Reich beizubehalten, widersprach zwar dem letzten Erberlass des Vaters von 1686, griff allerdings die Hohenzollern’schen Erbgepflogenheiten wieder auf und sollte dazu dienen, die Macht des Kurfürstentums Brandenburg und des Herzogtums Preußen beizubehalten, die bei einer Aufteilung des Reiches unter den fünf Söhnen Friedrich Wilhelms enorm geschmälert worden wäre. Um diesen für Friedrich III. absehbaren Verfall der politischen als auch reputablen Macht zu vermeiden, ließ er mit Hilfe seines Geheimen Rats in andauernden Verhandlungen die testamentarisch festgelegte Teilung des Reiches auf die fünf Brüder für rechtswidrig erklären. Diese ‚Klammer‘ um Brandenburg-Preußen erwies sich als dauerhaft wirkungsvoll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Tod des großen Kurfürsten und sein Erbe
- Die innere Lage Brandenburg-Preußens 1688
- Das politische Testament – Die Problematik der Sekundogenituren
- Kurfürst Friedrich III. – Die Klammer um Brandenburg-Preußen
- Die Verhandlungen um die Rangerhöhung
- Die Bedeutung des Spanischen Erbfolgekriegs für Friedrichs Pläne
- Die Verhandlungen um die Anerkennung der preußischen Königswürde mit dem Wiener Hof
- Die Bedeutung der Königskrönung für Brandenburg Preußen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Umstände der Königskrönung Friedrichs III. am 18. Januar 1701 in Königsberg. Sie beleuchtet die Königskrönung nicht nur als ein isoliertes Ereignis, sondern als Ergebnis eines strategischen Prozesses, der darauf abzielte, den Wohlstand des Volkes zu steigern, die nationale Gesinnung zu fördern und das Wachstum des Staates zu beschleunigen.
- Die Königskrönung als Ausdruck königlicher Machtpolitik
- Friedrichs III. strategisches Vorgehen bei der Überwindung der Problematik der Sekundogenituren
- Die Rolle des Spanischen Erbfolgekriegs in der Entscheidung für die Königskrönung
- Die diplomatischen Verhandlungen mit dem Wiener Hof und anderen europäischen Mächten
- Die Bedeutung der Königskrönung für die Festigung und Entwicklung Brandenburg-Preußens
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die innere Lage Brandenburg-Preußens nach dem Tod des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und die Problematik der Sekundogenituren, die durch das Testament Friedrich Wilhelms entstanden sind. Friedrich III. sah sich gezwungen, die testamentarisch festgelegte Teilung des Landes zu verhindern, um die Einheit Brandenburg-Preußens zu gewährleisten. Kapitel 3 fokussiert auf die Verhandlungen um die Königskrönung Friedrichs III. Die Notwendigkeit der Rangerhöhung ergibt sich aus der schwierigen internationalen Lage und der Dominanz des französischen Königs Ludwig XIV. Die Verhandlungen mit dem Wiener Hof und anderen europäischen Mächten, die von der Bedrohung durch die Spanische Erbfolge geprägt waren, führten schließlich zur Anerkennung der Königswürde durch Friedrich III. Das Fazit zeigt die Bedeutung der Königskrönung für die Entwicklung Brandenburg-Preußens auf und unterstreicht den Einfluss der strategischen Entscheidungen Friedrichs III. auf die Entstehung der späteren Großmacht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie der Königskrönung Friedrichs III., der inneren und äußeren Situation Brandenburg-Preußens, der Sekundogenituren, dem Spanischen Erbfolgekrieg, diplomatischen Verhandlungen, der Festigung der Macht und der Entwicklung des späteren Königreichs Brandenburg-Preußens. Die Arbeit konzentriert sich dabei besonders auf die strategischen Überlegungen Friedrichs III. sowie die Auswirkungen der Königskrönung auf die innere und äußere Situation Brandenburg-Preußens.
Häufig gestellte Fragen
Warum krönte sich Friedrich III. 1701 zum König?
Die Rangerhöhung diente dazu, die Souveränität von Brandenburg-Preußen zu festigen, das Ansehen gegenüber dem Kaiser zu steigern und die geerbten Reiche zu vereinen.
Was war die Problematik der Sekundogenituren?
Das Testament des Großen Kurfürsten sah eine Teilung des Reiches unter seinen fünf Söhnen vor, was Friedrich III. durch diplomatische und rechtliche Schritte verhinderte, um die Macht zu erhalten.
Welche Rolle spielte der Spanische Erbfolgekrieg für die Krönung?
Da Kaiser Leopold I. auf die militärische Unterstützung Preußens angewiesen war, stimmte er im Austausch für Bündniszusagen der Rangerhöhung Friedrichs zu.
Warum fand die Krönung in Königsberg statt?
Königsberg lag im Herzogtum Preußen, das außerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Reiches lag, wodurch Friedrich dort eine souveräne Königswürde beanspruchen konnte.
Wer war Kolbe von Wartenberg?
Er war der Nachfolger von Danckelmann und unterstützte Friedrich III. maßgeblich bei der Verwirklichung seines Wunsches nach der "königlichen Dignität".
- Citation du texte
- Julia Neubert (Auteur), 2011, Die preußische Rangerhöhung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201299