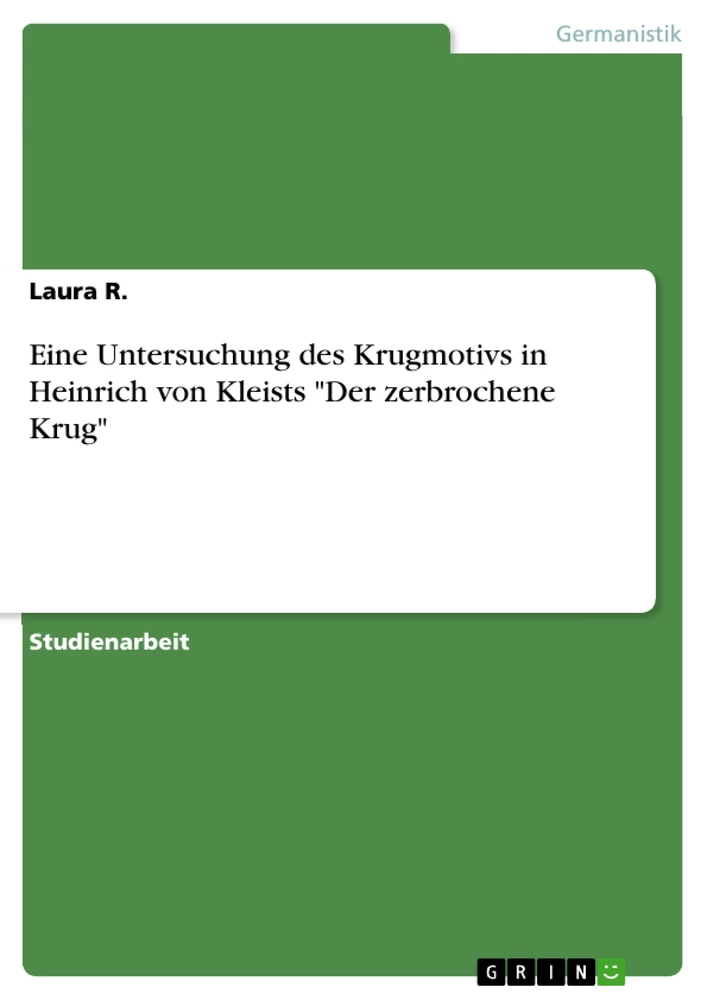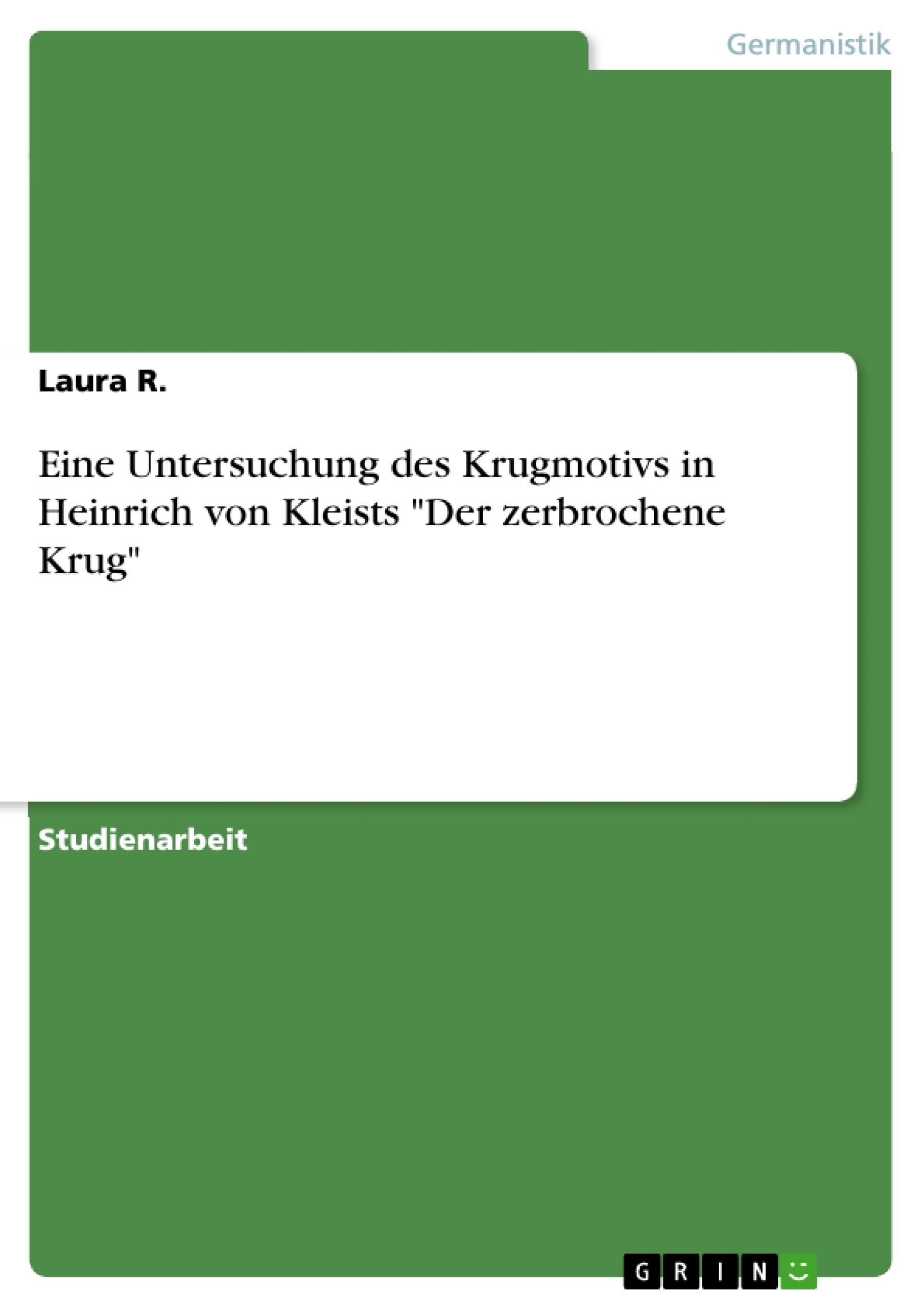„[…] Denn der zerbrochene Krug ist nichts anderes als der Titelheld dieses Dramas und als solcher in besonderem Maße unserer Aufmerksamkeit würdig […].
Nicht umsonst bezeichnet Graham den zerbrochenen Krug als Titelhelden des Dramas, denn das Motiv des Kruges stellt eine wesentliche Rolle im Stück dar und fordert somit eine intensive Auseinandersetzung mit ihm geradezu heraus. Viermal ist der zerbrochene Krug Herrscher einer Szene: In dem einleitenden Streit über den rechtlichen Aspekt seines Bruches, in der Beschreibung von Frau Marthe, in ihrer Darstellung seiner Geschichte und schließlich, wie es einem Titelhelden gebührt, in den Schlussworten des Stückes. Ganz von selbst stellt sich nun die Frage, was es mit diesem so bedeutenden Krug auf sich hat.
Der Leitfaden für diese Arbeit soll das zentrale titelgebende Krugmotiv sein, wobei hauptsächlich seine poetologischen, geschichtstheoretischen und medialen Aspekte untersucht werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Entstehung des Lustspiels Der zerbrochene Krug
- 3. Analyse des Lustspiels Der zerbrochene Krug im Hinblick auf das Krugmotiv
- 3.1. Der poetologische Aspekt des Kruges
- 3.2 Der geschichtstheoretische Aspekt des Kruges
- 3.3 Der mediale Aspekt des Kruges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Motiv des zerbrochenen Kruges im Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist. Der Fokus liegt auf den poetologischen, geschichtstheoretischen und medialen Aspekten dieses zentralen Motivs, die im Stück eine bedeutende Rolle spielen.
- Die Rolle des Kruges als Symbol für die Beziehung sprachlicher Zeichen und dessen, worauf sie verweisen
- Die historische Bedeutung des Kruges als Darstellung der niederländischen Staatsgründung
- Der zerbrochene Krug als Metapher für den Verlust der Unschuld und die Ehre
- Die Verbindung des Kruges mit der Metaphorik im Stück
- Die Auseinandersetzung mit dem Stück im Kontext der aristotelischen Einheitstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einleitung zum Thema und erläutert die Bedeutung des zerbrochenen Kruges im Stück. Das zweite Kapitel untersucht die Entstehung des Lustspiels und die verschiedenen Quellen, die Kleist für seine Arbeit nutzte. Das dritte Kapitel analysiert das Krugmotiv in seinen verschiedenen Aspekten: dem poetologischen, dem geschichtstheoretischen und dem medialen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Der zerbrochene Krug, Heinrich von Kleist, Lustspiel, poetologischer Aspekt, geschichtstheoretischer Aspekt, medialer Aspekt, Symbolik, Metapher, Staatsgründung, Unschuld, Ehre, Aristotelische Einheitstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat der Krug in Kleists Drama?
Der zerbrochene Krug ist der „Titelheld“ des Stücks und fungiert als zentrales Symbol für Wahrheit, Schuld und den Verlust von Ordnung.
Was ist der geschichtstheoretische Aspekt des Kruges?
Der Krug zeigt Abbildungen zur niederländischen Staatsgründung, wodurch sein Zerbrechen symbolisch für eine historische Zäsur oder den Verfall politischer Ideale steht.
Was wird unter dem medialen Aspekt des Kruges verstanden?
Es wird untersucht, wie der Krug als Medium fungiert, das Informationen speichert (durch seine Bilder) und wie dessen Zerstörung die Kommunikation der Figuren beeinflusst.
In welchen Szenen tritt das Krugmotiv besonders hervor?
Besonders im einleitenden Streit, in der detaillierten Beschreibung durch Frau Marthe und in den Schlussworten des Dramas.
Wie verbindet Kleist den Krug mit dem Thema Ehre?
Der zerbrochene Krug ist eine Metapher für Luises verletzte Ehre und die moralische Integrität der beteiligten Familien.
- Citation du texte
- Laura R. (Auteur), 2003, Eine Untersuchung des Krugmotivs in Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201377