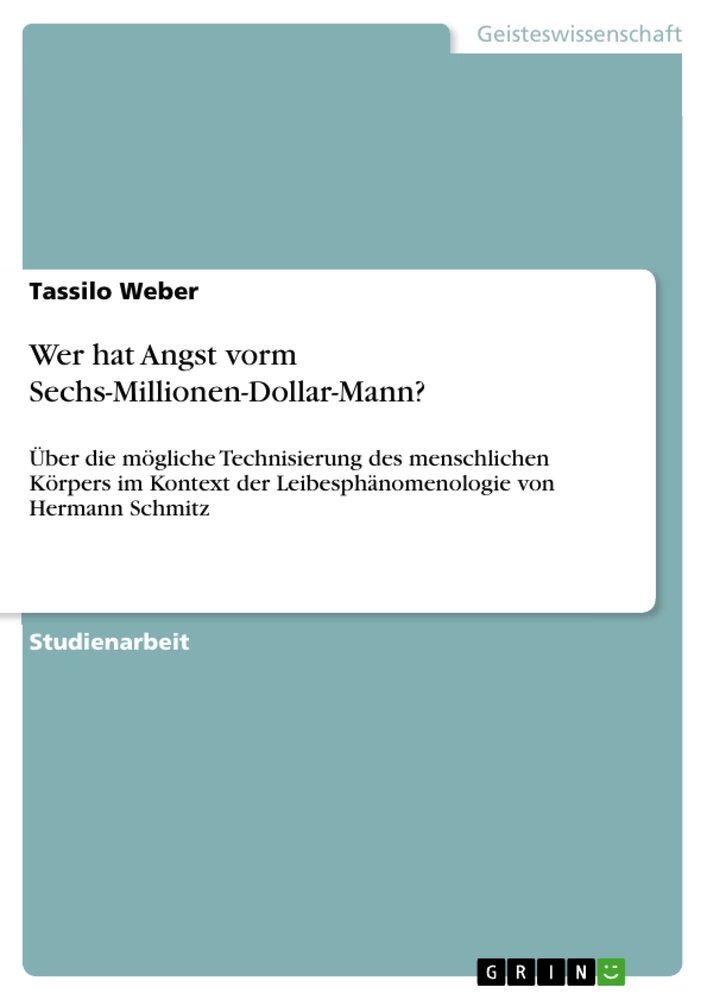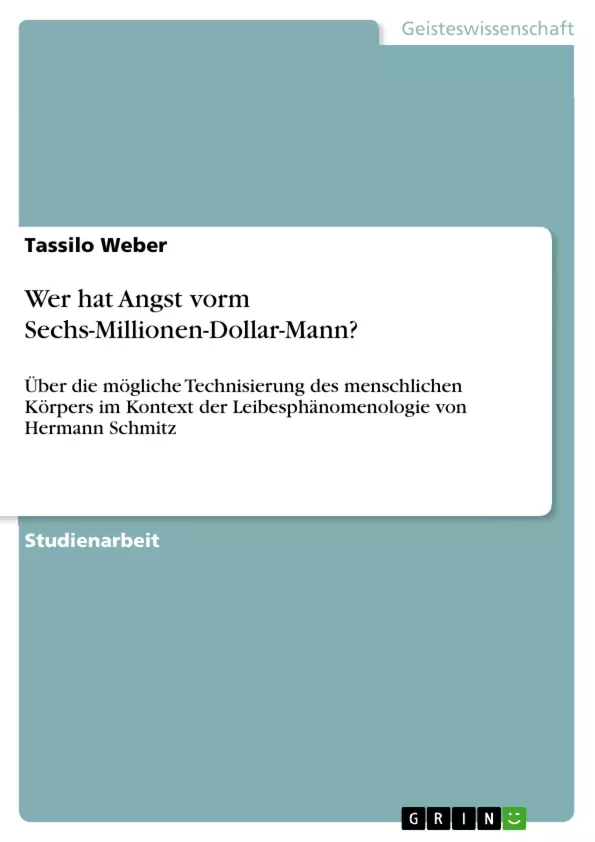Ziel dieser Arbeit ist es, die Leibesphänomenologie Schmitz’ wiederzugeben und ihr Verhältnis zur wissenschaftlichen Methode sowie deren Anwendung auf den menschlichen Körper (in Form der Neuroprothetik) darzustellen, um schließlich zu zeigen, dass diese Synthese ein hinreichend holistisches Theoriefundament liefert, um die Technisierung des Menschen in Bahnen zu leiten, die seinem Wesen angemessen bleiben – sodass der Mensch die Angst vor dem Sechs-Millionen-Dollar-Mann (und dessen erweiterten Versionen) verliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der beseelte Leib. Schmitz' Position
- Ontologie
- Objektive und subjektive Sachverhalte
- Situationen
- Die persönliche Situation und die persönliche Welt
- Allgemeine Gegenstände
- Der Leib
- Engung und Weitung
- Der Richtungsraum
- Einleibung
- Der Übergang zur Körperlichkeit
- Der Körper als Baustelle
- Analogien zwischen Leib und Körper
- Die Technik und der Körper
- Möglichkeit und Grenzen von Neuroprothesen
- Die Verortung des Leibs im wissenschaftlichen Kontext
- Der Leib-Körper-Holismus
- Der Radikale Konstruktivismus als Paradigma zur Neubewertung der Objektivität
- Konsequenzen aus dem Radikalen Konstruktivismus
- Ausblick: Holistische Veränderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die zunehmende Technisierung des menschlichen Körpers, insbesondere durch Neuroprothesen, eine Gefahr für die menschliche Identität darstellt. Sie analysiert das Verhältnis zwischen dem Leib, als subjektive und unhintergehbare Erfahrungsdimension, und dem Körper, als objektiv-wissenschaftlich zugänglichem Objekt, im Kontext der Leibesphänomenologie Hermann Schmitz'. Ziel ist es, zu zeigen, dass eine Synthese von Leibesphänomenologie und Neuroprothetik ein holistisches Verständnis des Menschen ermöglicht, das die Technisierung in einer dem Wesen des Menschen angemessenen Weise lenkt.
- Die ontologischen Grundelemente der Neuen Phänomenologie und der Unterschied zwischen subjektiven und objektiven Sachverhalten
- Die Bedeutung der Leiblichkeit als Voraussetzung für das Objektive und die Ableitung des Körpers aus dem Leib
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Neuroprothetik im Hinblick auf die menschliche Identität und das Miteinander
- Die Synthese von Leibesphänomenologie und Neuroprothetik im Kontext des Radikalen Konstruktivismus
- Die Bedeutung eines holistischen Verständnisses des Menschen für die Zukunft der Technisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik der Technisierung des menschlichen Körpers im Kontext der Leibesphänomenologie von Hermann Schmitz vor. Sie skizziert die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2 erläutert die ontologischen Grundelemente der Neuen Phänomenologie nach Hermann Schmitz. Es werden die Begriffe subjektive und objektive Sachverhalte, Situation, persönliche Situation und persönliche Welt sowie allgemeine Gegenstände diskutiert.
- Kapitel 3 widmet sich der Frage, inwiefern der menschliche Körper aus wissenschaftlicher Sicht ersetz- und veränderbar ist. Es werden neueste Entwicklungen und Ausblicke aus dem Bereich der Neuroprothetik sowie deren Auswirkungen auf die menschliche Identität und das Miteinander betrachtet.
- Kapitel 4 untersucht die Möglichkeit, Leibesphänomenologie und Neuroprothetik zu vereinen. Anhand des Radikalen Konstruktivismus wird gezeigt, wie die objektiv-wissenschaftliche Sichtweise im Kontext der Leibesphänomenologie zu verorten ist.
Schlüsselwörter
Leibesphänomenologie, Hermann Schmitz, Neuroprothetik, Technisierung des Körpers, Radikale Konstruktivismus, Objektivität, Subjektivität, Identität, Holismus, menschliche Existenz, synthetisches Verständnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen "Leib" und "Körper" bei Hermann Schmitz?
Der Leib ist die subjektive Spürbarkeit (das "Beseelte"), während der Körper das von außen sichtbare, anatomische und wissenschaftlich messbare Objekt ist.
Was versteht man unter "Neuroprothetik"?
Es handelt sich um technische Implantate, die verlorene Funktionen des Nervensystems ersetzen oder ergänzen sollen, wie z.B. Gehirn-Computer-Schnittstellen.
Bedroht die Technisierung des Körpers die menschliche Identität?
Die Arbeit untersucht, ob die Ersetzung biologischer Teile durch Technik das menschliche Selbstverständnis gefährdet, und schlägt einen holistischen Ansatz zur Versöhnung vor.
Wie hilft der "Radikale Konstruktivismus" bei dieser Fragestellung?
Er dient als Paradigma, um die wissenschaftliche Objektivität neu zu bewerten und die technische Sichtweise in die phänomenologische Erfahrung zu integrieren.
Was bedeutet "Einleibung" in der Neuen Phänomenologie?
Es beschreibt den Prozess, wie fremde Objekte oder technische Geräte Teil des eigenen spürbaren Leibbereichs werden können.
- Arbeit zitieren
- Tassilo Weber (Autor:in), 2012, Wer hat Angst vorm Sechs-Millionen-Dollar-Mann?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201394