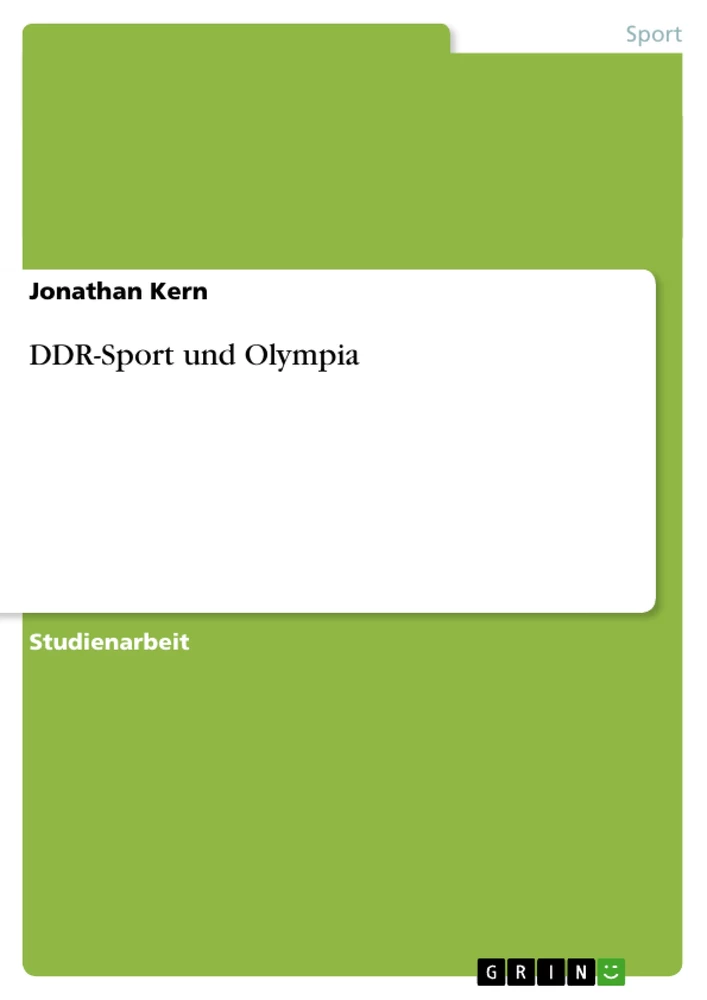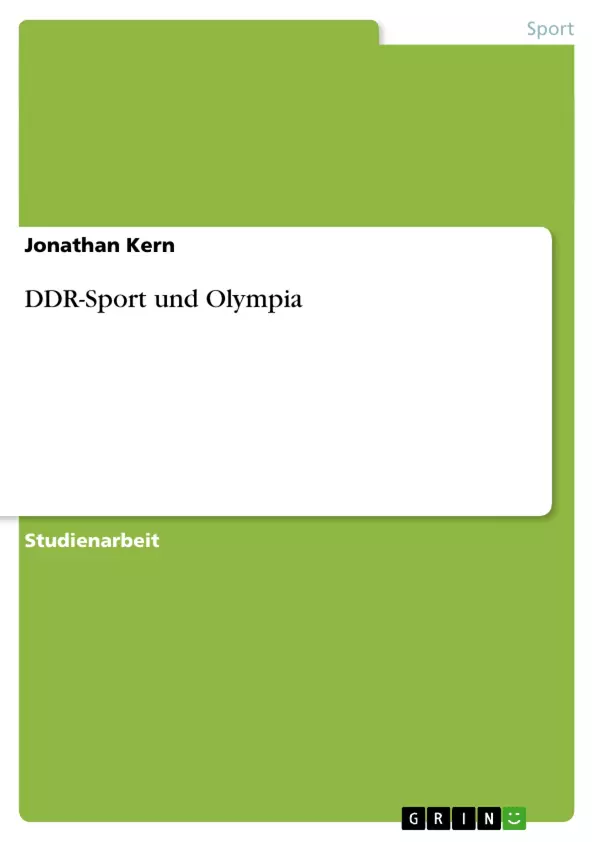In den letzten Wochen war in den Nachrichten und Zeitungen immer wieder von einem neuen Gesetz die Rede – dem Doping-Opfer-Hilfe-Gesetz (DOHG). Am 14. Juni 2002 wurde es vom Bundestag beschlossen und sieht die Entschädigung von Betroffenen des geheimen, staatlich verordneten Dopings in der ehemaligen DDR seit den siebziger Jahren, vor (APuZ 2002). Das Gesetz und die Zahlungen von insgesamt 2 Millionen Euro erheben „nicht den Anspruch einer Wiedergutmachung für erhebliche gesundheitliche Schäden (...)“ , sondern vielmehr ein Zeichen für „humanitäre und soziale Hilfe“ (APuZ 2002).
Aus diesem aktuellen Anlass, möchte ich das Thema DDR-Sport und Olympia zum Inhalt meines Referats machen. Das Thema der vorliegenden Arbeit stellt zudem eine Parallele zum Thema meiner Kommilitonin, dar, die über Sport und Olympia während der Zeit des Nationalsozialismus referiert hatte. Auch in meiner Arbeit geht es um den Sport in einer Diktatur – nämlich der sozialistischen Diktatur in der ehemaligen DDR.
Zunächst werde ich verdeutlichen, wie eng die Vermischung von Sport und Politik in der SED-Diktatur war. Weiterhin gehe ich auf die Trennung des deutschen Leistungssports und die Geschichte des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) der DDR ein. Als einen dritten Punkt möchte ich am Beispiel der Kugelstoßerin Heide Krieger die menschenverachtende Praxis des „staatlich verordneten“ Dopings in der DDR aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sport und Politik in der DDR
- DDR-Sport und Olympia (1956–1988)
- Doping in der DDR
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die enge Verknüpfung von Sport und Politik in der DDR, insbesondere im Kontext der Olympischen Spiele. Ziel ist es, die Instrumentalisierung des Sports durch das SED-Regime aufzuzeigen und die damit verbundenen Folgen zu beleuchten.
- Die Politisierung des Sports in der DDR
- Die Rolle des Sports im Klassenkampf der SED
- Die Teilnahme der DDR an den Olympischen Spielen
- Das staatlich verordnete Doping im DDR-Sport
- Die Erfolge und der internationale Einfluss des DDR-Sports
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Instrumentalisierung des Sports in der DDR am Beispiel der Olympischen Spiele, ausgehend von der aktuellen Debatte um das Doping-Opfer-Hilfe-Gesetz. Sie skizziert den Fokus auf die Verflechtung von Sport und Politik unter der SED-Diktatur und kündigt die thematische Auseinandersetzung mit dem staatlich verordneten Doping an.
Sport und Politik in der DDR: Dieses Kapitel analysiert die lange Tradition der Politisierung des Sports und zeigt auf, wie die SED den Sport als Instrument des Klassenkampfes und zur Stärkung des internationalen Ansehens des Sozialismus einsetzte. Es werden Beispiele genannt, wie Sportler und Sportvereine, wie der BFC Dynamo Berlin, unter der Kontrolle der Staatssicherheit standen und wie sportliche Erfolge propagandistisch genutzt wurden. Die enge Verzahnung von SED-Funktionären und Sport wird verdeutlicht, mit Erich Mielke als prominentem Beispiel. Das Kapitel betont, dass die Erfolge der DDR-Sportler stets auch als Beweis der Überlegenheit des sozialistischen Systems dargestellt wurden.
DDR-Sport und Olympia (1956–1988): Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte der Teilnahme der DDR an den Olympischen Spielen. Es behandelt die anfängliche Weigerung des IOC, die DDR als eigenständiges Nationales Olympisches Komitee anzuerkennen, und die Teilnahme unter einer gemeinsamen deutschen Flagge in den 1950er und frühen 1960er Jahren. Es werden die Bemühungen der DDR-Führung um die Anerkennung als eigenständiger Teilnehmer und der damit verbundenen politischen Implikationen beleuchtet. Das Kapitel beschreibt den späteren Erfolg der DDR-Mannschaften, ihre Erfolge bei den Olympischen Spielen und die Rivalität mit der Bundesrepublik Deutschland. Der Boykott der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles durch die DDR wird ebenfalls behandelt, welcher als Reaktion auf den Boykott der Spiele von Moskau 1980 gesehen wird.
Schlüsselwörter
DDR-Sport, Olympia, Politisierung des Sports, SED, Doping, Klassenkampf, Internationale Beziehungen, Kalter Krieg, Olympisches Komitee, Propaganda, Sportpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: "Sport und Politik in der DDR"
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die enge Verknüpfung von Sport und Politik in der DDR, insbesondere im Kontext der Olympischen Spiele von 1956 bis 1988. Es analysiert die Instrumentalisierung des Sports durch das SED-Regime und beleuchtet die damit verbundenen Folgen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die Politisierung des Sports in der DDR, die Rolle des Sports im Klassenkampf der SED, die Teilnahme der DDR an den Olympischen Spielen, das staatlich verordnete Doping im DDR-Sport, die Erfolge und der internationale Einfluss des DDR-Sports sowie die Verflechtung von Sport und Politik unter der SED-Diktatur.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in ihnen?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, die den Fokus und die Zielsetzung der Arbeit beschreibt. Es folgen Kapitel zu "Sport und Politik in der DDR", das die Politisierung des Sports und die Kontrolle durch die SED analysiert; "DDR-Sport und Olympia (1956–1988)", welches die Geschichte der DDR-Teilnahme an den Olympischen Spielen und die damit verbundenen politischen Implikationen beleuchtet; und "Doping in der DDR", das sich mit dem staatlich verordneten Doping auseinandersetzt. Abschließend gibt es ein Fazit.
Welche Rolle spielte die SED im DDR-Sport?
Die SED nutzte den Sport als Instrument des Klassenkampfes und zur Stärkung des internationalen Ansehens des Sozialismus. Sportler und Vereine standen unter der Kontrolle der Staatssicherheit, und sportliche Erfolge wurden propagandistisch genutzt. Die enge Verzahnung von SED-Funktionären und Sport wird deutlich hervorgehoben.
Wie wurde der Sport in der DDR politisiert?
Der Sport wurde umfassend politisiert. Die SED kontrollierte Sportvereine, Sportler wurden für politische Ziele instrumentalisiert, und sportliche Erfolge dienten der Legitimation des sozialistischen Systems. Die Erfolge der DDR-Sportler wurden stets als Beweis der Überlegenheit des sozialistischen Systems dargestellt.
Welche Bedeutung hatten die Olympischen Spiele für die DDR?
Die Teilnahme an den Olympischen Spielen war für die DDR von großer politischer Bedeutung. Die anfängliche Nichtanerkennung durch das IOC und die spätere erfolgreiche Teilnahme mit eigenem Nationalen Olympischen Komitee werden detailliert beschrieben. Die Erfolge bei den Olympischen Spielen und die Rivalität mit der Bundesrepublik Deutschland spielten eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielte Doping im DDR-Sport?
Das Dokument thematisiert das staatlich verordnete Doping im DDR-Sport als einen wesentlichen Aspekt der Instrumentalisierung des Sports für politische Zwecke. Es wird als integraler Bestandteil der Strategie zur Erzielung von sportlichen Erfolgen dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: DDR-Sport, Olympia, Politisierung des Sports, SED, Doping, Klassenkampf, Internationale Beziehungen, Kalter Krieg, Olympisches Komitee, Propaganda, Sportpolitik.
Für welche Zielgruppe ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument richtet sich an eine akademische Zielgruppe, die sich mit der Geschichte des Sports in der DDR und der Verflechtung von Sport und Politik auseinandersetzen möchte. Es eignet sich für wissenschaftliche Arbeiten und Analysen.
- Quote paper
- Jonathan Kern (Author), 2002, DDR-Sport und Olympia, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20163