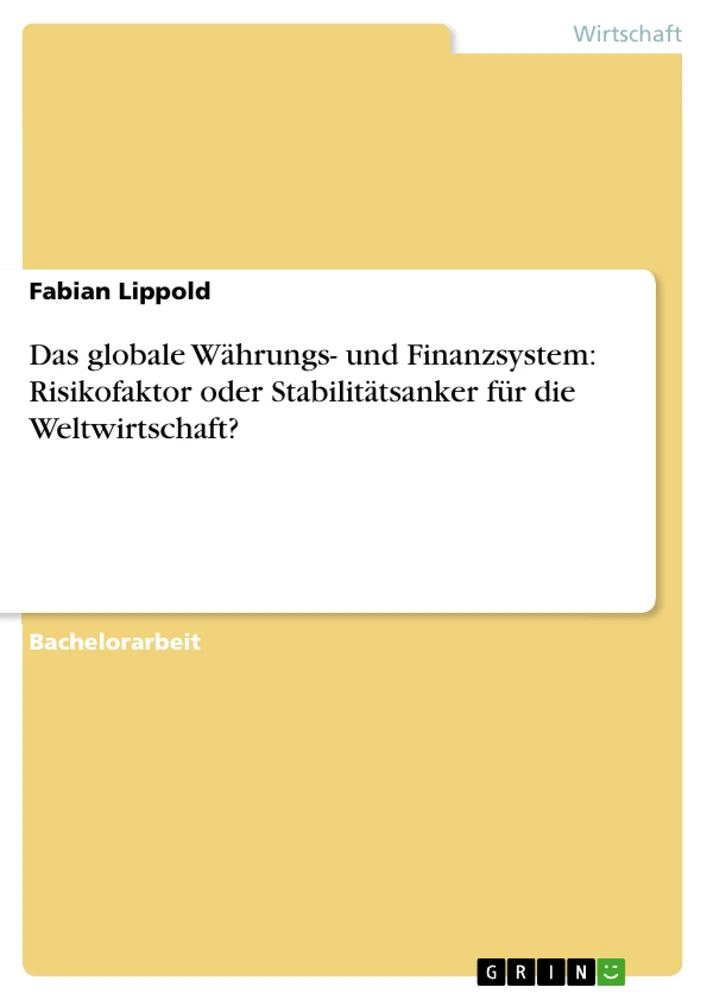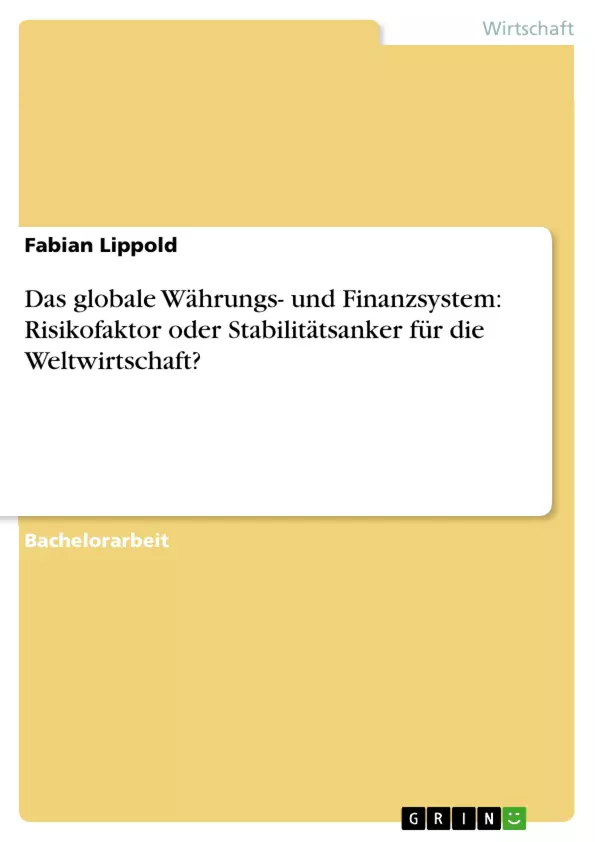Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre reiht sich in eine Abfolge von Krisen ein, deren Ursprünge möglicherweise in der Architektur des globalen Währungs- und Finanzsystems (GWFS) zu suchen sind.
Die allgemeinen Diskussionen beherrschen zumeist Thesen über die alleinige Verantwortung des internationalen Banken- und Finanzsektors sowie der Regulierungs- und Zentralbankpolitik großer Volkswirtschaften (VW) bei der Entstehung der Krise. Dabei wird oftmals außer Acht gelassen, dass die Beschaffenheit des GWFS möglicherweise erst selbst den Grundstein für die Exzesse des Finanzsektors und die fehlerhafte Zentralbankpolitik gelegt hat.
Diese Arbeit stellt aus diesem Grund die These auf,dass die Beschaffenheit des GWFS speziell seit Anfang der 1990er Jahre massiv zum Aufbau von Krisen beigetragen hat. Um diese These zu untermauern, verbindet die Arbeit verschiedene theoretische Überlegungen als auch statistische Analysen bezüglich der Architektur des GWFS, um anschließend konkrete Risikofaktoren für das GWFS benennen zu können.
Die Basis für diese Untersuchung bildet das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit. Hier wird zunächst die Entstehung des Bretton-Woods-System (BWS)betrachtet. Aus der anschließenden Analyse wesentlicher Konstruktionsschwächen des BWS können sodann die Gründe für dessen Niedergang aufgearbeitet werden, um danach den Übergang zum sog. „non-system“ auf internationaler Ebene erklären zu können. Innerhalb dieses „non-system“ bestehen zwei Entwicklungsprozesse, die dieses System in besonderem Maße geprägt, dadurch aber auch die Zahl möglicher Risiken deutlich erhöht haben. Diese Prozesse sollen in ihrer Entwicklung und Wirkung genau untersucht werden.
Das zweite Kapitel überprüft anschließend die Wirkung des sog. "non-system" auf das Wachstum und die Stabilität der Weltwirtschaft.Hierbei wird vor allem die Entstehung konkreter Risikofaktoren für das GWFS analysiert.
Das dritte Kapitel stellt die Frage, inwiefern die Asienkrise und US-Finanzkrise seit dem Jahre 2007 untereinander verbunden waren und welchen Anteil die Risikofaktoren des GWFS an diesen Krisen hatten.
Der Ausblick am Ende dieser Arbeit versucht abschließend kurz verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das GWFS dauerhaft stabilisiert werden könnte.
Alles in allem soll sich diese Arbeit also mit einer Wirkungs- bzw. Schadensanalyse für das GWFS befassen, um zu verstehen, wie Krisen in einem globalisierten Wirtschaftssystem untereinander verbunden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Das globale Währungs- und Finanzsystem
- Bretton Woods und der Aufstieg des Dollars
- Entwicklungen nach der Bretton-Woods Ära
- Das „,non-system“ und die globale Währungspolitik
- Financial Globalization
- Financial Development
- Schwachstellen des globalen Währungs- und Finanzsystems
- Autonomie der Geldpolitik ?
- Abbau der Dominanz des US-Dollars im globalen Währungssystem ?
- Flexible Wechselkurse als automatischer Stabilisator?
- Ausgleichende Wirkung der Wechselkurse auf Leistungsbilanzen ?
- Entstehung und Wirkung der Risikofaktoren
- Die Asienkrise
- Ursachen
- Schutzmaßnahmen nach der Krise
- US-Finanzkrise
- Ein exorbitantes Privileg...
- Kapitalflüsse in die USA
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Strukturen und Entwicklungen innerhalb des globalen Währungs- und Finanzsystems (GWFS) als maßgeblichen Krisenfaktor für das globale Wirtschaftssystem. Die Arbeit konzentriert sich auf die Synthese verschiedener theoretischer Überlegungen zur Architektur des GWFS, aus denen verschiedene Risikofaktoren zusammengetragen werden.
- Die Entstehung und der Niedergang des Bretton-Woods-Systems (BWS)
- Die Entwicklung des „non-systems“ mit flexiblen Wechselkursen
- Die Auswirkungen von Financial Globalization und Financial Development
- Die Schwachstellen des GWFS und ihre Rolle bei der Entstehung von Finanzkrisen
- Die Asienkrise und die US-Finanzkrise als Beispiele für die Folgen von Risikofaktoren im GWFS
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Bretton-Woods-Systems (BWS) nach dem Zweiten Weltkrieg und analysiert dessen Konstruktionsschwächen, die zum Niedergang des Systems führten. Anschließend wird der Übergang zum „non-systems“ mit flexiblen Wechselkursen erklärt. Das zweite Kapitel untersucht Schwachstellen des globalen Währungs- und Finanzsystems, wie die Autonomie der Geldpolitik, die Dominanz des US-Dollars, die Wirkung flexibler Wechselkurse und der Ausgleich von Leistungsbilanzen. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Wirkung von Risikofaktoren anhand der Asienkrise und der US-Finanzkrise. Es analysiert die Ursachen dieser Krisen und die Schutzmaßnahmen, die nach der Asienkrise ergriffen wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf das globale Währungs- und Finanzsystem (GWFS), Bretton-Woods-System (BWS), „non-systems“, Financial Globalization, Financial Development, Wechselkurse, Leistungsbilanzen, Risikofaktoren, Asienkrise, US-Finanzkrise, Zentralbankpolitik, Geldpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "non-system" im globalen Finanzwesen?
Es beschreibt den Zustand der internationalen Währungspolitik nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems, geprägt durch flexible Wechselkurse und mangelnde zentrale Steuerung.
Warum scheiterte das Bretton-Woods-System?
Die Arbeit analysiert wesentliche Konstruktionsschwächen, die letztlich zum Niedergang des Systems und dem Aufstieg des Dollars als dominierende, aber krisenanfällige Währung führten.
Welchen Einfluss hatte die "Financial Globalization" auf Krisen?
Die zunehmende globale Vernetzung der Finanzmärkte hat die Zahl der Risiken erhöht und dazu beigetragen, dass lokale Krisen schneller globale Auswirkungen haben.
Wie hängen die Asienkrise und die US-Finanzkrise von 2007 zusammen?
Die Arbeit untersucht, wie Risikofaktoren des globalen Währungssystems, wie Kapitalflüsse und Leistungsbilanz-Ungleichgewichte, beide Krisen miteinander verbinden.
Können flexible Wechselkurse als automatischer Stabilisator wirken?
Dies wird in der Arbeit kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf ihre tatsächliche Fähigkeit, Leistungsbilanzen auszugleichen und die Geldpolitik autonom zu halten.
- Quote paper
- Fabian Lippold (Author), 2012, Das globale Währungs- und Finanzsystem: Risikofaktor oder Stabilitätsanker für die Weltwirtschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201787