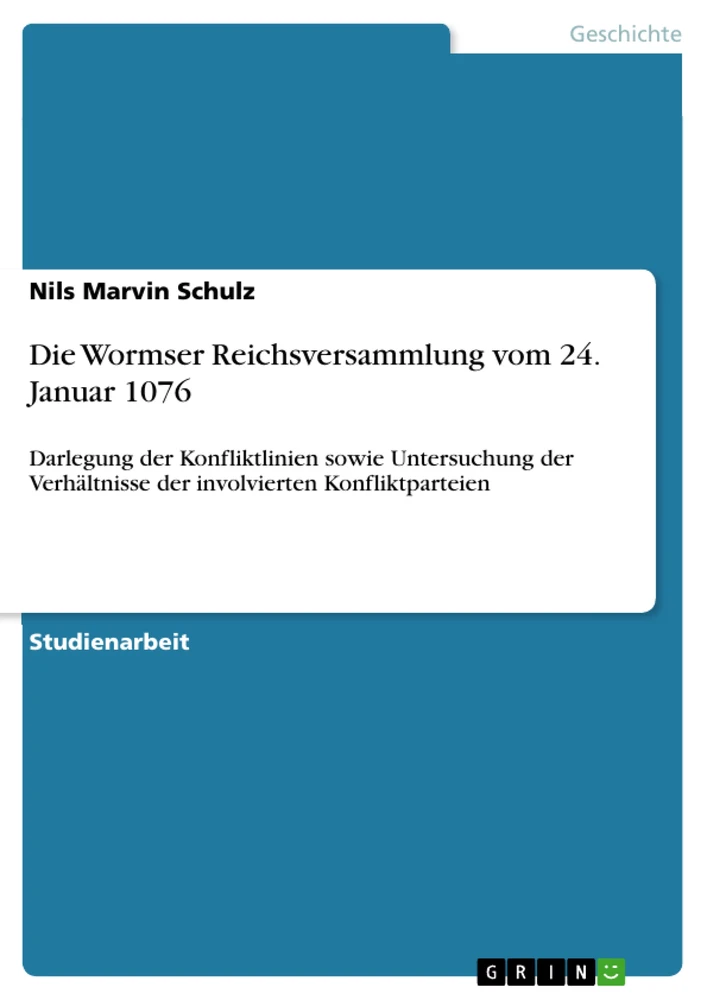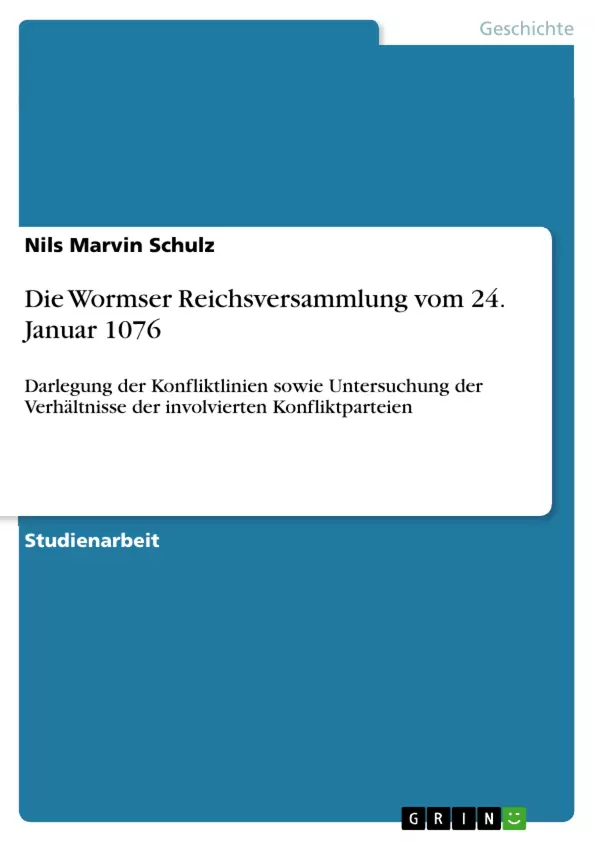König Heinrichs IV. demütiger Gang nach Canossa im Januar 1077 markierte zweifellos das bemerkenswerteste Ereignis des 11. Jahrhunderts. Frierend und barfuss im Schnee stehend präsentierte sich der König dort als reuevoller Büßer, der um Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Kirche bat . Beinahe auf den Tag genau ein Jahr zuvor hatte Heinrich IV. in Worms alles auf eine Karte gesetzt und endgültig mit dem Papst gebrochen. Doch das gemeinsame Vorgehen mit dem Reichsepiskopat und das damit verbundene Scheitern seiner Strategie hätte ihn beinahe für immer seine Königskrone gekostet. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie es zu diesem verhängnisvollen Bruch zwischen „regnum“ und „sacerdotium“ gekommen ist und skizziert stufenweise die Stationen, die letztendlich beinahe zum Scheitern des Königs beigetragen haben. Ebenso wird in den folgenden Untersuchungen der Reichsepiskopat in dieses konträre Verhältnis miteinbezogen und Faktoren abgeführt, die dazu beigetragen haben, dass sich die deutschen Bischöfe gegen den Nachfolger des Apostelfürsten öffentlich auflehnten und gemeinsam mit König Heinrich IV. gegen Gregor vorgingen. Doch zunächst beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage, inwiefern Heinrichs IV. innenpolitische Konflikte mit den Großen des Reichs auf die Beziehungen zwischen dem König und der Römischen Kirche bzw. dem Papst eingewirkt haben. Dazu werden zuerst die grundsätzlichen Probleme der Herrschaftsausübung Heinrichs beleuchtet, um anschließend näher auf den Aufstand der Sachsen einzugehen, welcher die Zeit von 1073 bis 1075 maßgebend prägte. Das dritte Kapitel setzt sich mit der Beziehung zwischen Heinrich IV. und Gregor VII. auseinander, wobei zu anfangs die beiden ideellen Grundlagen von Königtum und Papsttum betrachtet werden, um die sich anbahnenden Konfliktherde schon vorab zu charakterisieren. Daraufhin wird das Augenmerk auf das Verhältnis zwischen Gregors Vorgänger und dem König gerichtet, um eine Art Richtwert zu erhalten, wie Heinrich IV. überhaupt dem Papsttum gegenüberstand. Anschließend wird die wechselseitige Beziehung zwischen Papst Gregor VII. und dem Salier stufenweise dargelegt und dabei untersucht, wie es sich mit dieser Beziehung zwischen König und Papst zwischen 1073 und Juli 1075 konkret verhielt und welche Faktoren dieses Verhältnis beeinflusst haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Innenpolitische Konflikte Heinrichs IV. mit den Großen im Reich
- Grundsätzliche Probleme der Herrschaftsausübung unter Heinrich IV.
- Der Aufstand in Sachsen (1073 - 1075)
- Die Beziehung zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. zwischen 1073 und Dezember 1075
- Zwei sich kontrastierende Herrschaftsvorstellungen
- Die Beziehung zwischen Heinrich IV. und Papst Alexander II.
- Das Verhältnis zwischen König Heinrich IV. und Papst Gregor VII. zwischen 1073 und Juli 1075
- Heinrichs IV. Investituren in Italien
- Heinrichs IV. Bitte um Exkommunikation der sächsischen Bischöfe und der Dezemberbrief des Papstes am Ende des Jahres 1075
- Das Verhältnis zwischen Papst Gregor VII. und dem Reichsepiskopat
- Grundsätzliches in den Beziehungen zwischen Gregor VII. und dem Reichsepiskopat
- Kritikwürdige Eingriffe Gregors VII. im Reich
- Reformsynode und Miteinbeziehung der Laien im Reich
- Eingriffe in die Diözesen
- Gregors häufige Zitationen nach Rom und sein ungestümes Vorgehen
- Die Reichsversammlung von Worms vom 24. Januar 1076 und Heinrichs IV. Vorgehen gegen Papst Gregor VII.
- Der Charakter der Reichsversammlung von Worms
- Das Bischofsschreiben von Worms als Teil der königlichen Strategie und der Verlauf der königlich-päpstlichen Auseinandersetzung am Beginn des Jahres 1076
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen des endgültigen Bruchs zwischen König Heinrich IV. und Papst Gregor VII. im Jahr 1076, der zum Beginn des Investiturstreits führte. Sie betrachtet die Entwicklung des Konflikts in mehreren Schritten, indem sie die Innenpolitik Heinrichs IV., seine Beziehungen zum Papst und die Rolle des Reichsepiskopats beleuchtet.
- Die innenpolitischen Konflikte Heinrichs IV. mit den Großen des Reichs
- Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen König Heinrich IV. und Papst Gregor VII.
- Die Rolle des Reichsepiskopats in der Auseinandersetzung zwischen König und Papst
- Die Strategien Heinrichs IV. im Vorfeld der Reichsversammlung von Worms
- Die Bedeutung der Reichsversammlung von Worms im Kontext des Konflikts zwischen König und Papst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Hintergrund und die Bedeutung der Wormser Reichsversammlung von 1076. Kapitel 2 analysiert die innenpolitischen Konflikte Heinrichs IV. mit den Großen des Reichs, insbesondere den sächsischen Aufstand, der den König zunehmend isolierte. Kapitel 3 beleuchtet die Beziehung zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII., beginnend mit den unterschiedlichen Herrschaftsvorstellungen von Königtum und Papsttum. Es werden die Beziehungen zwischen Heinrich IV. und Gregors Vorgänger sowie die konkrete Entwicklung des Verhältnisses zwischen dem König und dem Papst zwischen 1073 und Juli 1075 untersucht. Besondere Aufmerksamkeit gilt Heinrichs IV. Investituren in Italien und der Bedeutung des Dezemberbriefes des Papstes von 1075. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Papst Gregor VII. und dem Reichsepiskopat, unter Einbezug der kritischen Punkte in Gregors Reformpolitik. Schließlich geht Kapitel 5 auf die Reichsversammlung von Worms vom 24. Januar 1076 ein, beschreibt den Charakter der Versammlung und die Strategie des Königs und der Bischöfe gegen den Papst.
Schlüsselwörter
König Heinrich IV., Papst Gregor VII., Investiturstreit, Reichsversammlung von Worms, Reichsepiskopat, sächsischer Aufstand, Herrschaftsausübung, Investituren, Konfliktlinien, römische Kirche
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für die Wormser Reichsversammlung 1076?
König Heinrich IV. wollte nach Konflikten um Investituren und päpstliche Drohungen den Bruch mit Papst Gregor VII. herbeiführen und dessen Absetzung fordern.
Warum stellten sich die deutschen Bischöfe gegen den Papst?
Der Reichsepiskopat fühlte sich durch Gregors ungestüme Reformen, häufige Zitationen nach Rom und Eingriffe in ihre Diözesen in seiner Autorität verletzt.
Welche Rolle spielte der sächsische Aufstand für Heinrich IV.?
Der Aufstand (1073-1075) schwächte Heinrichs innenpolitische Position massiv und zwang ihn zu strategischen Manövern gegenüber dem Papsttum.
Was war der Inhalt des „Dezemberbriefes“ von Gregor VII.?
In diesem Brief von 1075 drohte der Papst dem König indirekt mit dem Entzug der Herrschaft, falls dieser weiterhin eigenmächtig Bischöfe investieren würde.
Was folgte unmittelbar auf die Versammlung in Worms?
Papst Gregor VII. reagierte mit der Exkommunikation Heinrichs IV., was schließlich zum berühmten „Gang nach Canossa“ im Jahr 1077 führte.
- Quote paper
- Nils Marvin Schulz (Author), 2010, Die Wormser Reichsversammlung vom 24. Januar 1076, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201801