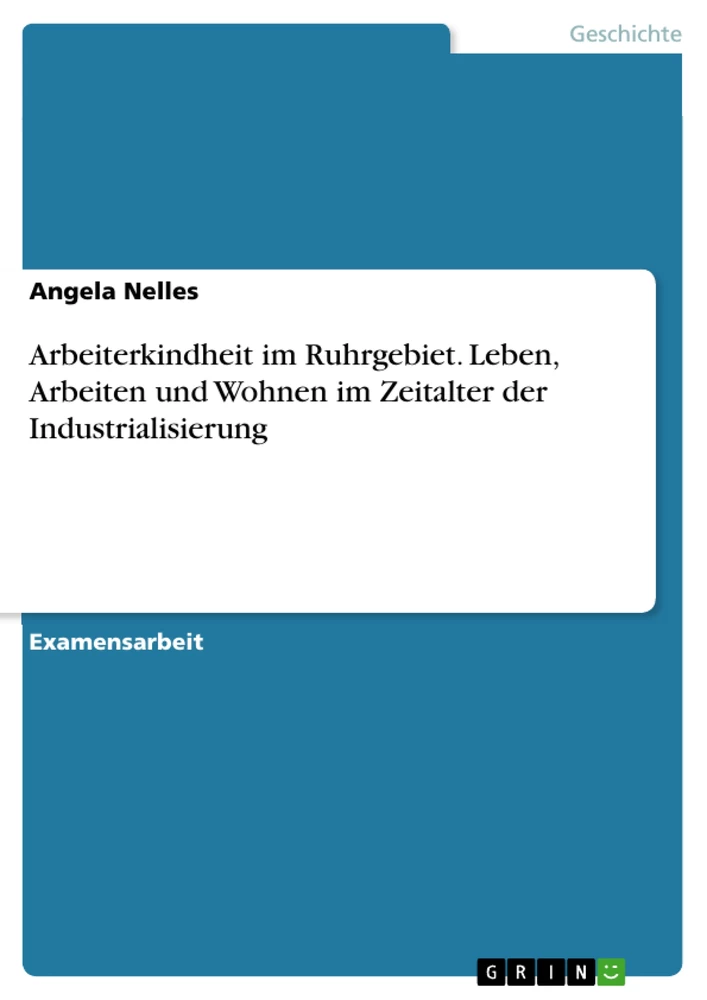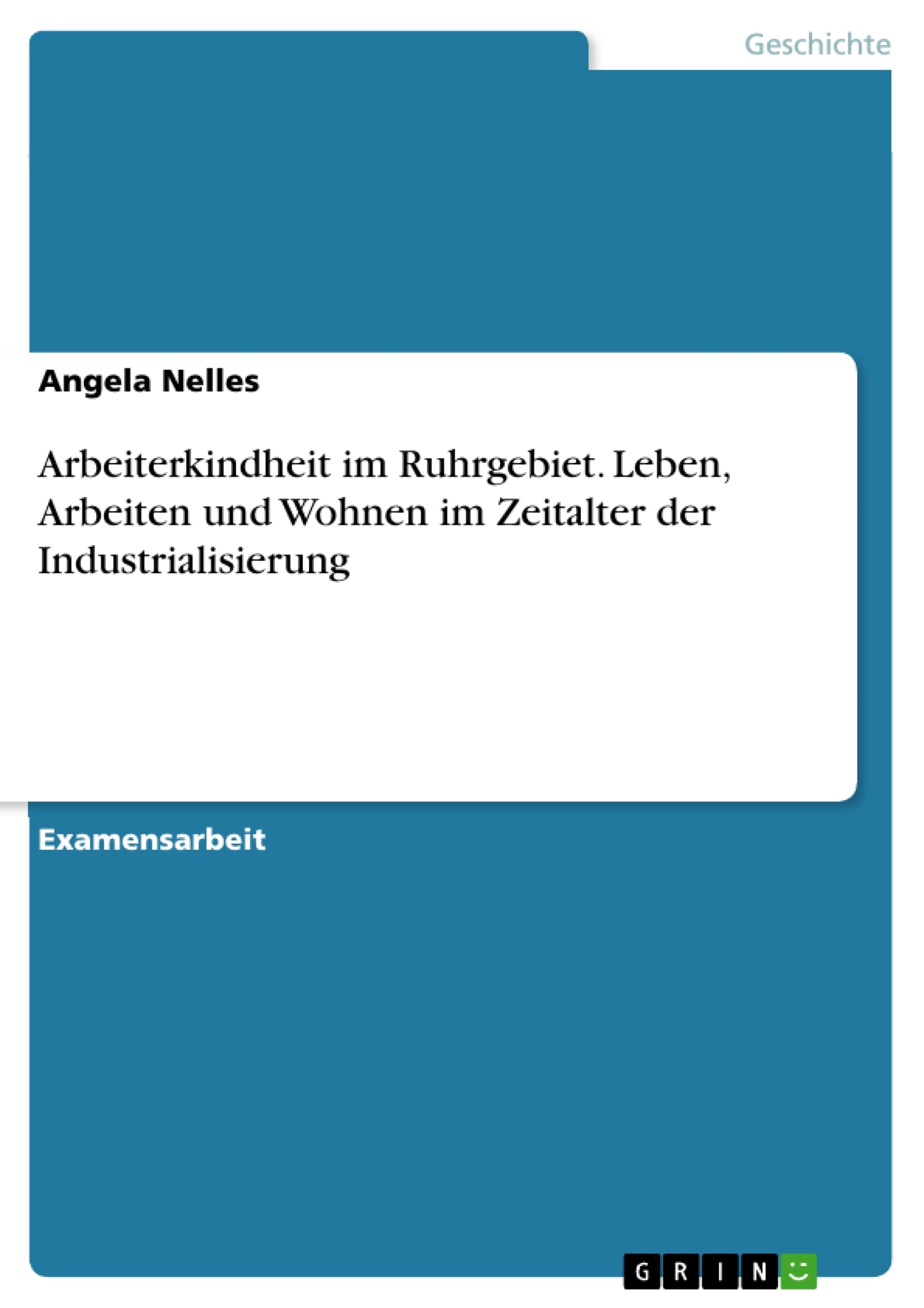Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Arbeiterkindheit im Ruhrgebiet. Im Zuge der industriellen Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrhundert wuchs das Ruhrgebiet zu einem der bedeutendsten Industriereviere der Welt. Das schnelle Wachstum der Industrien zog eine große Zuwanderung von Arbeitern nach sich, welche das Ruhrrevier im Rahmen der zunehmenden Urbanisierung prägten und sich, wie auch in allen anderen Industriegebieten zu einer eigenen Schicht entwickelten.
Im Folgenden wird also die Kindheitsphase der Kinder dieser Arbeiter im Ruhrgebiet behandelt. Die besonderen Lebensumstände der Arbeiter wirkten sich in großem Maße auf die Sozialisation der Arbeiterkinder aus und sollen hier näher beschrieben werden. Schwerpunkt des Betrachtungszeitraums in dieser Arbeit soll das 19. Jahrhundert sein. Erst mit Beginn der Industrialisierung bildete sich der Familientyp „Arbeiterfamilie“ und somit auch die Arbeiterkindheit heraus.
Seit dem ersten Weltkrieg verbesserte sich die Situation der Arbeiter entscheidend. Während sich die Arbeiterschicht im 19. Jahrhundert noch nicht organisiert hatte, um gegen die Unternehmer für ihre Rechte zu kämpfen, gründeten die freien Gewerkschaften 1919 den allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund und setzten sich in der darauf folgenden Zeit erfolgreich für die Verbesserung der Situation von Arbeitern ein. Der hier behandelte Zeitraum soll jedoch auf die Zeit bis zum ersten Weltkrieg 1914 beschränkt sein und die ursprüngliche Situation der Arbeiterkinder behandeln.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Industrialisierung im Ruhrgebiet
2.1 Geographische Einordnung des Ruhrgebiets
2.2 Industrielle Entwicklung des Ruhrgebiets
2.3 Verstädterung und Zuwanderung
2.4 Zusammenfassende Darstellung
3 Wohnsituation der Arbeiterfamilien.
3.1 Private Wohnungen
3.2 Werkswohnungen
3.3 Infrastruktur in den Arbeitervierteln
3.4 Zusammenfassende Darstellung
4 Leben der Arbeiter
4.1 Allgemeine berufliche Situation der Arbeiter
4.2 Arbeitslohn
4.3 Soziale Lage
4.4 Freizeitverhalten
4.5 Zusammenfassende Darstellung
5 Berufliche Lage der Arbeiterfrauen
5.1 Erwerbstätigkeit
5.2 Hausfrauen
5.3 Zusammenfassende Darstellung
6 Familienleben in Arbeiterfamilien
6.1 Sexualität, Ehe und Familienplanung
6.2 Rolle der Kinder in der Familie
6.3 Erziehung der Arbeiterkinder
6.4 Zusammenfassende Darstellung
7 Materielle Versorgung
7.1 Kleidung
7.2 Ernährung
7.3 Gesundheitliche Auswirkungen
7.4 Zusammenfassende Darstellung
8 Kinderarbeit
8.1 Tätigkeiten und Lohn
8.2 Ursachen und Auswirkungen der Kinderarbeit
8.3 Kinderschutzgesetze
8.4 Zusammenfassende Darstellung
9 Schulische Ausbildung der Kinder.
9.1 Die Entwicklung des Schulsystems bis 1919
9.2 Einrichtung der Schule
9.3 Schulalltag
9.4 Unterrichtsinhalte
9.5 Zusammenfassende Darstellung
10 Kindliches Spiel
10.1 Spiele und Spielzeug
10.2 Leseverhalten
10.3 Zusammenfassende Darstellung
11 Schluss
12 Quellen- und Literaturverzeichnis
13 Bildnachweis
Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Die Zonen des Ruhrgebiets nach Steinberg
Abb. 2: Grundrisse eines typischen Arbeiterhauses
Abb. 3: Behelfsbett für das Kleinkind, um 1900
Abb. 4: Bergarbeiterkolonie in Gelsenkirchen
Abb. 5: Werkssiedlung der Firma Krupp und Gussstahlfabrik, 1914
Abb. 6: Schichtlöhne (in Mark) der Männer und Frauen in Oppeln, 1888
Abb. 7: Kinderstuhl zum Stehenlernen
Abb. 8: Ausschnitt aus einer Gruppenaufnahme, Krupp-Lokomotivbau,
Abb. 9: Schuhe von Arbeiterkindern im Ruhrgebiet, 1903
Abb. 10: Erstkommunion, 1912
Abb. 11: Bergarbeiterfamilie mit gemästetem Schwein in Essen-Borbeck ...
Abb. 12: Kinderarbeit in einer Spinnerei. Um 1900
Abb. 13: Schulbänke (oben das Preußische Model mit Maßen)
Abb. 14: Inneres einer Volksschulklasse
Abb. 15: Volksschulklasse im Ruhrgebiet 1903
Abb. 16: Vorschriftsmäßige Sitzhaltung an der Schulbank
Abb. 17: Illustration einer Fibel
Abb. 18: Porzellanpuppe um 1900
1 Einleitung
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Arbeiterkindheit im Ruhrgebiet. Im Zuge der industriellen Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrhundert wuchs das Ruhrgebiet zu einem der bedeutendsten Industriereviere der Welt. Das schnelle Wachstum der Industrien zog eine große Zuwanderung von Arbeitern nach sich, welche das Ruhrrevier im Rahmen der zunehmenden Urbanisierung prägten und sich, wie auch in allen anderen Industriegebieten zu einer eigenen Schicht entwickelten.[1] Der Begriff „Arbeiterschicht“ wird in der Literatur verschieden gedeutet. In der Sozialforschung, welche sich nicht auf die marxistische Sichtweise beruft, wird er oft als Synonym für „Unterschicht“ verwendet, während man ihn im marxistischen Sinn als Bezeichnung einer gesellschaftlichen Klasse verwendet. Der Begriff „Unterschicht“ beschreibt aber auch Personen, wie z.B. Obdachlose oder unregelmäßig arbeitende, also Personen, die keine Arbeiter sind.[2] Ich werde mich in dieser Arbeit ausschließlich auf die Bedeutung des Begriffs „Arbeiterschicht“ im Sinne von Schicht der manuell arbeitenden Industriearbeiter beschränken und von einer Zuweisung zu dieser, außerhalb einer Berufszugehörigkeit absehen
Im Folgenden wird also die Kindheitsphase der Kinder dieser Arbeiter im Ruhrgebiet behandelt. Die Bezeichnung „Kind“ meint in der Rechtssprache lediglich das Abstammungsverhältnis eines Menschen, unabhängig von seinem Alter. Im Beziehungsgefüge Eltern-Kind unterliegt das Kind, im Rahmen seiner Unmündigkeit, der elterlichen Gewalt. „Kindheit“ hingegen bezeichnet seit dem 19. Jahrhundert einen bestimmten Abschnitt im Leben eines Menschen, welcher mit der Geburt beginnt und in einem bestimmten Alter endet.[3] Die besonderen Lebensumstände der Arbeiter wirkten sich in großem Maße auf die Sozialisation der Arbeiterkinder aus und sollen hier näher beschrieben werden.
Schwerpunkt des Betrachtungszeitraums in dieser Arbeit soll das 19. Jahrhundert sein. Erst mit Beginn der Industrialisierung bildete sich der Familientyp „Arbeiterfamilie“ und somit aich die Arbeiterkindheit heraus. Seit dem ersten Weltkrieg verbesserte sich die Situation der Arbeiter entscheidend. Während sich die Arbeiterschicht im 19. Jahrhundert noch nicht organisiert hatte, um gegen die Unternehmer für ihre Rechte zu kämpfen, gründeten die freien Gewerkschaften 1919 den allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund und setzten sich in der darauf folgenden Zeit erfolgreich für die Verbesserung der Situation von Arbeitern ein.[4] Der hier behandelte Zeitraum soll jedoch auf die Zeit bis zum ersten Weltkrieg 1914 beschränkt sein und die ursprüngliche Situation der Arbeiterkinder behandeln.
Zunächst sollen also in Kapitel 2 die industriellen Entwicklungen und die daraus resultierende Urbanisierung des hier zu behandelnden Gebiets erfasst werden, um den Lebensraum der Arbeiterkinder näher beschreiben zu können. Im Anschluss werde ich die allgemeinen Wohnverhältnisse in der Arbeiterschicht beschreiben. Die mit der Verstädterung einhergehende Überbelegung der Wohnungen im Ruhrgebiet betraf vor allem die ärmeren, unteren Schichten, also auch die Arbeiter.[5] Für das Zusammenleben war bedeutsam, wie hoch das Maß der Wohnenge war. Außerdem soll erfragt werden, wie die Kinder bei der Einrichtung der Wohnungen berücksichtigt wurden.
In Kapitel 4 wird die berufliche Situation der Arbeiter erfasst. Die Beziehung zwischen Unternehmer und Arbeiter war durch ein klares UnterÜberordnungsverhältnis charakterisiert, in welchem der Arbeiter fast ausnahmslos abhängig von den Verfügungen seines Arbeitsgebers war.[6] Vor allem Arbeitszeit und Lohn wirkten sich auf die privaten Lebensverhältnisse aus.[7] Ich möchte darlegen, in welchem Maße sich diese Berufsumstände von Arbeitervätern auf den Lebensstandard der Familien auswirkten und ob sie so auch Einfluss auf das Leben der Kinder nahmen. In diesem Zusammenhang soll herausgefunden werden, wie sich Vater-Kind-Beziehungen unter den beschriebenen Begleiterscheinungen der väterlichen Erwerbsarbeit entwickelten.
Anschließend, in Kapitel 5, sollen die Aufgabenbereiche der Mütter in den Arbeiterfamilien beschrieben und in Bezug zu ihren Kindern gestellt werden.
In vielen Fällen waren auch die Mütter außerhäuslich erwerbstätig.[8] Es ist zu ergründen, inwieweit diese Tatsache auf die Erziehung der Kinder einwirken konnte und welche Rolle die Mütter in der Sozialisation der Kinder einnahmen.
Im sechsten Kapitel sollen Besonderheiten des Familienlebens in der Arbeiterschicht thematisiert werden. Ich werde die Berufstätigkeit der Eltern in Bezug zu ihrem Familienleben stellen und die Rolle der Kinder innerhalb des Familiengefüges erläutern Vor allem sind die elterlichen
Erziehungsmaßnahmen und -ziele beleuchten, sowie Schlussfolgerungen für die Persönlichkeitsentwicklung von Arbeiterkindern zu ziehen.
Der anschließende Abschnitt wird die materielle Versorgung der Arbeiter behandeln. Die Arbeiterhaushalte waren durch eine grundlegende Mangellage gekennzeichnet, welche das alltägliche Leben der Arbeiter und folglich auch das ihrer Kinder bestimmte.[9] Es soll in diesem Rahmen erarbeitet werden, wie sich die Mängel bei Kleidung und Ernährung widerspiegelten und welche gesundheitlichen Folgen die Missstände nach sich zogen. Im Besonderen möchte ich klären, ob bei ihrer materiellen Versorgung besonders auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wurde.
Die Einbindung der Kinder in die Existenzsicherung der Familie hat eine lange Tradition, verstärkte sich jedoch mit der industriellen Entwicklung. Die Kinder wurden seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Fabriken und Manufakturen angestellt und verrichteten unter sehr schlechten und gesundheitsgefährdenden Arbeitsumständen monotone Arbeiten.[10] In Kapitel 8 werde ich die Ursachen und Umstände der Kinderarbeit näher ergründen und erklären. Die Auswirkungen dieser auf das Heranreifen der Kinder soll an dieser Stelle insbesondere herauskristallisiert werden.
Mit der Entwicklung des Schulsystems wurde die Rolle des Kindes erstmals institutionell verankert.[11] Die Ausbildung des Schulsystems werde ich in Kapitel 9 darlegen und anschließend die Ausstattungen und Unterrichtsmethoden der zeitgenössischen Schulen beschreiben. Es soll außerdem auf die Teilhabe der Arbeiterkinder an dem damaligen Schulsystem und ihre Bildungschancen eingegangen werden.
In der Kindheit fällt dem Spiel eine besondere Bedeutung zu. Es hilft ihm, seine Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und die Eindrücke zu verarbeiten.[12] Nachdem die Pflichten der Arbeiterkinder in Kapitel 8 und 9 umrissen worden sind, soll sich der nächste Abschnitt der Arbeit mit der Freizeitgestaltung der Arbeiterkinder beschäftigen. Im 10. Kapitel werden das Spiel der Arbeiterkinder, sein Ausmaß und seine Stellung im Alltag herausgearbeitet. Des Weiteren soll hier das Leseverhalten der Kinder beleuchtet werden, wobei die Frage ist, ob die Kinder angesichts der schlechten ökonomischen Lage ihrer Familien Geld und Zeit fanden, um an der zeitgenössischen Literatur teilzuhaben.
Jedem Kapitel ist eine Zusammenfassung angehängt, in welcher die jeweiligen erarbeiteten Erkenntnisse noch einmal wiedergegeben werden, um den erreichten Stand zu dokumentieren.
Insgesamt soll die Arbeit die Faktoren, welche zu der Sozialisation der Arbeiterkinder betrugen zusammentragen und die besonderen Umstände ihrer Kindheit beleuchten.
2 Industrialisierung im Ruhrgebiet
2.1 Geographische Einordnung des Ruhrgebiets
Das Ruhrgebiet liegt im nordwestlichen Mitteleuropa, am Fuß der Mittelgebirgsschwelle. Das Gebiet reicht in der Bördezone von Flandern bis zu der Schlesien-Achse. Im Westen wird das Ruhrgebiet von der nordwestlichsüdöstlich gerichteten Rheinachse gekreuzt. Durch den Rhein, heute noch die meist befahrene Wasserstraße der Welt, ist das Ruhrgebiet mit der Nordsee verbunden.[13]
Des Weiteren lässt sich das Ruhrgebiet in vier Zonen einteilen, welche auf der Karte 1 unten ersichtlich sind. Die Ruhrzone, oder auch das Altrevier beiderseits der Ruhr und die Hellwegzone von Mülheim bis Dortmund liegen im südlichen Ruhrgebiet. Die Zone der Emscherstädte von Oberhausen bis Castrop Rauxel und die Lippezone von Dorsten bis Hamm gehören dem nördlichen Ruhrgebiet an.[14]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Die Zonen des Ruhrgebiets nach Steinberg
2.2 Industrielle Entwicklung des Ruhrgebiets
Vorraussetzung für die Industrialisierung im Ruhrgebiet waren die ergiebigen Steinkohle vorkommen, welche bereits im Mittelalter entdeckt und seit dem auch abgebaut wurden.[15] Der Steinkohlebergbau entwickelte sich zu einem der zwei großen schwerindustriellen Standbeine des Ruhrgebiets. Während an den Ruhrhöhen, im Süden des Ruhrgebiets, die Kohle zu Tage tritt, sind die Flöze nördlich der Ruhr unter einer Schicht von Kreidefels (Mergelschicht) bedeckt, die an der nördlichen Ruhrgebietsgrenze mehrere hundert Meter dick ist. Während der Bergbau also an der Ruhr bereits lange vorindustrielle Tradition hatte, konnten die nördlichen Kohlevorkommen wegen mangelnder Technisierung noch nicht erschlossen werden. Das Kernrevier zwischen Hellweg und Emscher blieb landwirtschaftlich geprägt.[16] Erst die Entwicklung der Dampfmaschine in der Mitte des 19. Jahrhunderts brachte den Durchbruch zur Großindustrie. Mit ihrer Hilfe konnte nun die Mergeldecke durchstoßen, das einbrechende Grundwasser abgepumpt und für eine ausreichende Belüftung der Schachtanlagen gesorgt werden.[17] 1843 wurden bereits 95 Dampfmaschinen auf 48 Ruhrgebietszechen eingesetzt und die Kohlezechen wurden immer weiter nördlich der Ruhr angelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Zechen Nebenbetriebe von Handwerkern oder Landwirten gewesen, die im Handbetrieb gerade so viel Kohle, hauptsächlich Magerkohle abbauten, dass ihr Eigenbedarf an Heizkohle gedeckt wurde. Dank der Mergelzechen konnte nun auch die Fettkohle von höherer Qualität und mit zunehmender Mechanisierung in größeren Mengen abgebaut werden. [18] Das Ruhrgebiet war ein relativ junges Industriegebiet, dessen eigentliche Entwicklung also erst mit der 1840 einsetzenden Großindustrialisierung begann. Jedoch war es bereits kurz vor dem ersten Weltkrieg zu einem der bedeutendsten Steinkohlegebiete der Welt geworden. [19]
Das zweite große schwerindustrielle Standbein im Ruhrgebiet war die Eisen- und Stahlproduktion. Auch die Hüttenindustrie entstand zunächst in Form von Kleinbetrieben. Erst 1848 wurde der erste Koksofen, welcher bereits 1735 in England entwickelt worden war, im Ruhrgebiet eingesetzt.[20] Bisher hatte man Holzkohle zur Verhüttung von Eisen verwendet, da eine Verunreinigung des Eisens durch die Steinkohle noch nicht vermieden werden konnte. Dank des in England entdeckten Puddel-Verfahrens, konnte nun auch die viel ergiebigere Steinkohle verarbeitet werden und die in den Mergelzechen des Ruhrgebiets gehauene Fettkohle wurde zur Stahlherstellung verfeuert.[21] Trotz ansteigender Förderung des Rohstoffs Eisenerz, waren die Koksöfen im Ruhrgebiet auf revierfremde Erze angewiesen, da die Nachfrage überproportional anstieg.[22] Für den Transport der Erze, der Kohle und des Stahls gewannen die Wasserwege große Bedeutung. Die Ruhr war Hauptverkehrsverbindung für den Transport der Industriegüter und wurde 1899 durch den Dortmund-Ems-Kanal, der die Erzgebiete im Dortmunder Raum an das RG anbinden sollte, ergänzt.[23] Neben dem Transport der Rohstoffe per Dampfschiff erschloss man seit 1847 mit dem Eisenbahnnetz das Ruhrgebiet von Süden nach Norden.[24] Es hatten sich also seit Mitte des 19. Jahrhunderts drei neue Steinkohleverbraucher entwickelt, die einander zu Expansion verhalfen: Die Koksöfen, das Dampfschiff und die Eisenbahn.[25]
Die Industrialisierung des Ruhrgebiets bis zum Beginn des ersten Weltkrieges 1914 lässt sich zeitlich in drei Abschnitte einteilen. Die erste Gründerzeit setzte in den 1840er Jahren ein und mündete 1870 in eine neue Gründungswelle. Diese wurde bereits 1874 von einer langen Krisenzeit abgelöst, welche zwar mehrere kurze Belebungen erfuhr, jedoch erst 1885 von einem neuen Aufschwung abgelöst wurde.[26] Die industrielle Entwicklung zwischen 1914 und 1945 litt unter schweren wirtschaftlichen Schwankungen und zahlreichen Tiefpunkten, woraufhin ein Strukturwandel einsetzte, welcher noch heute anhält.[27]
2.3 Verstädterung und Zuwanderung
Nachdem die ländliche Bevölkerung nach der Bauernbefreiung 1848 stark anwuchs und die Aufhebung der Zünfte das Wachstum der industriellen Ansätze in den Städten ermöglichte, zogen nun große Teile der ländlichen Bevölkerung in die Stadt, um neue Arbeitsmöglichkeiten zu nutzen. Die in das Ruhrgebiet gewanderten Menschen kamen zunächst vorwiegend aus dem Münsterland, dem Hessisch-Nassauischen und Minden-Ravensberg.[28] Der tatsächliche Zuwachs in den Ruhrgebietsstädten lässt sich allerdings in den ersten Jahren der Gründerzeit nicht einwandfrei statistisch erfassen.[29] Während sich die industriellen Fabriken und Schachtanlagen an den für ihre Produktion bedeutsamen Standortfaktoren orientierten und sich unabhängig von den Städten ansiedelten, zogen die zugewanderten Arbeiter zunächst in die alten Stadtkerne. Die Zuwanderungswelle wurde zuerst als vorübergehende Erscheinung aufgefasst und eine Stadtplanung im heutigen Sinne existierte damals nicht. So baute man zufällig und zusammenhangslos Zechen, Fabriken, Bahnhöfe und vereinzelte Häuser außerhalb der Stadtmauern der Altstädte.[30] Zwischen 1837 und 1871 hat sich die Bevölkerung des Ruhrgebiets von 289.200 auf 703.100 mehr als verdreifacht, wobei die Entwicklungen in einzelnen Städten noch drastischer verlaufen sind.[31] Die Bevölkerung Essens zum Beispiel stieg zwischen 1852 und 1871, also in knapp zwanzig Jahren, um das Fünffache.[32]
Bald konnte die alte Baustruktur innerhalb der Stadtmauern die Massen der Zuwanderer nicht mehr aufnehmen und die Unternehmen sahen sich gezwungen, für Alternativen zu sorgen. Der Bergbau begann bereits Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Bau von Kolonien für seine Arbeiter. Die erste Kolonie im Ruhrgebiet wurde 1844 für die Belegschaft der Gutehoffnungshütte in Eisenheim im heutigen Oberhausen gebaut.[33] Da in den kommenden Jahrzehnten immer mehr Schächte abgeteuft und somit immer mehr Arbeitskräfte benötigt wurden, bauten die Zechenbesitzer auch immer mehr solcher Kolonien. Die Häuser der Kolonien waren meist ein- oder zweigeschossig und für zwei bis vier Familien ausgelegt. Sie waren charakterisiert durch ihr einheitliches Erscheinungsbild und ihre roten, unverputzten Ziegelfassaden. Die Ziegel konnten aus dem Erdmaterial gebrannt werden, welches bei dem Vortrieb der Stollen ohnehin anfiel. In Anlehnung an den Großteil der zugewanderten Arbeiter waren Grundriss und Stil an bäuerlichen Häusern angelehnt. Außerdem hatten ca. 86% der Zechenhäuser im Ruhrgebiet einen Garten und 96% waren mit einem Stall ausgestattet.
Während der Bergbau seine Kolonien oft fern von den bestehenden Siedlungen baute, lehnte sich die Eisenschaffende Industrie oft an den Rand der vorhandenen Städte an und trug damit weiter zu dem Ansteigen der Stadtbevölkerung bei.[34] [35] Doch auch die Stahlindustrie war auf werkseigene Quartiere angewiesen, um die Masse der Arbeiter unterbringen zu können. Die Arbeiter, welche ohne ihre Familien einwanderten, wurden in so genannten Menagen untergebracht. In diesen Mietskasernen bot man Platz für bis zu 5000 Männer und sorgte für deren Verköstigung. Die Arbeiter aßen zusammen in großen Speisesälen und schliefen in großen Schlafsälen. Diese Schlafhäuser waren bei den Arbeitern aufgrund der strengen Hausordnung und der unpersönlichen Atmosphäre allerdings nicht sehr beliebt.[36] Eine Alternative dazu war das Schlafgänger- oder auch Kostgängertum. Viele Familien nahmen einen oder mehrere Untermieter in ihrer ohnehin sehr kleinen Wohnung auf und boten ihnen eine Schlafstelle, die nötige Verpflegung und die Reinigung und Pflege der Wäsche. Manche Betriebe unterstützten das Schlafgängerwesen, und somit auch die Überbelegung der Wohnungen, indem sie den Familien als Dank für die Aufnahme der Schlafburschen eine Mietminderung einräumten.[37] Mit dem Kostgeld konnten die Familien vor allem Krisensituationen, wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit des Hauptverdieners überbrückten.[38]
Seit den 1870er Jahren wanderten große Teile aus den preußischen Ostprovinzen in das Ruhrgebiet, da man ihnen in dem neuen Industriegebiet höhere Löhne zahlte, als in ihrer Heimat. Die Zahl der Nahwanderer reichte nicht mehr aus, um die benötigte Arbeitskraft zu decken und die staatlichen Behörden genehmigten die Anwerbung von Arbeitern aus Schlesien.[39] Die Betriebe sandten in den 1880er Jahren, seit der Genehmigung, professionelle Werber in die agrarischen Ostgebiete, welche teilweise ganze Dörfer mit verschönernden Berichten über die Werkswohnungen und die hohen Lohnversprechungen in das Ruhrgebiet lockten.[40] So nahm die Zahl der Zuwanderer aus Polen, Masuren und den angrenzenden Provinzen Posen und Oberschlesien stetig zu. 1880 zählte man in Rheinland-Westfalen 40.000 Personen aus vier preußischen Ostprovinzen. 1910 wurden dort fast 500.000 Personen gezählt. Die Motive der Zuwanderung unterschieden sich kaum, jedoch kamen manche eher zufällig in die Ruhrregion, andere waren von Werbern, Bekannten oder Verwandten über die besseren Bezahlungen informiert worden.[41] Bis zum ersten Weltkrieg zogen ca. 800.000 Menschen in das Ruhrgebiet, wobei 50% von diesen polnischer Herkunft waren.[42] Die Gesamtzahl der zugewanderten Menschen wirkte sich auf die Bevölkerungsstruktur des Ruhrgebiets so aus, dass sie im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 50-60% der Ruhrbevölkerung ausmachten.[43]
Durch die Masse an Zuwanderern in den letzten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts und den gleichzeitigen Geburtenüberschuss veränderten sich die Dörfer und Städte des Ruhrgebiets sehr stark, es entwickelten sich so genannte Industriedörfer. Also Orte, welche durch die Migration der Arbeiter über 100.000 Einwohner zählten, jedoch immer noch den Rechtsstatus eines Dorfes hatten und denen es somit an Verwaltungsrechten fehlte. Solche Industriedörfer, wie z.B. Hamborn, mit 100.721 Einwohnern im Jahre 1910, wurden von einer Eingemeindungswelle erfasst und zu neuen Großstädten zusammengeschlossen.[44] Erst nach 1890 griff ein festes kommunales Berufsbeamtentum planend in den Urbanisierungsprozess ein, und versuchte, bis in das 20. Jahrhundert hinein, durch weitere, längst überfällige Eingemeindungen, die Städteverwaltung zu optimieren.[45] Das hektische Städtewachstum und der daraus resultierende Wandel des Landschaftsbildes hielten bis zum ersten Weltkrieg an Durch die Niederlage Deutschlands im Krieg, die Besetzung des Rheinlandes, die Inflation und die Weltwirtschaftskrise wurden die industrielle Entwicklung, sowie die Urbanisierung abgebremst.[46]
2.4 Zusammenfassende Darstellung
Der rasante Ausbau der Industrie im Ruhrgebiet, der in den 1840er Jahren einsetzte, zog wegen seines enormen Bedarfs an Arbeitskräften eine große Zuwanderungswelle nach sich, welche die Kapazität der bestehenden Wohneinheiten der Städte sprengte. Städtebauliche Behörden existierten zu dieser Zeit nicht und der Werkswohnungsbau siedelte sich ungehemmt, nur an seinen Standortfaktoren orientiert, in der Landschaft des Reviers an. Es entstanden neue Siedlungen, und durch die Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Eingemeindungenaußerdem einige neue Großstädte.
3 Wohnsituation der Arbeiterfamilien
3.1 Private Wohnungen
Nachdem die Arbeitsemigranten zunächst in den bereits vorhandenen Bauten unterkamen und diese, wie oben bereits beschrieben, schnell überbelegt waren, richtete sich der private Wohnungsbau auf große Mietermassen ein und baute seit den 1870er Jahren bis zu dreistöckige Mietshäuser, worin jedes Zimmer vom Flur aus erreicht werden konnte. Durch diese Bauweise konnte der Besitzer, je nach Nachfrage, verschiedene Zimmeranzahlen vermieten. Die Häuser waren schnell überbelegt und hatten weder Gartenanlagen oder Stallungen, noch Balkone.[47]
Da die Bautätigkeit nicht mit der Nachfrage Schritt halten konnte, vermietete man die frisch errichteten Häuser an so genannte „Trockenwohner“, welche dort verbilligt wohnten, solange die Wände noch nicht ausgetrocknet waren. Diese Wohnweise konnte vor allem bei Kindern gesundheitliche Schäden wie Tuberkulose auslösen.[48] Die Auswirkungen des Wohnungsmangels wirkten sich auch auf die Qualität der Bauweise aus. Um Zeit und Geld zu sparen, verputzte man die Mietshäuser nicht komplett, so dass Feuchtigkeit eindrang und Schimmelpilze entstanden, wobei man andererseits die Fassade sehr aufwändig mit Stilelementen der Neorenaissance und des Barock verzierte, um die Mängel der Wohnräume zu kaschieren.[49]
In den neu gebauten Mietshäusern gab es häufig kein Kellergeschoss, jedoch wurde jeder Raum bis unter das Dach vermietet. Eine Familie bewohnte 1-3 Zimmer, zu denen eine Küche und ein oder zwei Schlafkammern gehörten.[50] Die Küche war im Winter der einzige beheizte Raum in der Wohnung und somit auch der Raum, in dem man sich die meiste Zeit aufhielt. Hier saß man zusammen, es wurde gekocht und gegessen, Schulaufgaben gemacht, Wäsche gewaschen und diese bei schlechtem Wetter auch getrocknet.[51] In dem Schlafzimmer schlief meist die ganze Familie, teilweise mit Schlafgängern zusammen, und mehrere Familienmitglieder teilten sich ein Bett. Die Kochdämpfe oder Waschdämpfe aus der Küche schlugen sich im Winter an den kühlen Wänden der Schlafkammer nieder und setzten sich in die Kleider und Betten. Um Heizkosten zu sparen, schränkte man das Lüften der Räume jedoch auf das Nötigste ein, so dass die Luft in Winterzeiten immer stickig war.
Die Wohnräume hatten keine Wasser- bzw. Abwasserleitungen, so auch keine sanitären Anlagen. In manchen Mietskasernen gab es im Treppenhaus eine Wasserentnahmestelle, die sich alle Bewohner des Hauses teilten und die oft wegen des hohen Gebrauchs überschwemmt, verschmutzt oder defekt war. Die Aborte befanden sich entweder im Hinterhof oder im Treppenhaus und wurden von mehreren Familien genutzt. So wirkte sich die hohe Belegung der Häuser auf ihren allgemeinen Zustand aus. Die Treppenhäuser waren verschmutzt und schlecht gelüftet, die Toiletten waren ebenso verdreckt oder gar defekt, da häufig die Rohre verstopften. Falls der Vater Bergmann war, konnte er sich in der zecheneigenen Waschkaue waschen, ansonsten wuschen sich alle Familienmitglieder, ohne fließendes Wasser, in einem Bottich in der Küche.[52]
Um 1900 waren nur sehr wenig Arbeiterhaushalte an ein Gasnetz angeschlossen, während das Bürgertum von den Anschlüssen bereits profitierte. Ähnlich verhielt es sich mit dem Stromnetz. Nur die bürgerlichen Haushalte verfügten über elektrisches Licht und die Arbeiter nutzten die Glutröte der Kohlen im Herd, Petroleumlampen und Talg- oder Stearinkerzen.[53]
Die Innenräume waren meist dürftig ausgestattet, da der Großteil des Lohns für die Lebenserhaltungskosten verbraucht wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts gab die Arbeiterfamilie 60-70% des Lohns allein für Nahrung aus, die nächst größere Summe wurde für die Miete aufgewendet. Die Höhe der Miete veranlasste viele Familien, Mietschulden zu machen und so die Zwangsräumung zu riskieren.[54] Die Fußböden waren mit einfachen Holzdielen ausgelegt und die Wände verputzt oder gekalkt, aber nur selten tapeziert. Doch auch innerhalb der Arbeiterschaft war eine soziale Differenzierung festzustellen, welche sich auch in der Wohnausstattung widerspiegelte. Die kinderarmen oder spezialisierten Arbeiter hatten z.B. ein Wachsledersofa in der Stube oder in der Küche, während die ärmeren Arbeiter die übliche Holzbank benutzten.[55]
„In der Küche, die gleichzeitig Hauptwohnraum war, gab es zu jener Zeit nur einen Tisch, die Stühle und den Schrank. In der Ecke stand der unentbehrliche Kohlenherd. Für jeden einen Teller, eine Tasse und einige Töpfe und Schüsseln, damit ist die Liste bald erschöpft. Es gab weder eine Wasserleitung noch Gas oder elektrisches Licht, es gab weder Bad noch Toilette im Haus. Teppiche waren unbekannt, es hingen auch keine oder nur wenige Bilder an den weißgetünchten Wänden. Also viele der Ausstattungsgegenstände von heute gab es nicht. Das gleiche gilt für die Stube und die Schlafkammer.“[56]
In den Wohnungen wohnten, auch durch die Untervermietung an Kostgänger zu viele Menschen auf engstem Raum beisammen, so dass es keine Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohner gab.[57] Die durchschnittliche Wohnungsgröße der Arbeiterfamilien mit mehreren Kindern im Deutschen Kaiserreich lag im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zwischen 20 und 45qm. Erst um 1905 stieg die Durchschnittsgröße der Arbeiterwohnungen auf 55-60qm, wobei sich an der Zimmernutzung nichts änderte.[58] Die folgenden Grundrisse Zeigen die typische Arbeiterwohnung, bestehend aus der Wohnküche und einem, bzw. zwei Schlafzimmern. Hier gab es keine Türen, so dass man innerhalb der Wohnung und auch vom Hausflur aus in die Zimmer einblicken konnte. Vor allem die Privatsphäre auf dem Klosett, links und rechts des Treppenhauses, war nicht gewährleistet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Grundrisse eines typischen Arbeiterhauses
Während sich also das Kinderzimmer in den bürgerlichen Wohnungen immer mehr verbreitete, war den Räumen, bis auf die Schlafkammer, noch nicht einmal eigene Funktionen zugeteilt.[59] Den Kindern wurde, allein schon durch die Tatsache, dass es keine Kinderstube gab, keine Rückzugsmöglichkeit geboten, so dass Kinder nicht vor negativen Erfahrungen geschützt werden konnten. Sie teilten sich mit den Erwachsenen ein Schlafzimmer und bekamen deren Sexualleben aus unmittelbarer Nähe mit, ohne aufgeklärt worden zu sein. Das Bürgertum betrachtete die Arbeiterfamilie als Ort der Sittenlosigkeit und Verwilderung und wies des Öfteren auf die traumatischen Erfahrungen der Kinder in den Schlafzimmern der Eltern hin.[60] Im Folgenden ein Beispiel für den provisorischen Charakter den die Einrichtung häufig hatte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Behelfsbett für das Kleinkind, um 1900
Durch die fehlende Privatsphäre bestand ein großes Konfliktpotential innerhalb der Familien und ebenso innerhalb des Hauses. Die Enge wurde aber vor allem bei Krankheitsfällen ein Verhängnis. Falls ein Familienmitglied erkrankte, konnte es nicht isoliert werden. Vor allem Kinder, die oft alle in einem Bett schliefen, konnten einer Infektion durch die Geschwister nicht entkommen. Der Mangel an Luft, die Kälte im Winter und die Überhitzung im Sommer begünstigten einen chronischen Verlauf der Krankheiten. Typhus und Cholera verbreiteten sich schnell innerhalb eines ganzen Hauses.[61]
3.2 Werkswohnungen
Wie bereits beschrieben, begannen die Zechenbesitzer schon früh mit dem Werkswohnungsbau im Ruhrgebiet, da die privaten Unterbringungen für ihre Arbeiterschaft nicht mehr ausreichten und die Missstände in diesen immer weiter zunahmen. Die Stahlunternehmen folgten dem Bergbau bald, so dass beide Industriezweige das Bild der Städte und das Tempo der Urbanisierung bestimmten, wobei sie ähnliche Motive verfolgten.[62] Durch den Bau von Wohnungen auf betriebseigenem Gelände umgingen die Zechenbetriebe hohe Entschädigungskosten, welche im Falle von Bergschäden angefallen wären.[63] Da die Schächte nach Lage der Flöze und unabhängig von bestehenden Siedlungen angelegt wurden, konnte man den Arbeitern durch zechennahe Anbindung der Kolonien lange Arbeitswege ersparen und sie gleichzeitig zur Disziplin bringen.[64]
Die Fabriknähe wirkte sich auf die Wohnqualität sehr negativ aus. Die Silhouette bestand aus Fördertürmen, Kesselhäusern, Schornsteinen, Werkstätten und Gleisanlagen. Die Wohnanlagen wurden teilweise von Schienenverkehr durchquert, auf welchen Tag und Nacht Güterzüge verkehrten. Außerdem belasteten Schmutz, Lärm und übel riechende Gase die Umwelt und die Gesundheit der Bewohner.[65] Viele Werke ließen zu jedem Schichtwechsel Sirenen laufen, so dass jeder Arbeiter selbst in der eigenen Wohnung davon hörte und er seinen Arbeitsantritt nicht verpassen konnte. Die Mietverträge dieser Unterkünfte waren an das Beschäftigungsverhältnis gekoppelt. Falls ein Arbeiter kündigen wollte, oder selbst gekündigt wurde, musste er mit seiner Familie gleichzeitig auch die Wohnung räumen und eine neue Unterkunft auf dem knappen Wohnungsmarkt suchen. Auch im Falle eines Streiks hatte der Unternehmer das Recht, die Mietverhältnisse zu kündigen, so dass die Beschäftigten zu diszipliniertem Arbeiten gezwungen waren und Lohnkürzungen oder -streichungen streiklos hinnahmen.[66]
Die Mieten der Koloniehäuser waren bis zu 50% günstiger als die der privaten Besitzer und überzeugten meist mit besserer Bausubstanz.[67] Und dennoch waren diese Wohnungen nicht sehr beliebt. Der Arbeitsplatz eines an- oder gar ungelernten Arbeiters konnte jederzeit ersetzt werden, so dass Kündigungen nicht selten waren. Durch die oben beschriebene Koppelung von Miet- und Arbeitsverhältnis wechselte also häufig die Nachbarschaft, so dass ein Heimatgefühl durch feste Beziehungen innerhalb der Siedlung selten aufkam. Die Homogenität ihrer Bewohner in Beruf, Schicht, Lebenssituation und Zukunftsperspektive innerhalb einer Siedlung unterstützte die resignierende Haltung der Arbeiter und hielt ihnen ihre Segregation aus der Gesellschaft täglich vor Augen. Jeder konnte an dem typischen äußeren Erscheinungsbild einer Kolonie erkennen, dass dort ausschließlich die vierte Klasse wohnte. Die Werkswohnungen für die Angestellten und Beamten der Industrie waren weit aus prächtiger gestaltet und lagen außerhalb der Kolonien. Darüber hinaus wurde dem Arbeiter keine effektive Erholung von der Arbeitszeit ermöglicht. Die unmittelbare Nähe zum Werksgelände, der von dort ausgehende Lärm und die Schichtwechselsignale erinnerten ihn ständig an seine Tätigkeit als Arbeiter und hinderten ihn an geistiger Entspannung.[68] Alfred Krupp gestand sich in hohem Alter, nachdem er zahlreiche Kolonien hatte bauen lassen, ein, dass sich der Zwang zu räumlicher und sozialer Gemeinschaft, wie er in den
Kolonien charakteristisch war, gefährlich auf das Zusammenleben der Arbeiter auswirken konnte. So waren die gartenstädtischen Werkssiedlungen ab 1900, in denen die Familien verschieden Hauseingänge und voneinander abgeschirmte Gartenabschnitte benutzten, nach Isolation ausgerichtet.[69] Die Architektur der Gartenstadt war nach diesen Aspekten ausgelegt und die Freiheit des Individuums in den Mittelpunkt gesetzt worden. Die Fassaden waren unterschiedlich gestaltet und die Gesellschaftsklassen durchmischt untergebracht worden.[70] Auf der folgenden Fotografie sieht man den typischen Backsteinbau der Koloniehäuser, die angrenzende Grünfläche und Stallungen, sowie Schornstein und Förderturm der zugehörigen Zeche im Hintergrund. Das darauf folgende Bild zeigt die Werkswohnungen der Firma Krupp (Essen), in unmittelbarer Nähe zu den kruppschen Werksanlagen. (oberer Bildrand). Die Lärmbelästigung durch die Stahleherstellung und -verarbeitung muss hier enorm gewesen sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Bergarbeiterkolonie in Gelsenkirchen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Werkssiedlung der Firma Krupp und Gussstahlfabrik, 1914
Obwohl die Unternehmer die Werkswohnungen im Laufe der Industrialisierung komfortabler ausstatteten, hat sich das Motiv des Baus nicht geändert. Die Beschaffung der Wohnungen diente einzig der Beschaffung von Arbeitskräften und nicht allein der Fürsorge für die Arbeiter. Diese Fürsorge sollte den Arbeiter genügsam machen, ihn von Streiks fern halten und an den Betrieb binden.[71] In der Verbesserung der Wohnsituationen, welche sich von denen im privaten Wohnungsbau kaum unterschieden, z.B. durch das Anlegen eines Gartens für jede Familie, sollten Arbeiter vom Wirtshaus und somit von übermäßigem Alkolohkonsum und Politisierung abgehalten werden. Mit der Annäherung des Wohnstandards an den des Bürgertums und der daraus resultierenden Zufriedenheit, erhofften sich die Unternehmer die Entpolitisierung der Arbeiter.[72]
[...]
[1] Steinberg, 1985, S. 71
[2] Ortmann, 1972, S. 34
[3] Mühlbauer, 1991, S. 16
[4] Ruhrlandmuseum, 2000, S. 118
[5] Flecken, 1981, S. 58
[6] Rosenbaum, 1996, S. 387
[7] Flecken, 1981, S. 35
[8] Rosenbaum, 1996, S. 402
[9] Rosenbaum, 1996, S. 383
[10] Flecken, 1981, S. 90
[11] Flecken, 1981, S. 116
[12] Flecken, 1981, S. 147
[13] Steinberg, 1985, S. 1
[14] Steinberg, 1994, S. 147
[15] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 14
[16] Steinberg, 1985, S. 7
[17] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 67
[18] Steinberg, 1985, S. 7
[19] Steinberg, 1985, S. 71
[20] Steinberg, 1985, S. 9
[21] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 50
[22] Steinberg, 1985, S. 21
[23] Steinberg, 1985, S. 23
[24] Steinberg, 1985, S. 9
[25] Steinberg, 1994, S. 140
[26] Steinberg, 1985, S. 34
[27] Steinberg, 1985, S. 182
[28] Weber, 1982, S. 53
[29] Steinberg, 1994, S. 237
[30] Ruhrlandmuseum Essen, 1988, S. 6
[31] Steinberg, 1985, S. 28
[32] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 182
[33] Steinberg, 1985, S. 33
[34] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 224-226
[35] Steinberg, 1985, S. 37
[36] Biecker; Buschmann, 1985, S. 83
[37] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 231
[38] Flecken, 1981, S. 61
[39] Weber, 1982, S. 53
[40] Saul, 1982, S. 14
[41] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 82
[42] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 183
[43] Weber, 1982, S. 53
[44] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 185 ff.
[45] Weber, 1982, S. 54
[46] Steinberg, 1994, S. 241
[47] Steinberg, 1985, S. 38
[48] Flecken, 1981, S. 58
[49] Ruhrlandmuseum Essen, 1988, S. 23
[50] Saul, 1982, S. 154
[51] Rosenbaum, 1996, S. 419
[52] Saul, 1982, S. 154-155
[53] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 159-160
[54] Rosenbaum, 1996, S. 413-418
[55] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 213
[56] Kaisen; zitiert nach Flecken, 1981, S. 55
[57] Rosenbaum, 1996, S. 420
[58] Saul, 1982, S. 124
[59] Flecken, 1981, S. 52
[60] Flecken, 1981, S 61-62
[61] Flecken, 1981, S. 57-58
[62] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 182
[63] Steinberg, 1985, S. 37
[64] Steinberg, 1985, S. 37
[65] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 235
[66] Rosenbaum, 1996, S. 418ff.
[67] Ruhrlandmuseum Essen, 2000, S. 221
[68] Saul, 1982, S. 148
[69] Biecker; Buschmann, 1985, S. 20-21
[70] Saul, 1982, S. 148
[71] Saul, 1982, S. 149
[72] Ruhrlandmuseum Essen, 1988, S. 35
- Citar trabajo
- Angela Nelles (Autor), 2006, Arbeiterkindheit im Ruhrgebiet. Leben, Arbeiten und Wohnen im Zeitalter der Industrialisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201807