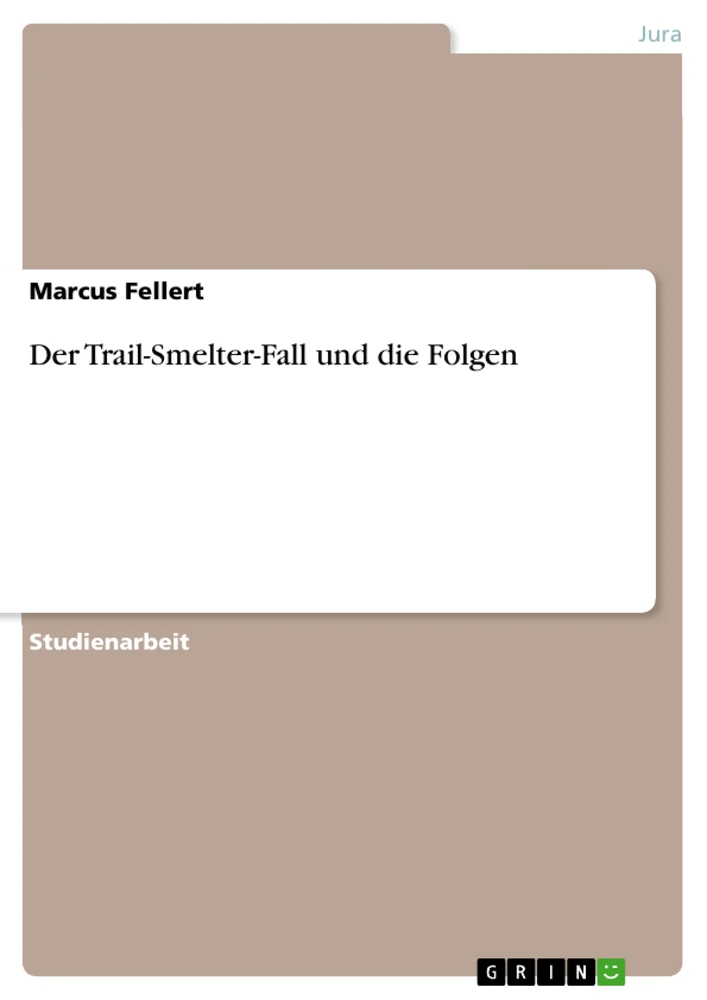Die Staatengemeinschaft beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten. (vgl. Art. 2 Ziffer 1 UN-Charta) Diese grundlegende Feststellung zeigt zugleich ein wesentliches völkerrechtliches Problem auf. Ob ein Staat eine umweltbelastende Anlage in seinem Territorium errichtet, ist allein seine Entscheidung. Kommt es jedoch mit einem Nachbarstaat durch grenzüberschreitende Immissionen zu Differenzen, greift das Prinzip der territorialen Integrität ein. Der Grundstein dafür wurde in der Trail-Smelter-Entscheidung gelegt. Der Trail-Smelter-Fall zählt zu den “klassischen“ Entscheidungen im Völkerrecht. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Trail-Smelter-Fall und seinen Folgen.
Diese Ausarbeitung soll die Entwicklung von Anfangs einzelnen bilateralen Abkommen hin zur Entwicklung von völkergewohnheitsrechtlichen Prinzipien zeigen. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, ob die Trail-Smelter-Entscheidung das Völkerrecht beeinflusst hat. Zuerst werden die entscheidenden Aspekte zur Trail-Smelter-Entscheidung erläutert. Anschließend gibt es einen Überblick zur Entwicklung des internationalen Umweltrechts. Danach wird vom völkerrechtlichen Nachbarrecht ausgehend detailliert das in der Trail-Smelter-Entscheidung entstandene Verbot der erheblichen grenzüberschreitenden Umweltschädigung erörtert. Im Anschluss werden weitere Prinzipien des internationalen Umweltrechts vorgestellt, die eine Weiterentwicklung und Konkretisierung des Umweltschädigungsverbots darstellen. Zuletzt wird auf das Prinzip der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit in Bezug zu grenzüberschreitenden Umweltschädigungen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einführung
- B) Darstellung der Trail-Smelter-Entscheidungen
- I) Sachverhalt
- II) Entscheidungen
- C) Historische Entwicklung des Umweltvölkerrechts
- I) Die Anfänge bis zur UN-Umweltkonferenz 1972
- II) Von der Konferenz in Stockholm zur Konferenz in Rio de Janeiro
- III) Die Zeit nach dem Erd-Gipfel in Rio de Janeiro
- IV) Zusammenfassung
- D) Die Prinzipien des Umweltvölkerrechts
- I) Das völkerrechtliche Nachbarrecht
- 1) Das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Umweltschädigung
- a) Wichtige Folgeentscheidungen
- aa) Der Lac-Lanoux-Schiedsspruch
- bb) Der Korfu-Kanal-Fall
- b) Tatbestandliche Voraussetzungen
- c) Zusammenfassung
- a) Wichtige Folgeentscheidungen
- 2) Das innerstaatliche Recht des betroffenen Staates
- 3) Unüblichkeit als zusätzliches Merkmal
- 4) Wirtschaftliche, technische und politische Entwicklung
- 1) Das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Umweltschädigung
- II) Weitere Grundsätze
- III) Verfahrenspflichten
- IV) Zusammenfassung
- I) Das völkerrechtliche Nachbarrecht
- E) Völkerrechtliche Verantwortlichkeit für erhebliche grenzüberschreitende Umweltschädigungen
- I) Völkerrechtliche Verantwortlichkeit
- II) Völkerrechtliche Gefährdungshaftung
- III) Rechtsfolgen der Verantwortlichkeit
- IV) Durchsetzbarkeit völkerrechtlicher Ansprüche
- V) Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Trail-Smelter-Fall und seine Bedeutung für die Entwicklung des internationalen Umweltrechts. Ziel ist es, die Entwicklung von bilateralen Abkommen hin zu völkergewohnheitsrechtlichen Prinzipien aufzuzeigen und zu analysieren, welchen Einfluss der Fall auf die Entwicklung des Völkerrechts hatte.
- Die Bedeutung des Trail-Smelter-Falls für das völkerrechtliche Nachbarrecht
- Die Entstehung des Verbots erheblicher grenzüberschreitender Umweltschädigung
- Die Entwicklung des Umweltvölkerrechts von den Anfängen bis zur Gegenwart
- Die wichtigsten Prinzipien des Umweltvölkerrechts
- Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit für grenzüberschreitende Umweltschädigungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einführung stellt den Trail-Smelter-Fall in den Kontext der souveränen Gleichheit der Staaten und erklärt die Problematik der grenzüberschreitenden Immissionen.
- Kapitel B beschreibt den Sachverhalt des Trail-Smelter-Falls und die Entscheidungen des Schiedsgerichts.
- Kapitel C beleuchtet die historische Entwicklung des internationalen Umweltrechts von den Anfängen bis zur Gegenwart.
- Kapitel D befasst sich mit den Prinzipien des Umweltvölkerrechts, insbesondere mit dem Verbot erheblicher grenzüberschreitender Umweltschädigung und weiteren Grundsätzen.
- Kapitel E analysiert die völkerrechtliche Verantwortlichkeit für grenzüberschreitende Umweltschädigungen.
Schlüsselwörter
Trail-Smelter-Fall, Umweltvölkerrecht, grenzüberschreitende Umweltschädigung, Nachbarrecht, Verantwortlichkeit, souveräne Gleichheit, völkerrechtliche Prinzipien, internationale Umweltpolitik, Umweltschutz, internationale Abkommen.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Trail-Smelter-Fall?
Ein klassischer völkerrechtlicher Streitfall zwischen den USA und Kanada, bei dem es um grenzüberschreitende Luftverschmutzung durch eine kanadische Schmelzhütte ging.
Welches wichtige Prinzip entstand aus der Trail-Smelter-Entscheidung?
Das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Umweltschädigung. Ein Staat darf sein Territorium nicht so nutzen, dass einem anderen Staat erheblicher Schaden entsteht.
Wie hängen souveräne Gleichheit und Umweltschutz zusammen?
Jeder Staat ist souverän, darf aber durch seine Handlungen nicht die territoriale Integrität anderer Staaten verletzen, was im Umweltrecht durch das Nachbarrecht konkretisiert wird.
Was sind die Meilensteine des modernen Umweltvölkerrechts?
Wichtige Etappen sind die UN-Umweltkonferenzen in Stockholm (1972) und Rio de Janeiro (1992), die völkerrechtliche Prinzipien weiterentwickelt haben.
Was versteht man unter völkerrechtlicher Gefährdungshaftung?
Es ist die Haftung für Schäden, die aus rechtmäßigen, aber gefährlichen Aktivitäten resultieren, wobei der Staat für die Folgen grenzüberschreitender Schäden verantwortlich gemacht werden kann.
- Citar trabajo
- LL.B. Marcus Fellert (Autor), 2012, Der Trail-Smelter-Fall und die Folgen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201873