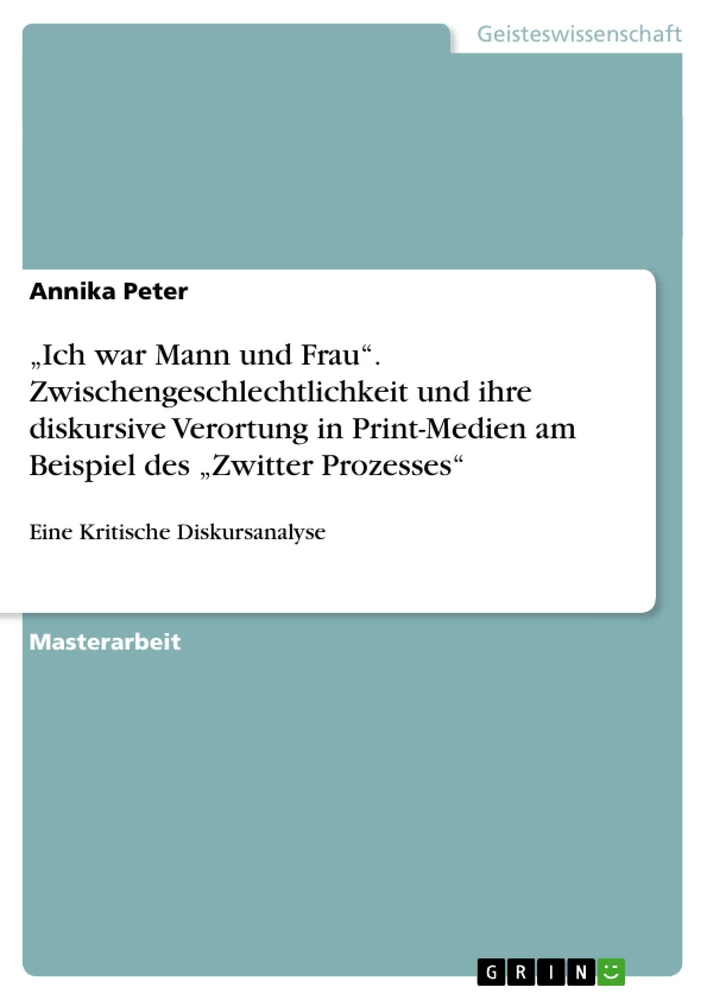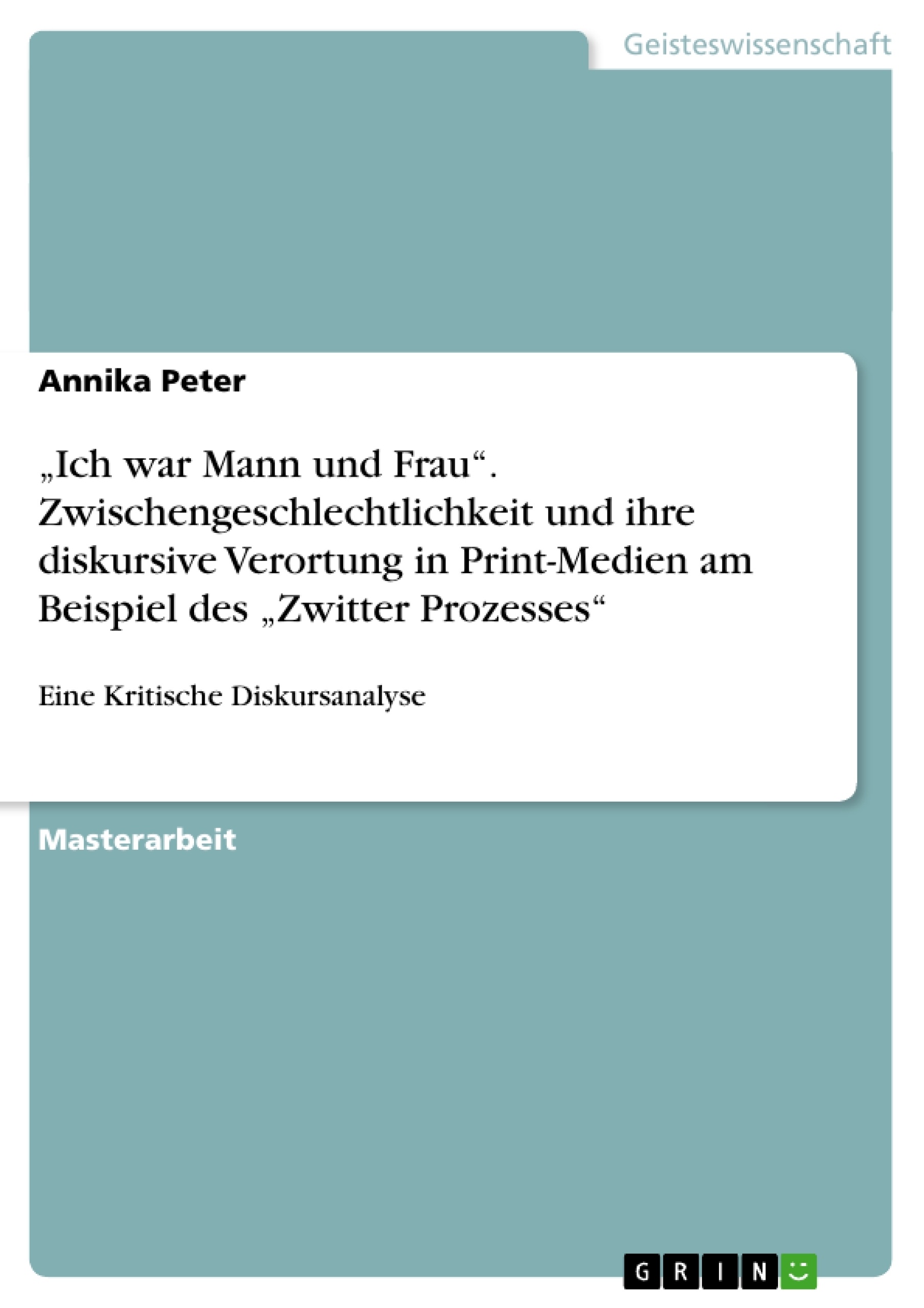„Ich war Mann und Frau“. Der Buchtitel von Christiane Völlings 2010 erschienener Erzählung ihrer Version einer intersexuellen Lebensrealität mag in manchen gesellschaftlichen und auch akademischen Kontexten Verwirrung stiften. Mann und Frau zugleich? In einem System, dass auf der Trennung von Geschlechtern in genau zwei Kategorien, nämlich weiblich und männlich, beruht, scheint weder die Vorstellungsmöglichkeit noch der Platz für Menschen zu sein, die eine Position als weder das eine oder das andere, ein sowohl als auch oder ein „dazwischen“ beziehen. Die unmittelbare Frage, die sich daran anschließen lässt ist diese: Wie kommt es, dass, obwohl uns in Gesellschaft und häufig auch der in Wissenschaft vermittelt wird, dass es nur zwei streng voneinander getrennte Geschlechter gibt, es dennoch einen (nicht geringen) Teil von Menschen gibt, die sich in dieses Schema nicht einordnen können oder wollen?
Es ist genau diese Uneindeutigkeit, die verwischte Grenze zwischen den Geschlechtern, die eine kritische Hinterfragung dessen provozieren, was Menschen für „natürlich“ und „normal“ halten; eine Hinterfragung der Schemata, an denen sich Individuen in ihrem Leben orientieren. Menschen, die sich nicht eindeutig in das Schema weiblich/männlich einpassen lassen, erzeugen nicht nur Verwirrung, Unsicherheit, sondern auch wissenschaftliches Interesse, indem sie eine herrschende Geschlechterordnung stören. Die Einteilung in ein System, dass nur Mann und Frau kennt, hat eine lange und gewaltsame Geschichte, die von Ab- und Ausgrenzungen gekennzeichnet ist und lässt sich, weder in Wissenschaft noch in Gesellschaft, einfach erklären und aufbrechen. Die Trennung der Geschlechter zwischen Mann und Frau beruht dabei oftmals auf biologisch beweisbaren „Tatsachen“, die in den Genen, Chromosomen, in den Hormonen oder etwa im Gehirn auf eine deutliche Unterscheidung der zwei Geschlechter belegen.
Die Rolle der Medien im Fokus von Geschlecht lässt sich kritisch dahingehend hinterfragen, welches Wissen von Geschlecht jenseits eines Zwei-Geschlechter-Systems zugänglich gemacht wird, welche Theorien und Ansätze Eingang in einen öffentlichen Diskurs finden, die zusammen mit wissenschaftlichen Forschungen das prägen, was wir uns unter Geschlecht vorstellen. Vorstellungen von Geschlecht beziehen sich dabei häufig auf eine Vorstellung dessen, was „natürlich“ ist.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
1.Einleitung
2. Zwischengeschlechtlichkeit im Spannungsfeld eines Zwei-Geschlechter-System
2.1. Diskurse in einem Zwei-Geschlechter System
2.2. Zur Medikalisierung und Pathologisierung von Zwischengeschlechtlichkeit
2.3. Zwischengeschlechtlichkeit in aktuellen theoretischen Ansätzen
2.4. Ein Paradigmenwechsel? Ausblicke und aktuelle Debatten
2.5. Zwischenfazit
3. Siegfried Jägers Kritische Diskursanalyse
3.1. Diskursbegriff
3.2. Methoden und Ziele der Kritischen Diskursanalyse
4. Praktische Anwendung der Kritischen Diskursanalyse
4.1. Materialaufbereitung
4.2. Der SPIEGEL: „Und Gott schuf das dritte Geschlecht“
4.3. Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: „Das verordnete Geschlecht“
4.4. Die TAZ: „Jede Bluse eine Mondlandung“
5. Gesamtanalyse
6. Resümee und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Modernes Spiel mit den Geschlechterrollen
Abb.2: Geschlechtliche Uneindeutigkeiten: Hermaphroditos und C. Völling
1. Einleitung
„Ich war Mann und Frau“. Der Buchtitel von Christiane Völlings 2010 erschienener Erzählung ihrer Version einer intersexuellen Lebensrealität mag in manchen gesellschaftlichen und auch akademischen Kontexten Verwirrung stiften. Mann und Frau zugleich? In einem System, dass auf der Trennung von Geschlechtern in genau zwei Kategorien, nämlich weiblich und männlich, beruht, scheint weder die Vorstellungsmöglichkeit noch der Platz für Menschen zu sein, die eine Position als weder das eine oder das andere, ein sowohl als auch oder ein „dazwischen“ beziehen. Die unmittelbare Frage, die sich daran anschließen lässt ist diese: Wie kommt es, dass, obwohl uns in Gesellschaft und häufig auch der in Wissenschaft vermittelt wird, dass es nur zwei streng voneinander getrennte Geschlechter gibt, es dennoch einen (nicht geringen) Teil von Menschen gibt, die sich in dieses Schema nicht einordnen können oder wollen?
Es ist genau diese Uneindeutigkeit, die verwischte Grenze zwischen den Geschlechtern, die eine kritische Hinterfragung dessen provozieren, was Menschen für „natürlich“ und „normal“ halten; eine Hinterfragung der Schemata, an denen sich Individuen in ihrem Leben orientieren. Menschen, die sich nicht eindeutig in das Schema weiblich/männlich einpassen lassen, erzeugen nicht nur Verwirrung, Unsicherheit, sondern auch wissenschaftliches Interesse, indem sie eine herrschende Geschlechterordnung stören. Die Einteilung in ein System, dass nur Mann und Frau kennt, hat eine lange und gewaltsame Geschichte, die von Ab- und Ausgrenzungen gekennzeichnet ist und lässt sich, weder in Wissenschaft noch in Gesellschaft, einfach erklären und aufbrechen. Die Trennung der Geschlechter zwischen Mann und Frau beruht dabei oftmals auf biologisch beweisbaren „Tatsachen“, die in den Genen, Chromosomen, in den Hormonen oder etwa im Gehirn auf eine deutliche Unterscheidung der zwei Geschlechter belegen. Auch wenn einige biologische Diskurse durchaus auch auf die Gleichheit bzw. Ähnlichkeit zwischen den beiden Geschlechtern hinweisen[1] , dominieren Diskurse, die die Unterschiede zwischen Männern und Frauen herausstellen. Das Interesse an der Erforschung von belegbaren Unterschieden zwischen Männern und Frauen ist dabei nicht nur rein wissenschaftlich begründet, sondern zeigt sich auch in der derzeitigen Konjunktur von „Wissensmagazinen“, die sich genau dieser Unterscheidung widmen, wie auch T. Maier in einer Studie zu Geschlecht in Wissensmagazinen herausstellt. Das „Wissen“ aus unterschiedlichen Forschungsfeldern, zumeist der Biologie und der Medizin, wird so einem breiten Publikum zugänglich gemacht. „Somit kommt den populärwissenschaftlichen Medien eine wichtige Rolle bei der Transformation von natur-, sozial-, und geisteswissenschaftlichem Wissen zu. Das betrifft auch das Wissen über Geschlecht“ (Maier 128). Die Rolle der Medien im Fokus von Geschlecht lässt sich also auch kritisch dahingehend hinterfragen, welches Wissen von Geschlecht jenseits zugänglich gemacht wird, welche Theorien und Ansätze Eingang in einen öffentlichen Diskurs finden, die zusammen mit wissenschaftlichen Forschungen das prägen, was wir uns unter Geschlecht vorstellen. Vorstellungen von Geschlecht beziehen sich dabei häufig auf eine Vorstellung dessen, was „natürlich“ ist- und in welchem Bereich könnte das Wissen über die „Natur des Menschen“ besser vermittelt werden als in den Wissenschaften?
Die sozialwissenschaftlich geprägten Gender Studies[2] etwa widmen sich aber genau jener Hinterfragung dessen, was als „normal“ und „natürlich“ angesehen wird und grenzen sich damit von einer essentialistischen und naturalisierenden Auffassung ab, die von einem faktischen Wissen ausgeht. In den Gender Studies steht ein konstruktivistischer Ansatz im Vordergrund, der vielmehr danach fragt wie und warum Formen von definitivem Wissen über Geschlecht entstehen konnten und wie sich diese Auffassungen in einem bestimmten Kulturkreis verorten lassen. U. Beers konzipiert Geschlecht beispielsweise als „Strukturkategorie“: Geschlecht gilt bei ihr als eine Ursache für soziale Ungleichheit, das heißt, die Kategorie Geschlecht fungiert in Gesellschaften als eine Art „Platzverweiser“, die sich über eine asymmetrische Machtverteilung äußert. Geschlecht ist dabei allerdings kontextabhängig zu betrachten und muss in Relation zu anderen Ungleichheitskategorien gesetzt werden, wie es beispielsweise auch beim Konzept der Intersektionalität[3] der Fall ist, um die strukturierenden Effekte soziale konstruierter Kategorien analysieren zu können. Die theoretische Basis dieses Konzept interpretiert nicht nur Geschlecht, sondern auch (konstruierte) Kategorien wie Ethnizität, Sexualität, Klasse, Religion, Alter usw., als strukturierende gesellschaftliche Elemente, die mit einer Zuweisung und Organisation spezifischer sozialer Ressourcen und Positionen verbunden sind. Eine solche Perspektive ermöglicht es, „[…] die historische Konstitution geschlechtsbezogener Herrschaftsverhältnisse zu analysieren“ (Kahlert 38). Neben der Fassung von Geschlecht als Strukturkategorie lässt sich im Diskurs der Geschlechterforschung auch eine Perspektive auf Geschlecht als „Prozesskategorie“ finden (vgl. Carol Hagemann-White z.B. 1988), die Geschlecht als soziale Konstruktion betrachtet und „[…] die in alltäglichen Interaktionen des doing gender[4] immer wieder als unreflektierter Zuschreibungsprozess reproduziert wird“ (ebd.). Gemein ist diesen Konzepten, dass sich sowohl die „Natürlichkeit“ als auch die „Wahrheit“ gesellschaftlicher Auffassungen über Geschlecht (und deren Verknüpfung mit anderen Ungleichheitskategorien) kritisch hinterfragen und somit auch Raum für eine Offenlegung der Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit geben, der vor allem im Rahmen dieser Arbeit durch den Fokus auf Zwischengeschlechtlichkeit bedeutsam ist. Das Interesse einer Aufrechterhaltung eines Zwei-Geschlechter-Systems sowie die Fortführung eines Geschlechterdiskurses, der sich auf die Natürlichkeit der Kategorien Mann und Frau beruft, ist in diesem Kontext vor allem durch die Beibehaltung existierender Machtstrukturen begründet und geht mit der Negierung von anderen möglichen identitätsstiftenden Kategorien einher. Macht kann in diesem Kontext allerdings nicht losgelöst von Wissen betrachtet werden, sie sind, in Anknüpfung an Foucault, untrennbar miteinander verbunden. Interessant ist für diese Arbeit durch den spezifischen Fokus auf print-mediale Wissensdiskurse um Zwischengeschlechtlichkeit also, welches Wissen innerhalb des Diskurses der Zwischengeschlechtlichkeit vermittelt wird sowie die Art und Weise, in der Macht- und Hierarchieverhältnisse verifiziert oder aber auch durchbrochen werden.
Methodische Vorgehensweise und Gegenstand
Gegenstand dieser Arbeit sind sowohl soziale als auch wissenschaftliche Diskurse über Zwischengeschlechtlichkeit und ihr Aufgriff durch massenmediale Texte am Beispiel der Berichterstattung zu Christiane Völlings Schmerzensgeldprozess, der im Jahr 2007[5] begann. Basis für die Analyse der in der Presse aufgegriffenen Diskurse bildet Siegfried Jägers Kritische Diskursanalyse, die aufgrund ihrer praxisorientierten Vorgehensweise und der starken Betonung einer gesellschaftlichen Vermittlung von Diskursen und den in ihnen enthaltenen Positionen als geeignetes Werkzeug gesehen wird, um Zugang zu der öffentliche Verhandlung von Zwischengeschlechtlichkeit zu erlangen. Der Begriff „Zwischengeschlechtlichkeit“ wurde in dieser Arbeit bewusst gewählt, um ihn von dem medizinisch geprägten Begriff „Intersexualität“ abzugrenzen und somit gleichzeitig auf die starke gesellschaftliche Komponente des Begriffs zu verweisen, die geschlechtliche Uneindeutigkeit aus dem Zugriff der Medizin löst. Laut medizinischer Definition bezeichnet Zwischengeschlechtlichkeit, oder in diesem Fall konkret Intersexualität „ […] diejenigen Erscheinungsformen, bei denen biologische Geschlechtsmerkmale (v.a. Chromosomen, Gonaden, äußere und innere Geschlechtsmerkmale) voneinander abweichen“ (Richter-Appelt 241), also nicht als eindeutig männlich oder weiblich benannt werden können. Die Geschlechtszuweisung nach der Geburt eines zwischengeschlechtlichen Kindes erfolgt allerdings vornehmlich durch Beurteilung und Klassifizierung der äußeren, sprich: der unmittelbar sichtbaren Genitalien. Da jedoch nicht nur biologische „Tatsachen“, sondern vielmehr auch soziale Komponenten in die Betrachtung von Zwischengeschlechtlichkeit mit einfließen, wird hier von einer rein medizinisch-biologischen Betrachtung und die mit ihr einhergehenden Begrifflichkeiten abgesehen.
Die Erklärungsansätze für Zweigeschlechtlichkeit und Zwischengeschlechtlichkeit, welche dieser Arbeit zugrunde liegen, beziehen sich auf einen westlich-industriellen Kulturkreis. Dass sich in anderen Kulturräumen Geschlechtszugehörigkeit und Systeme geschlechtlicher Einordnung durchaus anders darstellen lassen, haben bereits ethnologische und anthropologische Forschungen[6] aufgezeigt. Die Möglichkeit divergierender kultureller Betrachtungsweisen soll in dieser Arbeit aber nicht von vorrangigem Interesse sein, da vor allem die Hinwendung zu einem deutschen Kulturraum (unter Rückbezug auf Forschungen aus dem U.S. amerikanischen Kontext) als zentraler (Wissens-) Rahmen für diese Arbeit ausschlaggebend ist. Zentral für die Betrachtung von Zwischengeschlechtlichkeit als auch für ein dimorphes Geschlechtersystem aus einer akademischen Perspektive heraus sind die Erklärungsansätze aus Sozialwissenschaftlichen Bereichen wie den Gender-Studies und den Queer-Studies, aber auch die in einem Naturwissenschaftlichen Bereich verhafteten Disziplinen der Biologie, der Medizin sowie der Psychologie. Dabei sind die aufgeführten Bereiche nicht immer strikt voneinander zu trennen, sondern vielmehr durch komplexe Verknüpfungen und Bezüge gekennzeichnet.
Da diese Arbeit in dem Bereich der Gender-Studies verortet ist, bedarf es, um einen theoretischen Bezugspunkt bilden zu können und um gleichzeitig die dieser Arbeit vorangehenden Ansätze sichtbar zu machen eine Klärung dessen, was sich eigentlich unter dem Begriff „Geschlecht“ fassen lässt: Woran lässt sich Geschlecht festmachen? Wodurch wird Geschlecht bedingt? Diese Fragen sind für alle genannten Disziplinen von Bedeutung, obgleich sich der jeweilige Impetus der einzelnen Forschungsfelder stark voneinander unterscheidet. In unserem Kulturkreis erscheint die unmittelbare Antwort auf die Frage hin, wie viele Geschlechter es bei der menschlichen Spezies gibt, einfach: Zwei. Mann und Frau. Dass die Vorstellung von einem Zwei-Geschlechter-Modell, wie es heute bekannt ist, nicht immer so gegeben war, zeigt eine historisierte Betrachtung von Geschlecht in einem situationsbedingten Kontext. Die Resultate einer Fokussierung auf die Erforschung der „Natur“ des Menschen, die seit der Aufklärung immer mehr an Bedeutung gewann und die sich in verschiedenen Disziplinen niederschlug, war maßgeblich von einer Trennung der Geschlechter in „Mann“ und „Frau“ bestimmt, wobei die „Natur“ in zwei differente Erscheinungsweisen aufgespaltet wurde, welche eine Ungleichbehandlung der Geschlechter nach sich zog (Becker-Schmidt 19). Auch wenn dieses produzierte Wissen nicht ohne Widersprüche bleibt, welche die Leerstellen in der Subjektkonstruktion der Geschlechter aufzeigen und einen Ansatzpunkt bieten, um die aus einer solchen Differenz heraus entstehenden Ungleichverhältnisse sichtbar und vor allem angreifbar zu machen. Der historische Zusammenhang von Wissen, Macht und antifeministischen Strömungen ist vielfach von Wissenschaftler*innen analysiert und hinterfragt worden[7] . Diese und Andere Forschungen aus dem Bereich der Frauenforschung zur Entstehung einer „Natürlichkeit“ der Geschlechter, aus der auch das moderne Verständnis von Zwischengeschlechtlichkeit resultiert, zeigen die negative „Anthropologie des Weiblichen“ (Becker-Schmidt 29), die sich zwar im Laufe der Zeit abgemildert hat, jedoch bis heute auf die „natürliche“ Differenz zwischen Frauen und Männern einwirkt (ebd.) und boten zunächst auch einen Ansatz für feministische Forschungen. Die Konzentration der feministischen Forschungen sowie die Anstrengungen feministischer Bewegungen ab den 1960er Jahren, die darauf zielten, die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern anzugreifen, liefen vor allem auf die Frage hinaus, wie gesellschaftliche Differenzen und hierarchische Verhältnisse zwischen „den Geschlechtern“ gemacht werden. Dieser Fokus basierte allerdings auf einer zweigeschlechtlichen Vorstellung von Geschlecht, die eine biologische Unterscheidung voraussetzt und gleichzeitig verfestigt. Während sich feministische Forschungen sowie aktive feministische Bewegungen in ihren Anfängen also vor allem auf die soziale Konstruiertheit von Geschlecht, d.h. einem sozial geprägten „gender“, dass getrennt zu einem biologischen „sex“ betrachtet wurde, konzentrierten, zielte die Queer Theorie als auch Gender Theorien seit Anfang der 1990er Jahre „[…] auch auf die Überwindung der […] Einteilung von Geschlecht in eine als gesellschaftlich konstruiert erweisbare Geschlechtsidentität gender und ein, als (mit der Geburt) gegeben angenommenes, biologisches Geschlecht sex.“ (Voß 13). Die starre Trennung zwischen einem biologischen Körper und einer sozialen Realität wird nicht nur zu einem Kritikpunkt der Geschlechterforschung, auch die Queer Theorie überwindet diese Schranke. Sie stellt dar, dass sowohl gender als auch sex gesellschaftlich erzeugt werden. „Erst durch Sprache, Diskurse, gesellschaftliche Interpretationen werden Merkmale von Körpern, wird sex, geschlechtlich gedeutet […]“ (Voß in Bezug auf J.Butler 14), so dass auch medizinisch-biologische Theorien über Geschlecht im Hinblick auf die dominante Geschlechterordnung in den Fokus rücken. Weiterführend ist das Interesse an Zwischengeschlechtlichkeit nicht bloß wissenschaftlich begründet: Medien und Politik etwa rekurrieren ebenso auf ein bestimmtes Geschlechterwissen, dass oftmals an wissenschaftliche Forschungen gekoppelt ist, an, können das diskursiv erzeugte Wissen aber auch restrukturieren und umgestalten.
Im zweiten Kapitel meiner Abschlussarbeit werde ich zunächst auf die wissenschaftlichen Diskurse eingehen, die Zwischengeschlechtlichkeit in den Fokus ihrer Forschungen rücken. Zwischengeschlechtlichkeit gerät dabei, so meine Hypothese, in das Spannungsfeld eines Zwei-Geschlechter-Systems und wird durch eine Ausgrenzung aus diesem beispielsweise in medizinischen Wissenschaften sowie der daraus folgenden Medizin-praktischen Behandlung zum Einen pathologisiert und zum Anderen an eine geschlechtliche Norm angepasst. Das Phänomen Zwischengeschlechtlichkeit wird aber andererseits auch in der Geschlechter- sowie der Queer-Forschung genutzt, um die Brüchigkeit eines Zwei-Geschlechter-Systems aufzuzeigen. Das Interesse an einer Erforschung von Zwischengeschlechtlichkeit ist also äußerst vielfältig gestaltet und wird im akademischen Kontext herangezogen, um die jeweiligen eigenen Stanpunkte zu unterstützen. Da ich mich in meiner Arbeit vor allem mit öffentlichen medialen Diskursen um Zwischengeschlechtlichkeit am Beispiel des Präzedenzfalls Christiane Völlings beschäftige, werden in diesem Teil auch ein möglicher Paradigmenwechsel durch politische Interventionen in Aussicht gestellt, der nicht auf einer Vereinnahmung[8] zwischengeschlechtlicher Menschen beruht, sondern eben diese in den Vordergrund stellt und somit die aktuelle Forschung als auch die (medizinische) Praxis entscheidend beeinflusst.
Das dritte Kapitel der Arbeit widmet sich der praktischen Analyse von öffentlichen Diskursen über Zwischengeschlechtlichkeit in einem print-medialen Kontext unter Zuhilfenahme von Siegfried Jägers Kritischer Diskursanalyse, deren Methode und Begrifflichkeiten in einem ersten Schritt näher erläutert werden um diese weitergehend an einem konkreten Beispiel, den Gerichtsprozess Christiane Völlings, zu analysieren. Ab 2007 war der „Zwitter Prozess“, in dem Völling den Chirurgen, der ihr mit 17 statt des Blinddarms ihre Geschlechtsorgane ohne ihr Einverständnis entnahm, Fokus des öffentlichen Interesses an Zwischengeschlechtlichkeit in Deutschland, der nicht zuletzt durch die Bemühungen und Demonstrationen zwischengeschlechtlicher Initiativen mediale Aufmerksamkeit erzielte. Völlings Zwangsoperation wird seitdem als Beispiel für die menschenunwürdige Behandlungsweise von Seiten der Medizin herangezogen. In meiner These, welche die Untersuchung der öffentlichen Verhandlung von Zwischengeschlechtlichkeit am Beispiel des „Zwitter Prozesses“ begleitet, gehe ich von der Annahme aus, dass das in den Print-Medien verhandelte „Wissen“ einen Zwischengeschlechtlichkeitsdiskurs produziert und reproduziert; daher stehen die konkret beschreib- bzw. interpretierbaren Diskurse im Mittelpunkt. Mit Hilfe der Kritischen Diskursanalyse nach S. Jäger werde ich die vermittelten Diskurse in dem vierten Kapitel dieser Arbeit einer detaillierten Analyse herausstellen, aber auch danach fragen, wo sich blinde Flecken auffinden lassen, was nicht gefragt wird und welche Auswirkungen dies auf aktuelle Diskurse hat- denn auch das Nicht-Gesagte, das Verschwiegene stellt einen ebenso wichtigen Teil der Diskurse da wie konkret gemachte Aussagen und Positionen.
Anmerkungen zur geschlechtssensiblen Sprache
In der vorliegenden Arbeiten werden Diskurse analysiert, in denen die Sprache über und das Denken von Räumen, die außerhalb einer zweigeschlechtlichen Norm liegen, einen großen Platz einnimmt. Daher ist es an dieser Stelle angebracht, auch die verwendete Sprache zu reflektieren, um einer diskriminierenden Schreib- bzw. Sprechweise entgegenzuwirken. In dieser Arbeit wird darauf verzichtet, Vornamen zu benennen[9] , da diese oftmals geschlechtlich geprägt sind und (vor allem im Bereich der Wissenschaften) geschlechtliche Konnotationen enthalten können, die das Geschlecht und nicht die Arbeit der betreffenden Person in den Vordergrund stellen. Da das Geschlecht irrelevant für die hier erörterten Perspektiven ist, jedoch unbewusst geschlechtsspezifische Rückbezüge fördern kann, wird bei der Nennung der zitierten Personen nur die Initialen des Vornamens verwendet. Weiterhin stellte sich mir nicht zuletzt durch das Studium der Gender Studies, sondern auch persönlich die Frage nach einer Möglichkeit, eine „männlich“ geprägte Schreib- und Sprechweise zu durchbrechen, in der hegemoniale Diskurse um Geschlecht mitgetragen werden, ohne auf allzu sperrige Alternativen zurückgreifen zu müssen. Nach einiger Überlegung habe ich mich gegen eine durchgängig weibliche Schreibweise entschieden, da diese zwar eine andere geschlechtliche Positionierung in den Vordergrund stellt, jedoch auch durch Abgrenzungen gekennzeichnet ist. Daher werde ich fortwährend in dieser Arbeit eine Schreibweise anwenden, welche versucht, verschiedene geschlechtliche Positionierungen zu berücksichtigen. Konkret bedeutet das: statt etwa von Wissenschaftlerinnen oder WissenschftlerInnen zu schreiben, werde ich die Schreibweise Wissenschaftler*innen verwenden. Das „*“ soll hierbei auf geschlechtliche Positionen verweisen, die weder weiblich noch männlich sind und auf die Lücke sowie die blinden Flecken der deutschen Sprache und die durch sie vermittelten Diskurse aufmerksam machen, welche durch eine einseitige geschlechtliche Form unerkannt bzw. unbenannt bleiben würden.
2. Zwischengeschlechtlichkeit im Spannungsfeld eines Zwei-Geschlechter-System
Zwischengeschlechtlichkeit als Diskurs ist auf vielschichtige und komplexe Art und Weise in wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskursebenen[10] eingebettet. Diese Diskursebenen bilden ein sehr heterogenes Ensemble an Wissenskonstruktionen über Zwischengeschlechtlichkeit: sozialwissenschaftliche, medizinische, philosophische, biologische, psychologische und rechtliche Diskurse wirken auf wissenschaftlicher bzw. akademischer Ebene als konstituierende Disziplinen auf die Produktion und Reproduktion der Wahrnehmung von Zwischengeschlechtlichkeit ein. Dabei sind die unterschiedlichen Disziplinen nur analytisch zu trennen, auch bzw. besonders im Fokus auf Zwischengeschlechtlichkeit sind die verschiedenen wissenschaftlichen Diskurse eng miteinander verwoben. Die aktuelle Auseinandersetzung mit Zwischengeschlechtlichkeit ist in verschiedenen, konflikthaften Diskursen begründet (Lang 12), so dass es an dieser Stelle notwendig ist, die verschiedenen Diskurse aufzuschlüsseln, um Positionen sichtbar und verständlich zu machen und um in einem nächsten Schritt die vergegenwärtigten Diskurse als Basis für eine praktische Analyse zu nutzen.
2.1. Diskurse in einem Zwei-Geschlechter System
Die Brisanz einer Zwischengeschlechts-Forschung sowie die Verhandlung von Zwischengeschlechtlichkeit in einer (medialen) Öffentlichkeit erklären sich vor allem durch ihre Abweichung zu einer zweigeschlechtlichen Norm. Die Präsenz von etwas „Uneindeutigem“, von Menschen, die sich nicht so recht in dieses Bild der Eindeutigkeiten einfügen lassen, scheint (zumindest in einem westlichen Kulturkreis) großes Verunsicherungspotential zu besitzen, da sie nicht nur wissenschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Annahmen darüber, was Geschlecht ist bzw. wie es einzuordnen ist, verwerfen. Wird ein Zwei-Geschlechter-System mit zwischengeschlechtlicher Lebensrealität konfrontiert, so bringt dieses das System zum Wanken. Es ist daher notwendig, sich zu vergegenwärtigen, dass ein solches System immer auf einer Norm basiert, die sich durch die Abgrenzung von allem, was von dieser Norm abweicht, auszeichnet. Dass diese Norm nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wissenschaftlich tief verwurzelt ist und die Annahmen über Zwischengeschlechtlichkeit prägen und geprägt haben, zeigen beispielsweise sozialwissenschaftliche Studien wie S.J. Kesslers The Medical Construction of Gender, in der Kessler die Auswirkungen, die ein binär geprägtes System der Zweigeschlechtlichkeit auf die Medizin und die daraus resultierenden Behandlungsstrategien und Pathologisierung zwischengeschlechtlicher Menschen hatte und immer noch hat, verdeutlicht (vgl. auch Klöppel: 37). Das Problem, das aus einer binären Konstruktion von Geschlecht entsteht, besteht also nicht nur darin, dass Zwischengeschlechtlichkeit zu etwas Undenkbarem wird, da es innerhalb dieser Norm keinen Raum gibt, diese zu denken sondern auch darin, dass diese abgrenzend zu einer binären Strukturierung von Geschlecht gefasst wird. Weiterhin kennzeichnet sich ein an binäre Kategorien angepasste Auffassung von Geschlecht durch eine wertende Komponente, „Geschlechtliche Norm und Abweichung sind […] keine neutralen Definitionen, die wertfrei den Durchschnitt und das Seltene bezeichnen würden, sondern sie sind asymmetrische Kategorien, die unterschiedliche Positionen in einer sozialen Hierarchie anweisen und mit machtvollen Praktiken verknüpft sind, die Druck und Zwang zur Konformität mit der Norm ausüben“ (Klöppel 37). Normen stellen hier ein kritisches Element in einem hierarchischen sozialen Gefüge dar, so dass diese nicht als unhinterfragbare Wahrheiten gelten können, sondern im Gegenteil „geschaffen“, konstruiert wurden. Der von Klöppel angesprochene Zwang zur Konformität bietet auch einen Erklärungsansatz für die Indikation und die Behandlung von Zwischengeschlechtlichkeit in einem medizinischen Kontext, so dass zunächst diejenigen Strukturen, aber vor allem auch die Entstehung eines bestimmten Wissens um Zwischengeschlechtlichkeit im Bereich der Medizin und die daraus resultierenden Konsequenzen für andere Wissensbereiche skizziert werden.
2.2.Zur Medikalisierung und Pathologisierung von Zwischengeschlechtlichkeit
Der medizinische Diskurs trägt einen entscheidenden Anteil am Umgang und der Behandlung zwischengeschlechtlicher Menschen: weil sich geschlechtliche „Uneindeutigkeit“ scheinbar am bzw. im Körper festmachen lässt und auf eine Definition von körperlicher „Normalität“ rekurriert, befindet sich ein zwischengeschlechtlicher Körper nicht zuletzt durch institutionalisierte Krankenhausgeburten und die Erfordernis einer ärztlichen Betreuung vor und nach der Geburt eines Kindes im Zugriff der Medizin (vgl. Preves 533). Eine Herausbildung von Zwischengeschlechtlichkeit als „Krankheit“, also als Abweichung von einem „gesunden“ Normalzustand, lässt sich unter Rückgriff auf medizinisch-biologische Forschungen zur Kategorisierung von bestimmten Körpermerkmalen präzisieren[11] , denn nur durch eine Einteilung in strikt voneinander getrennte Kategorien bzw. eindeutigen geschlechtlichen Körpermerkmalen lässt sich ein Zweigeschlechtliches System etablieren. Dies lässt sich auf einen historischen Prozess der Medikalisierung zurückführen. Medikalisierung beschreibt in diesem Kontext „[…] dass Bereiche des Umgang mit dem Körper, die bis dahin[12] dem oder der einzelnen überlassen waren, durch die professionelle Medizin übernommen werden“ (Kolip 10). Die Medikalisierung des menschlichen Körpers und seiner natürlichen Vorgänge waren und sind durch einen umfassenden Definitions- und Behandlungsanspruch gekennzeichnet. Menschliche Körper und ihre Körperprozesse werden aus einer medizinischen Perspektive heraus betrachtet, pathologisiert und anschließend durch medizinische Techniken „behandelt“ (vgl. ebd.). P. Kolip verdeutlicht diesen Prozess der Medikalisierung und der daraus entstehenden Pathologisierung am Beispiel weiblicher Umbruchphasen, jedoch lässt sich die Bedeutsamkeit dieser Vorgänge auch auf das „Phänomen“ Zwischengeschlechtlichkeit übertragen und anwenden, als dass Kolip zeigt, dass sie auf einer asymmetrischen Zuweisung der Kategorien von Gesundheit und Krankheit verweisen und durch verschiedene zusammenhängende Aspekte gekennzeichnet sind, nämlich die der Normierung, Pathologisierung und Regulierung (ebd. 18), die auch auf eine medizinische Forschung im Bereich der Zwischengeschlechtlichkeitsforschung zutreffen. Die Setzung einer medizinischen Norm ist dabei „[…] ein zentrales Element medizinischen Handelns. Körperliche Erscheinungen und Entwicklungsprozesse werden dabei in zwei Varianten normiert“ (ebd.). Die erste Variante stellt sich durch die Ermittlung eines statistischen Durchschnitts dar, auf deren Basis eine zu erreichende Norm dargestellt wird. Im Fall von Zweigeschlechtlichkeit bezieht sich eine statistische Normierung eines Säuglings auf die sichtbare Größe seiner Genitalien, anhand derer eine Geschlechtszuweisung, aber vor allem auch eine erste Entscheidung über geschlechtsanpassende Eingriffe getroffen wird. Wie wird aber diese Normgröße bestimmt? Dr. P. Donohue[13] et. Al. etwa befanden auf der Basis einer Studie von 100 Neugeborenen Jungen, bei denen die Penislänge von 2,9 bis zu 4,5 Zentimeter reichte, dass ein weniger als 1,5 Zentimeter langer und 0,7 cm breiter Penis dazu führt, das Kind dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen (vgl. auch Fausto-Sterling 57). Obwohl sich die Größe der Genitalien im Verlaufe der kindlichen und pubertären Entwicklung weiterhin verändern kann, werden derartige Maßstäbe oft als normative Basis herangezogen, die eine Geschlechtsanpassung legitimieren sollen. Eine andere Argumentation, die sich auf die Normierung eines Körpers beruft, ist nach Kolip das Risikofaktorenmodell, auf dessen Basis eine (wie auch immer ermittelte) medizinische Gefährdung des Individuums diagnostiziert wird und eine dementsprechende Behandlung als notwendig erscheinen lässt. Das auch medizinische Begründungen für operative Eingriffe nicht auf gegebenen Wahrheiten basieren, sondern, wie bereits angedeutet, auch gesellschaftlich durch eine bestimmte geschlechtliche Auffassung geprägt sind, arbeiten etwa A. Fausto-Sterling und S. Kessler in ihren Arbeiten zur medizinischen Normierung zwischengeschlechtlicher Körper heraus. Fausto-Sterling argumentiert in Sexing the Body: Gender Politics And The Construction of Sexuality, dass beispielsweise die meisten zwischengeschlechtlich geborenen, aber dem männlichen Geschlecht zugewiesene Kinder unfruchtbar sind; es zählt bei der Begründung für geschlechtszuweisende Eingriffe eher, wie der Penis in sozialer Interaktion funktioniert- ob er „richtig“ aussieht (für andere Jungen), ob er „zufriedenstellend[14] “ beim Geschlechtsverkehr funktioniert. „It is not what the sex organ does for the body to which it is attached that defines the body as male. It is what it does vis-à-vis to other bodies“ (Fausto-Sterling 58), so dass das Geschlecht in Relation zu seiner gesellschaftlichen Funktion, weniger jedoch in Relation zu einem individuellen Empfinden von Geschlechtlichkeit ausgelegt und behandelt wird. An dieser Stelle wird die Verknüpfung verschiedener Diskurse- hier einem medizinischen und einem sozialen- deutlich. Obgleich die Mehrheit zwischengeschlechtlich geborener Kinder keine medizinischen Interventionen benötigt[15] , wird die Mehrheit einem eindeutigem Geschlecht zugewiesen, chirurgisch „korrigiert“ und hormonell behandelt, um ihre Variation zu „korrigieren“ (vgl. Preves 2002 524). Nach Preves et. Al werden operative Geschlechtszuweisungen an Kindern vor allem dadurch gerechtfertigt, dass sie als „abnormal“ und „abweichend“ gegenüber einer Norm aufgegriffen werden. Einige Theorien über Zwischengeschlechtlichkeit lassen sich daher in ein weiteres Feld der biologischen Auffassung von Differenz einordnen und zwar insofern, als dass sie darauf begründet sind, Unterschiedlichkeiten herauszuarbeiten und all jenes, das sich nicht eindeutig in ein bestimmtes System einordnen lässt, ausschließen. In einem Zeitalter, das in politischer Hinsicht für individuelle Rechte auf der Basis von Gleichheit argumentiert, definieren Wissenschaftler manche Körper als besser und somit auch als „rechtlicher“ als andere (Fausto-Sterling 39). Bevor aber auf die tatsächlichen rechtlichen Konsequenzen, die sich auf der Basis einiger biologischer und medizinischer Kategorien begründen, eingegangen werden kann, sind zunächst weitere Komponenten von Relevanz, die zu einem Ausschluss von Zwischengeschlechtlichkeit aus einem wissenschaftlichen und einem damit verknüpften gesellschaftlichen System von Zweigeschlechtlichkeit führen.
Hermaphroditismus, Intersexualität oder DSD?
Die Begrifflichkeiten, mit denen Zwischengeschlechtlichkeit und ihre verschiedenen Ausprägungen und Formen beschrieben werden, bieten einen weiteren Anhaltspunkt für ihre Pathologisierung. Dass diese Begrifflichkeiten nicht einer bloßen biologischen Bestimmung entspringen, sondern durchaus kulturell gewertet werden, lässt sich damit erklären, dass Zwischengeschlechtlichkeit als Abweichung von einer Norm gewertet wird. Die wichtigsten Terminologien, mit der zwischengeschlechtliche Menschen kategorisiert werden, sind Hermaphrodit, Intersexualität und jüngst auch DSD, Disorders of Sex Development bzw. auf Deutsch , Störungen der Geschlechtsentwicklung. Der Versuch einer Durchsetzung dieser Begrifflichkeit im deutschen Sprachraum geht vor allem auf die 2007 veröffentlichen Ausarbeitungen Olaf Hiorts zurück, einem der führenden Spezialisten für „Intersexualität“ in Deutschland. In seinem Artikel „Störungen der Geschlechtsentwicklung“ geht er neben dem aktuellen Forschungsstand auch auf die Ergebnisse einer Konsensuskonferenz aus dem Jahr 2005 ein, bei der die endokrinologischen Fachgesellschaften ESPE und LWPES[16] versuchten, eine neue Klassifikation für Zwischengeschlechtlichkeit herauszuarbeiten; Ziel dieser Konferenz war es, die bisher genutzten Begrifflichkeiten abzulösen, da diese von Erwachsenen zwischengeschlechtlichen Menschen, aber auch von Angehörigen und Fachkollegen „[…] als wenig medizinisch informativ und häufig eher als diskriminierend kritisiert […]“ ( Hiort et al. 2007 1573) wurden. Dabei kritisiert Hiort, dass die Klassifikationen „Hermaphroditismus“, „Zwitter“ und „Intersexualität“ nicht korrekt seien und keine Diagnose bieten würden. Jedoch fasst der Begriff Zwischengeschlechtlichkeit als pathologisch, als Krankheit auf: nämlich als Störung. Die neue DSD Terminologie tendiert zudem dazu, den Bereich von Intersexualität auf Individuen mit einer eindeutigen Pathologie des Reproduktionssystems einzuengen und verschleiert dadurch die vielschichtigen und komplexen Bezüge, indem er nur die physische Komponente als Variation von einer Norm fasst, jedoch nicht alltägliche soziale und psychische Auswirkungen zu berücksichtigen versteht und wird von vielen Seiten abgelehnt[17] . Doch auch unter zwischengeschlechtlichen Menschen selbst lässt sich kein Konsens finden, welche Bezeichnung am Ehesten zutreffen bzw. angemessen sein würde; diese beruhen allein auf einer individuellen Selbstbestimmung, so dass es schwierig bleibt, über Zwischengeschlechtlichkeit in einem festgesteckten sprachlichen Rahmen zu sprechen, ohne dabei bestimmte Aspekte zu negieren.
Ein medizinisches Verständnis von Zwischengeschlechtlichkeit basiert nach wie vor auf einem „Heilungsgebot“, dass durch die Pathologisierung und die damit verknüpfte Medikalisierung zurückzuführen ist. Durch die Pathologisierung, die auch rhetorisch wirksam ist, wird auch verhindert, dass eine binäre geschlechtliche Ordnung in Frage gestellt wird: „Indem das Phänomen in den Begriffen von Krankheiten und Fehlentwicklung formuliert wird, bestätigt sich indirekt ´Normalität´, die via ´Heilung´ angeblich zu erreichen sei“ (Engel 27).
Begründungen für operative Zwangseingriffe
Eine entscheidende Kritik der medizinischen Behandlungspraxis vor allem von Seiten zwischengeschlechtlicher Menschen basiert auf den oftmals im frühkindlichen Alter erfolgenden geschlechtszuweisenden Eingriffen[18] - im „Bestfall“ bis zum zweiten Lebensjahr. Nach S. Schmitz (45) sind für die Durchführung solcher Eingriffe vor allem zwei Begründungen ausschlaggebend. Die erste Begründung liegt darin, dass Operationen zu einem frühen Zeitpunkt einfacher durchzuführen seien, „[…] und zweitens sei es für die ´gesunde´ psychische Entwicklung wichtig, spätestens ab dem zweiten Lebensjahr ein eindeutiges körperliches Geschlecht zu haben“ (Schmitz 45). Die zweite Begründung geht vor allem auf die gender Theorie des Mediziners und Psychologen John Money zurück, der bereits in den 1970er Jahren anhand des populär gewordenen John/Joan-Falls[19] zu beweisen versuchte, dass für die Herausbildung einer ´gesunden´(sprich, eindeutigen und heterosexuellen) Geschlechtsidentität und der daraus erwachsenden Geschlechterrolle die Wahrnehmung eines eindeutigen Geschlechtskörpers maßgebend sei. Trotz der längst erfolgten Widerlegung des Falls (Diamond & Sigmundson 1997)[20] orientiert sich die heutige Behandlungspraxis immer noch an John Moneys Modell. Dabei bauen die Empfehlungen für frühstmögliche operative Eingriffe „ […] auf der Annahme auf, dass die ersten beiden Lebensjahre ein Zeitraum sind, in welchem das soziale Umfeld des Kindes durch die Geschlechtszuweisung, Genitalkorrekturen und Erziehung entscheidend auf dessen psychosexuelle Entwicklung einwirken, während die medizinischen Eingriffe ansonsten keinerlei physische und psychische Spuren hinterlassen würden“ (Klöppel 110). Wie Klöppel als auch Ins A Kromminga anhand eines medizinischen Leitfadens zum Umgang mit Zwischengeschlechtlichkeit zeigen[21] , sind diese Behandlungsverfahren auch in Deutschland immer noch präsent und damit relevant für medizinische Interventionen und Eingriffe an Kleinkindern: Sinnecker vertritt hier die Ansicht, dass es von großer Wichtigkeit sei, sich eine tolerante Gesellschaft zu wünschen, in der „Menschen jedweder Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Geschlechtszugehörigkeit und aller ihrer Varianten in gleichem Maße wertgeschätzt werden“ – weitergehend argumentiert Sinnecker allerdings jedoch, dass sich kein Arzt durch Nichtstun der Verantwortung entziehen dürfe. Doch was bedeutet diese Verantwortung der Ärzt*innen? Sinnecker sieht die Verantwortung der Medizin sowie der praktizierenden Ärzt*innen darin liegend, diejenigen zu schützen, die als geschlechtlich uneindeutig gefasst werden- denn es sei, so Sinnecker, „[…] weder in unserer Gesellschaft noch anderswo eine Entwicklung zu dieser Toleranz erkennbar“, weswegen er im selben Atemzug für eine frühzeitige operative „Geschlechtsanpassung“ eintritt ( Kromminga 2005 29). Wie Kromminga festhält, verschärfe solch eine Sicht lediglich die Problematik zwischengeschlechtlicher Menschen, „[…] da sie ein gesamtgesellschaftliches Problem mit komplexen Aspekten auf die persönliche Befindlichkeit eines Individuums reduziert“ (Kromminga, 29). Derartige Behandlungsindikation gehen davon ab, zwischengeschlechtlichen Menschen ein Selbstentscheidungsrecht über eventuelle chirurgische Maßnahmen zu geben, wie es scheint „zum Wohle der Gesellschaft“ und argumentieren aus einer stark heteronormativ geprägten Perspektive heraus, die eine Abweichung aus dieser sanktioniert. Auch wenn derartige Behandlungsindikationen immer noch maßgebend sind, lassen sich vermehrt Argumente gegen derartige Operationen finden (vgl. Richter-Appelt), die dafür plädieren, die geschlechtliche Entwicklung des Kindes nach dem Ende der Pubertät abzuwarten und Individuen selbst so das Recht zur Selbstbestimmung über ihre Körper zugestehen.
[...]
[1] Der Biologe H.J. Voß zeigt in seinem Buch Making Sex Revisited (2010) beispielsweise, dass es schon seit der Antike Modelle gab, welche die Ähnlichkeiten und nicht die Unterschiede zwischen den Geschlechtern betonten.
[2] Auch neuere biologische Forschungen verweisen mittlerweile darauf, dass diese „natürlichen“ Eindeutigkeiten über Geschlecht durchaus hinterfragbar und nicht so definitiv bestimmbar sind, wie es in dominanten Modellen der Fall ist.
[3] Der Begriff der Intersektionalität geht auf die Juristin Kimerley Crenshaw (1989) zurück und wurde vor allem im anglo-amerikanischen Raum in den 1970er Jahren dazu genutzt, um auf die spezifische Ungleichbehandlung schwarzer Frauen auf mehreren sich miteinander verknüpfenden Ebenen aufmerksam zu machen. Das Konzept der Intersektionalität beschreibt vor allem strukturelle Ungleichheiten, die sich nicht nur auf eine Katgeorie wie beispielsweise das Geschlecht zurückführen lassen, sondern individuell variierende Ungleichheitsbehandlungen als miteinander verwoben betrachten. Vgl. hieru auch: Walgenbach, Katharina (2007): Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität. Opladen.
[4] Das Konzept des „doing gender“ geht auf den von Candance West und und Don H.Zimmerman 1987 verfassten Aufsatz „Doing Gender“ zurück. Darin kritisieren sie eine Vorstellung von Geschlecht als „natürlich“, physisch gegeben und stellen die „Machbarkeit“ und die fortwährenede Produktion von Geschlecht in den Vordergrund.
[5] ChristianeVölling, geboren 1959, wuchs als Thomas Völling auf. Bei ihrer Geburt halten die Ärzt*innen sowie ihre Eltern sie für einen Jungen mit Mikropenis und ziehen Völling auch so auf, obwohl sie sich, wie sie in ihrem Buch beschreibt, nie als solcher gefühlt hat. Grund führ dem im Jahr 2007 angelaufenen Prozess war aber vor allem die 1977 durchgeführte Operation an Völling, bei der die Ärzt*innen während einer routinemäßigen Blinddarm-OP herausfanden, dass sie intakte weibliche Geschlechtsorgane, Gebärmutte rund Eierstöcke, besaß, und diese ohne ihr Einverständnis entnahmen. Zudem bekam sie mit der Begründung des „Entartungsrisiko“, also einer Gefährdung durch Krebs, Testosteron verschrieben, mit verheerenden physischen und psychischen Folgen. Das sie zwischengeschlechtlich geboren wurde, fand Völling jedoch erst mit 46 Jahren heraus, nachdem sie Einsicht in ihre Krankenhausakte erlangte. 2009 wurde Christiane Völling schließlich Schmerzensgeld zugesprochen, ein Ausgang mit Signalwirkung, denn ihr Prozess war der erste in Deutschland, der einer breiteren öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und zwischengeschlechtliche Menschen aus ihrem gesellschaftlichen Schattendasein herausholte.
[6] Vgl. Herdt, Gilbert (1996): Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New York, Zone Books; und Thomas, Wesley: “Navajo Cultural Constructions of Gender and Sexuality”. In: Ortner, S.B.; Whitehead, H.: Two-Spirit People: Native American Gender Identity, Sexuality and Spirituality. Cambridge: Cambridge University Press, S. 80-111.
[7] Beispiele hierfür liefern etwa die Studie von F. Hassauer, die am Beispiel Olympe de Gouges im sozialen und politischen Kontext der Französischen Revolution, welche die Notwendigkeit einer historischen Rekurrenz verdeutlicht sowie die Arbeit von K. Hausen, welche den Fokus auf die gesellschaftlichen Umbrüchen in der Zeit der Industrialisierung und der daraus resultierenden Akzentverschiebung hinsichtlich einer Hierarchisierung von Geschlechtern legt; vgl. Becker-Schmidt.
[8] Die Kritik der Vereinnahmung gestaltet sich bei einigen zwischengeschlechtlichen Menschen und Organisationen dergestalt, als dass die theoretische Ansätze in der Medizin, aber auch in der Queer- und Geschlechterforschung aus dem Grund abgelehnt werden, weil diese über zwischengeschlechtliche Menschen forschen, um die jeweiligen Theorien zu belegen, zwischengeschlechtliche Menschen aber selbst kaum eine Chance haben, daran mitzuwirken oder die Forschungen aktiv mit zu gestalten (vgl. Klöppel 34 ff.)
[9] Eine Ausnahme bietet hier lediglich Christiane Völling. Die Nennung ihres Vornamens scheint mir an dieser Stelle angebracht, da sie sich als Frau fühlt und dies auch zum Ausdruck bringt. Des Weiteren kämpft sie für die Anerkennung ihrer Person als weiblich, weswegen dies einen besonderen Stellenwert einnimmt.
[10] Diskursebenen, um eine der von Jäger verwendeten Terminologien bereits im Vorfeld aufzugreifen, meint
[11] Umfassendere Ausarbeitungen zur Medikalisierung von Zwischengeschlechtlichkeit lassen sich etwa bei Voß (2009) als auch Klöppel (2010) finden.
[12] Gemeint ist hier der Zeitraum des ausgehenden 18. Jahrhunderts, ab dem sich Medizin als Profession herausbildete (vgl. Kolip 10).
[13] Vgl. P.Donahue, D.M. Powell, M. M. Lee (1991): Clinical Management of Intersex Abnormalities. In: Current Problems in Surgery, 28, 513-79; sowie S. J. Kessler (2000): Lessons from the Intersexed. New Brunswick.
[14] Die Bewertung dessen, was als zufriedenstellend angesehen wird, bezieht sich dabei nicht auf ein persönliches, individuelles Empfinden von Lust; vielmehr steht die Fähigkeit zu einer (vaginalen) Penetration im Vordergrund.
[15] Obwohl dies auf die Mehrheit zutrifft, gibt es spezielle Formen von Zwischengeschlechtlichkeit, die einer medizinischen Intervention bedürfen. Dies ist etwa der Fall bei AGS, einem Androgenitalen Syndrom, das eine angeborenen Cortisonmangelerscheinung bezeichnet und eine lebenslange Tablettentherapie erfordert. Aufgrund der nicht ausreichenden Produktion von körpereigenem Cortison kommt es zu teilweise lebensgefährlichem Salz-, Wasser- und Zuckerverlust. Auch Christiane Völling wurde mit AGS geboren, das Verschweigen ihrer Situation auf Anraten von Ärzt*innen führte allerdings dazu, dass diese nicht behandelt wurde.
[16] ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) und LWPES (Lawson Wilkins Paediatric Endocrine Society) erforschen hormonelle Störungen bei Kindern.
[17] Vgl. hierzu die Erklärung auf www.intersexuelle-menschen.net, der Internetpräsenz des Vereins Intersexuelle Menschen e.V..
[18] Ich verwende hier bewusst die Mehrzahl „Eingriffe“, denn, anders als es sich vielleicht vermuten lässt, sind für die Herstellung des „richtigen“ Geschlechts eine Vielzahl von Operationen notwendig, um die gewünschten Effekte zu erzielen, nämlich ein eindeutig erkennbares Geschlecht, dass penetrationsfähig ist. Dass dies nicht immer gelingt, stellt auch Christiane Völling ausführlich in ihrem Buch Ich war Mann und Frau. Mein Leben als Intersexuelle dar.
[19] Der John/Joan Fall ist der bis heute bekannteste Fall, anhand dessen Theorien und Wissen über Zwischengeschlechtlichkeit verhandelt wurden und als paradigmatischer Fall in Medien, Medizin .und Intersexuellenbewegungen gilt. Der 1965 in Winnipeg, Kanada geborene David Reimer (zu diesem Zeitpunkt noch Bruce Reimer) und sein Zwillingsbruder Brian wurden als Einjährige aufgrund einer Vorhautverengung operiert. Bei dem Routineeingriff wurde Davids Penis jedoch so stark verbrannt, dass er diesen verlor. Auf Anraten des Sexualwissenschaftler John Money, der zu dieser Zeit vor allem auf das Gebiet der Transsexualitätsforschung spezialisiert war, ließen seine Eltern in fortan als Mädchen aufwachsen- unter der Aufsicht Moneys, der den „glücklichen“ Zufall, dass er in Davids Zwillingsbruder ein Vergleichsobjekt hatte, nutzte, um seine gender Theorie zu verifizieren, die sich darauf stützt, das Geschlecht nicht biologisch, sondern durch die Erziehung bestimmt wird. Mit 22 Monaten wurde Bruce kastriert und fortan als Brenda aufgezogen- ein scheinbarer Beweis dafür, dass sich die geschlechtliche Identität erst ab dem Alter von etwa 2-3 Jahren entwickelt und somit als Beweis geltend gemacht werden sollte, dass eine Geschlechtsidentität konstruiert und anerziehbar sei. Jedoch wurde vor allem durch den von John Colapinto 1997 erschienen Artikels bekannt, dass David Reimers Kindheit sowie Jugend keineswegs so problemlos ablief, wie es Money behauptete. Dennoch wird das unter dem Namen „John/Joan“ bekannte Experiment immer noch in der Fachöffentlichkeit zitiert, um Operationen an zwischengeschlechtlich geborenen Menschen zu rechtfertigen.
[20] Dennoch sind auch Diamonds Thesen zur Geschlechtsentwicklung nicht unumstritten. Seine Theorien werden jedoch häufig von Gegnern von Zwangsoperationen an zwischengeschlechtlichen Menschen als argumentative Basis genutzt, um zu beweisen, dass eine bestimmte Geschlechtsidentität bereits angeboren ist und daher nicht „wegoperiert“ werden kann.
[21] Vgl. A.Wolf (Hg.) (2002): Kinder und Jugendgynäkologie. Atlas und Leitfaden für die Praxis. Schattauer GmbH, Stuttgart, darin vor allem Sinneckers Vorschläge zu Behandlungverfahren im Kapitel „Intersexualität“, S. 171-193.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Zwischengeschlechtlichkeit“?
Der Begriff wird hier genutzt, um geschlechtliche Uneindeutigkeit jenseits der rein medizinischen Diagnose „Intersexualität“ als gesellschaftliches Phänomen zu beschreiben.
Wie wird Intersexualität in den Printmedien dargestellt?
Die Arbeit analysiert Berichte im SPIEGEL, der SZ und der TAZ und untersucht, wie Wissen über Geschlecht jenseits des binären Systems vermittelt wird.
Was ist das Ziel einer Kritischen Diskursanalyse nach Siegfried Jäger?
Sie untersucht, wie durch Sprache Machtverhältnisse und Hierarchien in Bezug auf Geschlechterrollen verifiziert oder durchbrochen werden.
Warum stört Zwischengeschlechtlichkeit die herrschende Geschlechterordnung?
Da unsere Gesellschaft auf einem strikten Zwei-Geschlechter-System beruht, fordern Menschen mit uneindeutigen Merkmalen die Vorstellung von „Natürlichkeit“ heraus.
Was bedeutet „Doing Gender“ im Kontext von Intersexualität?
Es beschreibt den Prozess, durch den Geschlecht in alltäglichen Interaktionen ständig neu konstruiert und zugeschrieben wird.
- Citation du texte
- Annika Peter (Auteur), 2012, „Ich war Mann und Frau“. Zwischengeschlechtlichkeit und ihre diskursive Verortung in Print-Medien am Beispiel des „Zwitter Prozesses“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202047