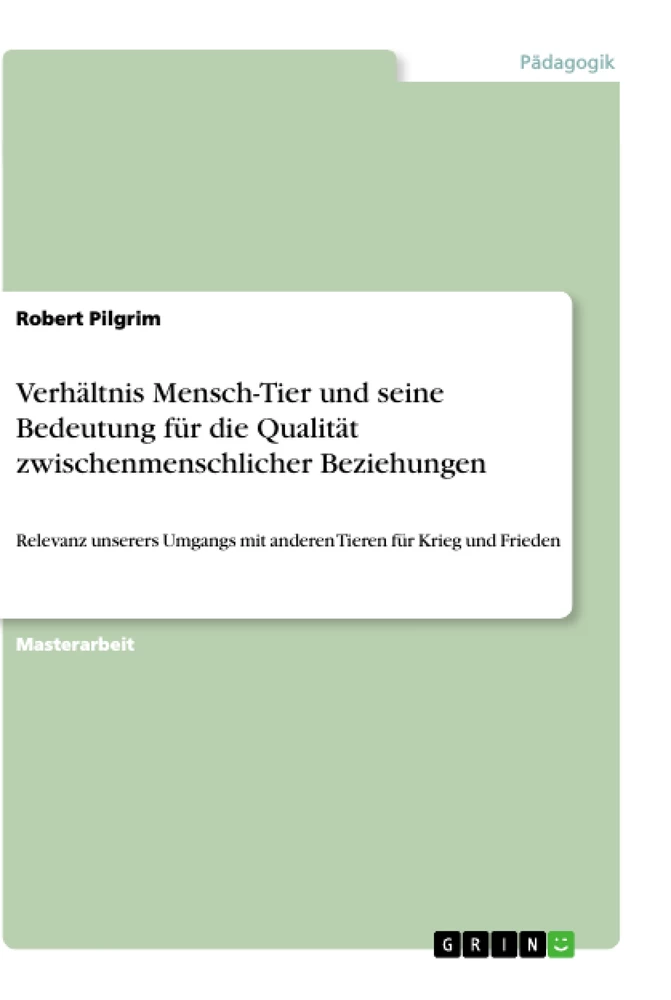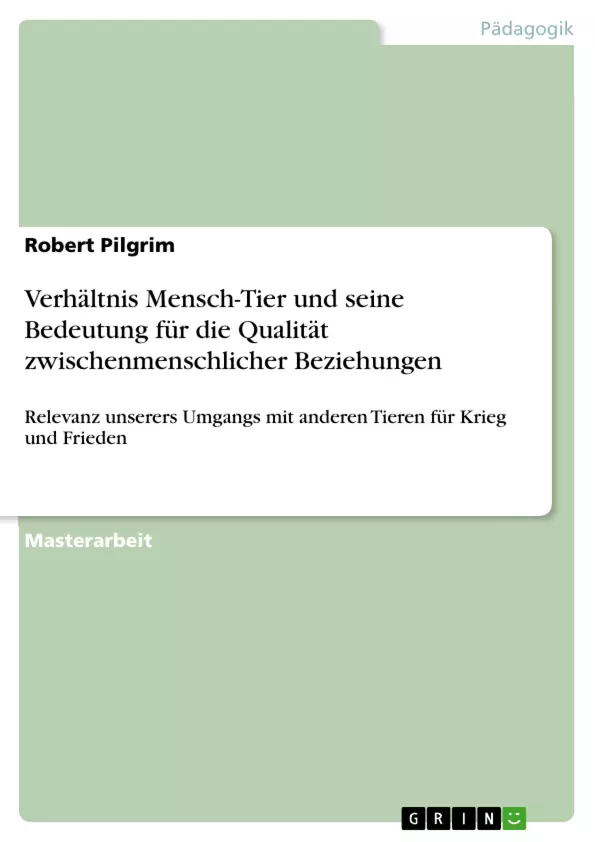Das Verhältnis zwischen Menschen und anderen Tieren hat zahlreiche Facetten, ist so alt wie der
Mensch selbst und hat Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen.
Eine strenge Hierarchie lässt den Menschen als legitimen Herrscher erscheinen und tradiert dieses
Verhältnis zumeist unhinterfragt; es wird im Rahmen der Sozialisation u.a. auch durch Sprache fest
in unseren Köpfen verankert.
Als gewaltsames Herrschaftsverhältnis bietet das Verhältnis zwischen Menschen und anderen
Tieren dabei Gewalt als ein legitimes Handlungsmittel an, welches zwar nicht auf Menschen
übertragen werden soll, dessen bloße Existenz aber Modellcharakter für zwischenmenschliches
Handeln haben kann. Ebenso haben friedliche Beziehungen zwischen Menschen zu anderen Tieren
Modellcharakter: Studien belegen, dass friedlicher, respektvoller Umgang mit nicht-menschlichen
Tieren die Empathiefähigkeit von Menschen fördert, was sich positiv auf deren Umgang mit
anderen Menschen auswirkt.
Viele Intellektuelle wie z. B. Immanuel Kant und Albert Einstein haben sich seit der Antike mit dem
Verhältnis zwischen Menschen und anderen Tieren und dessen Einfluss auf den Menschen
beschäftigt. Die meisten postulieren dabei ähnliche Zuammenhänge: Während gewaltsame
Behandlung von nicht-menschlichen Tieren den Menschen verrohen lasse und seine Hemmschwelle
zur Gewalt gegenüber anderen Menschen herabsenke, befördere der friedliche Umgang mit nichtmenschlichen
Tieren ein friedliches zwischenmenschliches Miteinander.
Eine Interdependenz zwischen der Herrschaft von Menschen über Menschen und von Menschen
über andere Tiere, sowie Analogien von Unterdrückungformen wie Sexismus und Rassismus zu
Speziesismus werden diskutiert.
Derweil belegen neue Erkenntnisse, dass unser Umgang – dabei insbesondere unsere Ernährung
von – mit nicht-menschlichen Tieren und Produkte aus ihnen keineswegs zu unser bestmöglichen
Gesundheit notwendig sind und dass zusätzlich einige höchstgradig kritische Nachteile aus dem
industrialisierten System der Ausbeutung von nicht-menschlichen Tieren erwachsen – und das in
globaler Dimension. Ein inklusiver Friede zwischen Menschen scheint wahrscheinlicher und
erreichbarer, wenn auch zu anderen Tieren ein friedlicher Umgang Konsens wird, da eine nach
Gleichheit für fühlende Lebewesen strebende Gesellschaft eher anders und offener denkt als eine,
die Höher- und Minderwertigkeit nach willkürlichen Kriterien festlegt.
Zahlreiche Gründe sprechen für ein radikales Umdenken im menschlichen Umgang[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Analogien und Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren
3. Begriffliche Unterscheidungen und daraus resultierende Konsequenzen
4. (Schmerz)empfindungsfähigkeit und Emotionen bei nicht-menschlichen Tieren
5. Historische Aspekte des Verhältnisses zwischen Menschen und nicht-menschlichen Tieren
6. Reflexionen über das Verhältnis zwischen Menschen und nicht-menschlichen Tieren und dessen Wirkung auf den Menschen von der Antike bis zur Neuzeit
7. Zusammenhang und Wirkung von friedlichem und von gewalttätigem Umgang mit nicht-menschlichen Tieren auf den Menschen und dessen geistige Entwicklung
8. Globale Auswirkungen vom industrialisierten Herrschaftsverhältnis Mensch-nichtmenschliche Tiere
9. Friedlicher Umgang mit nicht-menschlichen Tieren als Beitrag zu einer inklusiven Friedenserziehung
10. Fazit
11. Literatur- und Quellenverzeichnis
12. Anhang
13. Erklärung
1. Einleitung
Der Mensch nimmt unter allen Tieren eine Sonderrolle ein. Durch die hochentwickelte Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion ist er in der Lage sein Verhalten zu analysieren, zu bewerten, dessen Konsequenzen für andere Lebewesen zu erfassen und in der Folge zu modifizieren, womit eine hohe Verantwortung einhergeht: Handlungen können nicht nur mit unbewussten Instinkten und Intuitionen erklärt werden, sondern sie sind auch Ergebnis bewusster Entscheidungen.[1]
Somit ist der Mensch der entscheidende Gestalter für das Verhältnis zwischen ihm und nicht-menschlichen Tieren. Von dem Verhältnis Mensch-Tier lässt sich allerdings schwerlich sprechen, denn es gibt sehr viele Beziehungen:
Wir lieben und verehren sie,
wir bewundern und fürchten sie,
wir schützen und verwerten sie,
wir verhätscheln und wir quälen sie,
wir vermenschlichen und wir versachlichen sie,
wir helfen ihnen und wir lassen uns von ihnen helfen,
wir erforschen, benutzen, töten und essen sie.
Die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren bieten zahlreiche Gesichter, sind sehr kultur-, sowie speziesspezifisch und wirken oftmals sogar bigott.
Kann diese "Janusköpfigkeit" Einfluss auf die geistige Entwicklung von Menschen nehmen?
Kann eine friedliche und respektvolle Beziehung zu Tieren positive Auswirkungen auf ein zwischenmenschliches Miteinander haben?
Haben gewalttätiger und verständnisloser Umgang mit ihnen negative Folgen für zwischenmenschlichen Umgang?
Und was kann dies für globale Dimensionen bedeuten?
Bis heute erfahren Tiere wissenschaftliche und gesellschaftliche Betrachtung hauptsächlich aus der technisch-ökonomischen Perspektive ihres Nutzens für den Menschen, die einen Blick auf sie als eigenständige Subjekte ausklammert.[2] Ansätze für die Erforschung ihrer Bedeutung für den Menschen und seiner geistigen Entwicklung sind rar, Literatur über Bedeutung vom Umgang mit ihnen für sie stößt auf wenig Beachtung und der Wissenschaftszweig der Human-Animal Studies ist noch eher unbekannt.
Besonders auf Kinder und junge Menschen hat die Umwelt massiven Einfluss, ja prägenden Charakter. Oftmals sind wir dem Weltbild stark verhaftet, das vorherrschte, als wir sozialisiert wurden,[3] wodurch häufig Ansichten tradiert werden ohne dass diese einer kritischen Reflexion unterzogen werden.
Die Gestaltung der Umwelt und der Verhaltensmuster in ihr obliegt jedoch eher der Verantwortung der erwachsenen Gesellschaft. Nicht nur für Pädagogen erwächst daraus eine besondere und extrem wichtige Verantwortung zugunsten der Entwicklung von Kindern: Das Anstreben von friedlichen, also gewaltfreien und transparenten, ehrlichen Bedingungen in allen Lebensbereichen. Dass dies eine Herkulesaufgabe ist, vielleicht sogar polemisch oder naiv klingen mag, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber "radikal", weil bestehenden, ungünstigen Verhältnissen widersprechend, zu denken kann als steter Motor der Entwicklung, des Fortschritts und der Verbesserung von Gesellschaften angesehen werden.
Dass das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nur ein Teil der komplexen Umwelt und deren Wechselwirkung mit der Entwicklung von Menschen ist, ist ebenfalls gänzlich klar. Jedoch herrschen besonders in diesem Lebensbereich bisher recht wenig Interesse, Aufmerksamkeit und Sensibilität, dafür umso mehr Ausblendung vor, was massive Folgen hat, obwohl überaus viele Dichter, Denker, Philosophen und Gelehrte verschiedenster Couleur sich mit der Thematik Mensch-Tier auseinandersetzen und ihr eine hohe Bedeutung beimessen.
„Über die Darstellung emotionaler und ethischer Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung können wir so auch die emotionale Grundhaltung des Menschen gegenüber dem Tier, aber auch gegenüber dem Menschen, in ihrer geschichtlichen Entwicklung plausibel machen.“[4]
Zudem vermögen immer mehr wissenschaftliche Forschungsergebnisse unser Verständnis von Tieren zu erweitern und unseren Blick auf sie zu verändern.
So möchte ich in der vorliegenden Arbeit derartige Forschungsergebnisse und ihre individuellen wie globalen Konsequenzen aufzeigen, mit Thesen zum Verhältnis Mensch-Tier aus der Literatur vergleichen, sowie verbinden und mich per interdisziplinärem Verfahren Antworten auf obige, aufgeworfene Fragen nähern. Dabei sollen die oftmals emotional stark aufgeladene Diskussion über die Behandlung von Tieren,[5] ihre rationalen Ursprünge und etwaige daraus resultierende Wirkungen auf den Menschen so rational wie möglich, kritisch, theoretisch fundiert und unter Einbeziehung philosophischer, sowie ethischer Positionen geführt werden.
Wenngleich der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Bedeutung für zwischenmenschliche Beziehungen, die aus Mensch-Tier-Verhältnissen erwachsen, liegt, kann bei einer solchen Arbeit nicht darauf verzichtet werden, etwaige tierliche[6] Interessen, Bedürfnisse und Perspektiven miteinzubeziehen, sofern keine strenge Anthropozentrik, die in nahezu allen wissenschaftlichen Disziplinen und Lebensbereichen vorherrschend ist, verfolgt wird.
In Anlehnung an Sven Wirth möchte ich betonen, dass sich die vorliegende Analyse des Mensch-Tier-Verhältnisses hauptsächlich auf die deutsche Gesellschaft, die allerdings (nicht nur in dieser Beziehung) eine hohe Repräsentanz für weitere westeuropäische und nordamerikanische Gesellschaften aufweist, bezieht, um nicht ihre diskurspolitische Herkunft zu verschleiern.[7]
Inspiriert von Aiyana Rosen möchte ich festhalten, dass es grundsätzlich problematisch ist objektive Wahrheiten zu generieren. Zwar versuche ich als Wissenschaftler meine eigene Wertung des Dargestellten soweit als möglich außen vor zu lassen, alleine jedoch schon durch die Verwendung von bestimmten Begrifflichkeiten und die Auswahl von Autoren und Quellen kann dies nie vollständig gelingen. In Einleitung und Fazit werden kritische Positionen besonders erkennbar. Als „gefühlter“ Tierrechtler verfüge ich über eine Nähe zum Untersuchungsgegenstand, die ich aber, wie den Untersuchungsgegenstand selbst, kritisch reflektiere.[8]
2. Analogien und Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren
Schon die in der Literatur oftmals vorgenommen Unterscheidung menschliche und nicht-menschliche Tiere weist auf die gemeinsame Geschichte und Ähnlichkeiten von Mensch und Tier hin. Dass das Säugetier Mensch über 98% seiner Gene mit den Schimpansen und gar noch mehr mit den Bonobos teilt ist mittlerweile allgemein bekannt; der Mensch steht in einem ähnlichen Verhältnis zum Schimpansen wie das Pferd zum Zebra[9] . Eine grobe Unterscheidung Mensch-Tier kann (genau wie Aal-Tier bis Zwitscherschrecke-Tier) als wissenschaftlich ungenau betrachtet werden, entspricht vielmehr dem vorherrschenden anthropozentrischen Ansatz und „reproduziert einen Mensch/Tier-Dualismus, der Übergänge und Ähnlichkeiten zwischen Menschen und anderen Tieren unsichtbar macht und biologische Kontinuitäten verschweigt.“[10] Eine sachliche Abgrenzung, wie z. B. Mensch und nicht-menschliche Tiere, die ich im Folgenden verwende,[11] erscheint genauer, taugt dazu, distanzschaffende Effekte nicht weiter zu tradieren und negiert dabei keineswegs die dominante Rolle, die die Spezies Homo Sapiens innerhalb der Welt einnimmt. Ihre überragende Fähigkeit zur Reflexion, in deren Folge sehr komplexe Zusammenhänge erfasst und eigenes Verhalten stark modifiziert werden können, ist unbestritten einzigartig. Eine daraus resultierende Höherwertigkeit, die oftmals das Fundament zum Umgang mit nicht-menschlichen Tieren darstellt, ist von einem objektiv-wissenschaftlichen Standpunkt jedoch nicht haltbar, vielmehr erwächst eine solche eher aus anthropozentrischen, sozialdarwinistisch anmutenden Haltungen, die einer gefährlichen „Es-ist-legitim-weil-ich-es-kann-Mentalität“ entsprechen – für jene gibt es zahlreiche Beispiele in der Geschichte; so veranlasste die gewaltige Überlegenheit der besiedelnden Europäer den nordamerikanischen Indianern gegenüber das Fallenlassen aller gerechten Schranken im Umgang mit ihnen.[12]
Zur objektiv nicht haltbaren Höherwertigkeit der britische Logiker, Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell (1872-1970):
„Es gibt keinen objektiven Grund dafür, die Interessen der Menschen über die der Tiere zu stellen. Wir können Tiere leichter töten, als sie uns töten können; das ist die einzige solide Basis unseres Überlegenheitsanpruchs.“[13]
Tatsächlich scheint es aber heute durch wissenschaftliche Erkenntnisse so, „dass die Sozialfähigkeit von Menschen und anderen Wirbeltieren in sehr ähnlichen, stammesgeschichtlich oft herkunftsgleichen Strukturen und Mechanismen wurzelt.“[14]
Interesse, Furcht, Zorn, Lust, Fürsorge und Spiel als stammesgeschichtlich alte Grundemotionen scheinen von Säugetieren und Vögeln (möglicherweise gar von allen Wirbeltieren) herkunftsgleich geteilt zu werden[15] und das Gehirn, sowie grundlegende Regelmechanismen funktionieren bei „Menschen und anderen[n] Tiere[n] wesentlich gleich“[16] .
„Die Grundstrukturen des Gehirns, die für Bewusstsein notwendig zu sein scheinen, sind zumindest bei allen Wirbeltieren gegeben: […] das Rückenmark, das verlängerte Mark (Medulla oblangata), die Brücke (Pons), das Kleinhirn (Cerebellum), das Mittelhirn (Mesencephalon), das Zwischenhirn (Diencephalon) und das Endhirn (Telencephalon)“.[17] Da bestimmte Hirnteile bei unterschiedlichen Spezies verschiedene Funktionen übernehmen können, kann die Existenz dieser Hirnstrukturen nicht als Beweis, aber als starker Hinweis auf ein Bewusstsein gelten.[18]
Auch die für zwischenmenschliches Miteinander unentbehrliche Empathiefähigkeit lässt sich in gewissem Maße bei anderen Tieren feststellen; so wurden Spiegelneuronensysteme für Säugetiere und Vögel nachgewiesen, wobei bei Vögeln – die über keinen präfrontalen Cortex verfügen – dafür andere Hirnteile zuständig sind, als bei Säugetieren.[19]
Emotionale und motorische Ansteckung können auch über Speziesgrenzen hinweg erfolgen, wie Beispiele von der Übertragung der Angst des Reiters auf das Pferd und der Rettungsaktion einer Gorilladame, die ein ohnmächtiges, in ihr Gehege gefallenes Kleinkind zum Wärtereingang trug, illustrieren.[20]
Generell gibt es sehr viele Ähnlichkeiten bei psychischen und physiologischen Mechanismen zwischen Menschen und anderen Tieren, was u. a. im positive Gefühle evozierenden „Bindungshormon“ Oxytocin ein Beispiel findet.[21]
Ähnlich wie andere Menschen können andere Tiere auf Menschen beruhigende, stressreduzierende und sicherheitbietende Effekte ausüben. In Leistungssituationen wirke alleine die Anwesenheit eines bekannten nicht-menschlichen Tieres ob seiner Wertungsfreiheit beruhigender auf eine Person als ein menschlicher Freund, was durch physiologisch messbare Werte belegt scheint. Der Verlust eines vertrauten nicht-menschlichen Tieres kann hingegen genau so schmerzlich empfunden werden wie der Verlust eines Familienmitglieds, was in Depressionen münden kann. Dies verdeutlicht, welch starke emotionale Bindungen zwischen unterschiedlichen Spezies bestehen können, was auch physiologisch für Hunde nachgewiesen ist.[22]
Allerdings sind nicht alle Beziehungen zwischen Menschen und sogenannten Heim- oder Haustieren Bindungen, obwohl jene menschliche Bindungsbedürfnisse subjektiv erfüllen können; oftmals stehen vielmehr Dominanz- und Prestigebedürfnisse, instrumentelle Nutzung und das Bedürfnis nach Gesellschaft im Vordergrund.[23]
Erkenntnisse aus Studien über Fremdpflege (cross-fostering), bei denen nicht-menschliche Neugeborene unmittelbar nach der Geburt der eigenen Mutter entzogen und einer anderen, artgleichen zur Aufzucht anheim gelegt werden, machen deutlich, dass auch nicht-menschliche Tiere weniger genetisch determiniert sind als oftmals angenommen. Soziale Einflussfaktoren spielen demnach eine große Rolle für die Entwicklung der meisten Tiere, da eher Verhaltensweisen der „falschen“ Mutter übernommen werden, als dass solche der biologischen Mutter gezeigt werden.
Einer der auffälligsten Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren ist der, dass Menschen andere Tiere (wie auch teilweise durch Medien bekannt wird Menschen) halten. Dies trifft auf nahezu alle Kulturen zu und wird selbst in Extremsituationen am Rande des Existenzminimums praktiziert. Dabei reicht das Spektrum der Verhaltensweisen, wie auch unter Menschen, von tiefer Verbindung und hoher Wertschätzung über respektlose Behandlung und Ausbeutung, was einen moralischen Gegensatz, aber keinen Widerspruch darstellt.[24]
Die rechtlichen Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren sind immens. Die einen können schuldhaft handeln und die Bedeutung des eigenen Handelns für andere reflektieren, die anderen nicht. Ihr Verhältnis zueinander bzw. die Rechte und Pflichten von Menschen gegenüber nicht-menschlichen Tieren sind in Deutschland im Tierschutzgesetz geregelt. Dies ist insofern von enormer Bedeutung, als wir spätestens seit den Untersuchungen Lawrence Kohlbergs (1927-1987) zu moralischem Handeln und moralischem Urteil Hinweise darauf haben, dass sich menschliches Handeln eher an juristischen Vorgaben denn an universal-ethischen Wertvorstellungen orientiert.
Der Grundsatz des deutschen Tierschutzgesetzes lautet:
„Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“[25]
Der Gesetzgeber spricht nicht-menschlichen Tieren eindeutig Schmerz- und Leidensfähigkeit zu, leitet eine menschliche Verantwortung ihnen gegenüber ab und möchte ihnen als Mitgeschöpfen, was einerseits religiös, andererseits wenig hierarchisierend anmutend ist, das Wohlbefinden und Leben sichern. Gleichzeitig billigt er jedem Menschen das Recht zu, ihnen Schmerzen, Leiden und Schäden zuzufügen – wenn ein (aus menschlicher Sicht) vernünftiger Grund vorliegt.
Als Laie mag man denken, dass es einen vernünftigen Grund für Schmerzen, Leiden und Schäden nur in Extremsituationen, wie Notwehr und Selbsterhaltung, geben kann. Als Jurist kann man aber den vernünftigen Grund als eine „Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und des Güterabwägungsprinzips“[26] verstehen, der in diesem Fall das „Spannungsverhältnis zwischen dem in § 1 Satz 1 angestrebten (pathozentrischen) Tierschutz auf einem möglichst hohen Niveau und dem in § 1 Satz 2 gewollten Schutz der berechtigten (anthropozentrischen) Nutzungsinteressen des Menschen“[27] durch Abwägung lösen soll. Demnach sei dem Juristen Christoph Maisack zufolge „eine tierbelastende Handlung nur dann dem Begriff 'vernünftiger Grund' zuzuordnen, wenn sie erforderlich und verhältnismäßig ist, d. h. wenn sie sich als die am wenigsten tierbelastende Alternative darstellt und wenn ihr voraussehbarer Nutzen bzw. ihre Chancen für den Menschen deutlich schwerer wiegen als die von ihr ausgehenden Belastungen bzw. Risiken für die Tiere.“[28] Trotz oder gerade wegen vieler Verweise auf ethische Vertretbarkeit lässt das „Tierschutzgesetz“ einen großen Interpretationsrahmen zu und ist praktisch kaum zu realisieren.
Dabei ermöglicht der vernünftige Grund u. a. die massenhafte Tötung von just geschlüpften Küken (da nur die weiblichen Nachkommen zur weiteren Produktion genutzt werden können), die Vergasung von nicht-menschlichen Tieren zur Erzeugung von Pelzprodukten und vieles dergleichen mehr als erforderlich und verhältnismäßig.
Ob unser Umgang mit nicht-menschlichen Tieren eine unumgängliche Notwendigkeit für die erwähnte Selbsterhaltung darstellt soll im weiteren Verlauf der Arbeit geklärt werden.
Es wird deutlich, dass der deutsche Gesetzgeber nur unter ganz bestimmten und sehr seltenen Bedingungen ein vorgegebenes Interesse an der Bewahrung des Wohlbefindens und des Lebens von nicht-menschlichen Tieren hat und sich damit an bestehenden, gesellschaftlichen Wertvorstellungen orientiert. Das „Tierschutzgesetz“ ist daher von enormer Relevanz:
Es bildet einerseits die juristische Legitimation der systematischen Gewalt gegen nicht-menschliche Tiere und es stellt gleichermaßen das Spiegelbild des gesellschaftlichen Umgangs mit ihnen dar.[29] Insofern muss das vorherrschende Verhältnis zwischen Menschen und anderen Tieren als Gewaltherrschaft betrachtet werden.
Während wenige Stimmen das sogenannte Tierrecht[30] philosophisch und gar naturwissenschaftlich zu begründen versuchen,[31] sieht die Realität dergestalt aus, dass jeder Mensch nach eigenem Ermessen Urteile über Leben und Tod von bestimmten nicht-menschlichen Tieren fällt und fällen kann: Der (eigentlich geschützte) Maulwurf der seinem natürlichen Verhalten in einem gestutzten Garten nachgeht hat mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod durch Spaten zu erwarten, wenngleich auch die Chance besteht, dass er als Teil der Natur verstanden und nicht sanktioniert wird. Der unerwünschte Wurf Katzen wird in ländlichen Gegenden noch immer nicht selten ertränkt oder totgeschlagen, wenngleich auch hier die Chance besteht, dass Menschen sich ihrer annehmen und sie fürsorglich pflegen. Die Ratten auf Nahrungssuche müssen nahezu per se mit qualvoller Vergiftung rechnen, durchkreuzen sie menschliches Territorium.
Dennoch lässt sich als essentiell Wichtiges festhalten, dass jedem Lebewesen ein – unerheblich ob bewusstes oder unbewusstes – Interesse„im Laufe seines Lebens möglichst viel Lust und Behagen und wenig Schmerz zu erfahren“[32] eigen sei. „Dies Interesse hat jedes Huhn und Schwein, jeder Hund und Affe genauso wie jeder Mensch. Und im Fall des Interessenkonflikts? Da muss man abwägen, und zwar zwischen konkreten Individuen – quer durch alle Arten hindurch.“[33]
Martin Balluch leitet aus der Forderung nach Grundrechten für Menschen auch jene für andere Tiere ab:
„...wenn jemand Grundrechte für sich fordert, dann fordert er gleichzeitig Grundrechte für alle Wesen mit Bewusstsein. Ist er sich dieses Umstands bewusst, dann fordert er diese Grundrechte für alle Wesen mit Bewusstsein explizit, ansonsten implizit, aber deswegen nicht minder bedeutsam. Wenn jemand Grundrechte nur für sich oder nur für eine Untergruppe von Wesen mit Bewusstsein fordert, z. B. auf der Basis religiöser Dogmen oder persönlicher Präferenzen, dann handelt er irrational.“[34]
Der Mensch ist ein Tier. (Manche) Tiere essen andere Tiere. Während der Mensch sich scheinbar stark von der Natur generell und anderen Tieren im Speziellen abzugrenzen versucht,[35] beruft er sich oftmals auf dieses vermeintliche Naturgesetz, das Recht des Stärkeren, wenn sein Umgang mit nicht-menschlichen Tieren thematisiert wird. In der Tat finden sich in der nicht-menschlichen Natur teils heftiger Mord und Totschlag, während aber Löwe und Krokodil ernährungsphysiologisch auf nicht-pflanzliche Proteine zur Selbsterhaltung angewiesen sind und Kater und Katze ihre teils „quälerischen“ Handlungen gegenüber Beutetieren nicht ermessen können, sind wir Menschen ersteres nicht (s. Kap. 8) und könnten letzteres i. d. R. – je nach Sozialisation – ausgezeichnet.
Trotz oder gerade wegen der gemeinsamen Entwicklungsgeschichte wird eine menschliche Abgrenzung von anderen Tieren verfolgt, die nicht nur Soziologen als Othering bezeichnen, an deren Ende der Skala „idealtypisch eine mit Gleichgültigkeit betriebene gewaltsame Behandlung und Tötung entrechteter 'Anderer' [steht], die Verknüpfung von Differenz, Indifferenz und Gewalt.“[36]
„Die Mensch-Tier-Grenze […] markiert gemeinhin das Ende des Sozialen; sie legitimiert moralische Differenzierungen, die heute unter Menschen gänzlich tabuisiert sind und begründet ein sozial weitgehend gebilligtes System millionenfacher Einsperrung, Verletzung und Tötung. Die prototypische Indifferenz, mit der die Opfer wahrgenommen werden, ist sprichwörtlich („wie ein Tier behandelt werden“) und – in der Unterscheidung von Zonen hie [sic!] des Schutzes der Menschenwürde, dort des Ausschlusses aus dem Kreis der Rechtssubjekte – rechtlich untermauert.“[37]
Obwohl gewisse moralische Differenzierungen auch innerhalb der Spezies Mensch getroffen werden und nicht gänzlich tabuisiert werden, wie u. a. das feierliche Begrüßen des gewaltsamen Ablebens Osama bin Ladens unter Beweis stellte, ist klar was Michael Fischer ausdrücken wollte: Der Umgang von Menschen mit anderen Tieren im Rahmen des industrialisierten Systems ihrer Verwertung wird ausschließlich anhand des Kriteriums gerechtfertigt, dass sie eben jene und keine Menschen sind.
3. Begriffliche Unterscheidungen und daraus resultierende Konsequenzen
Nachdem Analogien und Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren beleuchtet wurden, gilt es nun einen Blick auf unsere Sprache zu werfen, die nämlich jene Kluft wirkungsvoll zu vertiefen vermag.
Viele auf nicht-menschliche Tiere bezogene Begriffe im Sprachgebrauch führen zu einer Entsubjektivierung von diesen und reduzieren sie rein auf die Funktion und den Wert, den sie für die Spezies Mensch haben. Ein Selbstwert wird ihnen damit abgesprochen: „Nutzvieh“ werden jene Tiere genannt, die hauptsächlich in einer Gesellschaft ausgebeutet[38] werden; in der deutschen Gesellschaft (wie in den meisten westeuropäischen und nordamerikanischen Industrienationen) also Hühner, Schweine und Rinder, manchmal auch Pferde.
Während die Vorsilbe „Nutz-“ die nicht-menschlichen Tiere aus anthropozentrischer Sicht funktionalisiert, verbaut der stark abwertend konnotierte Begriff „-vieh“ den Blick auf Individuen. Eben das geschieht, wenn Kühe und Bullen zum „Rindviech“ (vgl. im Engl.: cattle), Hühner und Hähne zum „Geflügel“ (vgl. im Engl.: poultry), Hirsche, Hasen, Wildschweine und viele mehr zum „Wild“ (vgl. im Engl.: game), Laster mit lebenden Schweinen zum „Lebendfleischtransport“ werden.
„Milchkühe“, „Mastsäue“, „Versuchskaninchen“, „Speisefische“ und „Legehennen“ lassen eher einen individuellen Blick zu, reduzieren nicht-menschliche Subjekte aber ebenfalls auf bestimmte Funktionen für den Menschen. Gleichzeitig suggerieren diese Bezeichnungen eben diese Funktionstiere jeweils als factum brutum und nicht als menschengemacht; was es für das jeweilige Tier bedeutet, eine „Mastsau“ oder eine „Legehenne“ zu sein ist irrelevant, sie sind es schlichtweg. „Der Mensch ist funktional nicht definierbar. Doch auch Tiere sind es nur in den Augen und Ordnungssystemen des Menschen.“[39]
Kuh, Sau, Schwein, Rindviech, Ochse und dergleichen mehr – meist mit despektierlichen Adjektiven versehen – gelten als gängige Schimpfwörter und betonen die unterschiedlichen Wertigkeiten von Menschen und anderen Tieren; macht man jemanden „zur Sau“, erniedrigt man ihn. „Solange Artbezeichnungen als Schimpfworte Verwendung finden, wird es schwierig sein, unsere Gefühle der Überlegenheit und Verachtung 'dreckigen' und 'dummen' Nutztieren gegenüber abzubauen.“[40]
Auch Begrifflichkeiten zu potentiell Leid (vgl. Kapitel 4) verursachenden Vorgängen taugen zur Relativierung: Qualvolles Sterben wird zu „Verenden“ oder „Eingehen“, mit großem Unwohlsein einhergehende Zwangspaarung („Vergewaltigung“[41] ) zur „Deckung“, präventives und massenhaftes Totschlagen zur „Keulung“.
Weitere Hinweise auf die enorme Geringschätzung von nicht-menschlichen Tieren und die als legitim wahrgenommene Gewalt gegen sie bieten Phrasen wie „Bluten wie ein Schwein“, „Abstechen wie eine Sau“, „abgeschlachtet“ und „behandelt wie ein Tier“ zur Beschreibung von furchtbaren Taten an oder grausamen Umgang mit Menschen und „Schlächter von...“ als Bezeichnung für Kriegsverbrecher. Was bei Menschen als bestialisch wahrgenommen wird, gilt bei nicht-menschlichen Tieren als historisch normal. Es wird „Empörung über die Behandlung von Menschen durch den bloßen Tiervergleich ausgelöst, während die gewalttätige Behandlung der Tiere nur die Kontrastfolie des Normalfalls bildet.“[42]
Die Soziologin Birgit Mütherich (1959-2011) erkannte in der Abgrenzung des Menschen von nicht-menschlichen Tieren dienenden Begrifflichkeiten einerseits einen Identitätsschutz, andererseits die Verlagerung von negativ empfundenen Ich-Anteilen nach außen, sowie abwertende Implikationen, die der eigenen (menschlichen) Aufwertung dienen.[43]
Auch in der Pädagogik kennen wir das Phänomen der Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung, welches ein modellhaftes Vorbild im Verhältnis zu nicht-menschlichen Tieren haben kann.
Birgit Mütherich betont die enorme Relevanz, die diese begrifflichen Unterscheidungen mit sich bringen, „denn das Medium Sprache ist weltbildbildend und damit weltbildend. Indem sprachliche Kategorien und Verknüpfungen maßgeblich die Art der Wahrnehmung und Beurteilung von Individuen beeinflussen, kollektive Deutungsmuster generieren oder reproduzieren und schließlich – der Reflexion weitgehend entzogen – in gesellschaftliche >>Wahrheiten<< transformiert werden, sind sie konstitutiv für soziale Handlungsorientierungen und -muster.“[44]
Die vorgestellte Auswahl an Begrifflichkeiten und deren Einfluss auf menschliches Handeln zeigen, dass sie einen Einfluss auf die geistige Entwicklung von Menschen und ihrem daraus resultierenden Verhältnis zu nicht-menschlichen Tieren haben muss: Lerne ich von Anfang an, dass bestimmte Lebewesen minderwertig sind, sie nur zu einem bestimmten menschlichen Nutzen existieren und dass meine eigene Spezies in Relation viel höher wiegt und vergleichbare Akte, die bei Menschen als scheußlich und grausam wahrgenommen werden, bei ihnen normal und unbedeutend sind, so prägt sich dies massiv in meinem Weltbild ein und es kostet einen enorm hohen und sehr unbequemen Energieeinsatz, diese übernommenen Konventionen zu revidieren.
So lässt sich z. B. erklären, dass im Frühling 1996 „die Nachricht von wenigen mutmaßlich durch den Verzehr von Rindfleisch erkrankten Creutzfeld-Jakob-Patienten die deutsche Bevölkerung weit mehr [erschreckten] als die mörderische Aussicht, 2.800.000 britische Rinder auf bloßen Verdacht hin zu schlachten und zu verbrennen.“[45] Obwohl Precht hier den nach Sprachkonventionen unzulässigen Begriff „mörderisch“ auf nicht-menschliche Tiere anwendet (sie werden „gekeult“, höchstens „getötet“, aber keinesfalls „ermordet“!), ist klar was er ausdrücken möchte: Eine potentielle, nicht genau untersuchte Gefahr fürs eigene Leben fällt wesentlicher schwerer ins Gewicht, als das gewaltsame Beenden von nahezu 3 Mio. Leben einer anderen Spezies, wobei ersteres letzteres rechtfertigt.
Eine gefährliche Gedankenstruktur lässt sich hierin erkennen, wie auch Albert Schweitzer (1875-1965) befindet: „Im Gefolge dieser Unterscheidung kommt dann die Ansicht auf, dass es wertloses Leben gäbe, dessen Schädigung und Vernichtung nichts auf sich habe. Unter wertlosem Leben werden dann, je nach den Umständen, Arten von Insekten oder primitive Völker verstanden.“[46]
Schon die Begrifflichkeiten zeigen neben dem Umgang mit nicht-menschlichen Tieren, dass gewalttätige Strukturen und Handlungen an sich als erfolgreiche Handlungsstrategien legitimiert werden, wenngleich stets die Prämisse gelehrt wird, diese nicht auf Menschen zu übertragen. Als unter bestimmten Umständen adäquate, mögliche Handlungsalternativen sind sie damit dennoch gesellschaftlich verankert.
Trotz der eingangs postulierten Versachlichung von nicht-menschlichen Tieren durch Sprache scheint Folgendes zu gelten:
„Während sich Menschen gegenseitig zu Objekten degradieren, dehumanisieren und verdinglichen könnten wie z. B. im Rassismus, sei dies bei Tieren unmöglich, 'weil nichtmenschliche Tiere schon von vornherein den Objekt-Status haben/ entmenschlicht sind, d.h. sie müssen erst gar nicht objektiviert werden. Sie sind sozusagen andere Andere – ihre Unterdrückung ist ein Gemeinsinn.'“[47]
Der große Einfluss von Sprache auf unser Denken und Handeln ist kaum zu unterschätzen; er wirkt seit frühester Kindheit und prägt damit sogar gesellschaftliche Haltungen. Dieser Gedanke wird in Kapitel 5 erneut aufgenommen. Zunächst sollen aber entscheidende Aspekte des Wesens von nicht-menschlichen Tieren beleuchtet werden.
4. (Schmerz)empfindungsfähigkeit und Emotionen bei nicht-menschlichen Tieren
Eine wenn, dann hitzig geführte Debatte betrifft die für den Umgang mit Tieren sehr relevante Frage nach der Empfindungs-, und dabei insbesondere die nach der Schmerzempfindungsfähigkeit von Tieren.[48] Bevor technische und wissenschaftliche Errungenschaften physiologisch messbare Erkenntnisse in dieser Hinsicht zuließen, standen hauptsächlich Beobachten und logisches Schlussfolgern zur Verfügung. Dies genügte dem Urvater der Artenlehre für folgende Behauptungen:
"Die niederen Tiere empfinden offenbar wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück. Das Glück gibt sich nirgends besser zu erkennen, als bei jungen Tieren, wie bei jungen Hunden, Katzen, Lämmern usw., wenn sie zusammen spielen, wie unsere eigenen Kinder. Selbst Insekten spielen zusammen, wie jener ausgezeichnete Beobachter P. Huber beschrieben hat, welcher sah, wie Ameisen sich jagten und taten, als wenn sie einander bissen, genau so, als wenn es junge Hunde gewesen wären."[49]
Während das „offenbar“ nicht auf gesichertes Wissen hindeutet, klingt Charles Darwin (1809-1882) an anderer Stelle wesentlich bestimmter:
"Die Tatsache, daß die niederen Tiere durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen werden wie wir, ist so sicher festgestellt, daß es nicht nötig ist, den Leser durch viele Einzelheiten zu ermüden. Der Schreck wirkt auf sie in derselben Weise wie auf uns, er macht ihre Muskeln erzittern, ihr Herz schlagen, die Schließmuskeln erschlaffen und das Haar sich aufrichten[…]Die meisten komplizierten Gemütsbewegungen sind den höheren Tieren und uns gemeinsam."[50]
Ohne Gefahr zu laufen, den Leser tatsächlich zu ermüden, möchte ich doch auf die von Darwin angedeuteten Einzelheiten, die 130 Jahre nach seinem Tod selbstverständlich weitere Bearbeitung, Untersuchungen und Erkenntnisse erfahren haben, eingehen.
Die wissenschaftlich eindeutige Feststellung von Schmerz bei nicht-menschlichen Tieren scheint zunächst kein Selbstgänger zu sein, denn es ist nicht „das objektiv feststellbare Vorliegen einer Gewebeschädigung bzw. deren körperliche Wahrnehmung entscheidend für die Zuschreibung von Schmerz, sondern in letzter Konsequenz gibt den Ausschlag, ob ein Wahrnehmungssubjekt den Zustand seines Körpers als gestört empfindet. “[51] Und eine verbale Schmerzerklärung können Tiere schwerlich leisten. Dennoch gibt es Vorgehensweisen um sich dem Thema zu nähern:
Als Voraussetzung für Schmerzempfinden gelten das Vorhandensein eines nozizeptiven Sinns und eine Wahrnehmungsfähigkeit dessen.[52] Während Thorsten Galerts Dissertation die Frage nach Schmerzfähigkeit bei Wirbellosen ungeklärt lässt, deuten seine Erkenntnisse unter Berücksichtigung aller Zweifel und Skepsis auf eine prinzipielle Schmerzempfindungsfähigkeit bei Wirbeltieren hin, die von Spezies zu Spezies unterschiedlich ausfallen kann und er zeigt zudem auf, wie diese Erkenntnis für spezifische Arten durch experimentelle Vorgehensweise belegt werden kann.[53]
Über die so genannten „Nutztiere“ bestehen zahlreiche solcher Untersuchungen.
Die Diplom-Ingenieurin und Agrarwissenschaftlerin Ute Röbken legt derartige Ergebnisse in ihrer Dissertation vor.[54] Demnach seien u.a. das gängige Schnabelkupieren bei Legehennen, Enthornen bei Rindern und das Kastrieren von Ferkeln (ohne Betäubung, was beispielsweise in Deutschland und Frankreich stark verbreitet ist) „massive Eingriffe am Tier, die mit Schmerzen verbunden sind.“[55] Sven Wirth spricht bei derartigen Eingriffen an nicht-menschlichen Tieren in Anlehnung an Foucault von biopolitischen Eingriffen, die auf Kontrolle von Bevölkerungen, sowie die Lenkung von Kräften und Leben abzielen und eine totale Herrschaft über Individuen symbolisieren.[56]
Viele Haltungsbedingungen evozieren Technopathien und Ethnopathien, also durch Haltung bedingte Krankheiten, Verletzungen und Verhaltensstörungen, sowie Verletzungen infolge dieser Verhaltensabweichungen.[57]
Die Be- und Entladevorgänge bei Tiertransporten seien zudem eine sehr große Belastung für die betroffenen Tiere (u. a. messbar am erhöhten Cortisolspiegel), wobei besonders Elektrotreibstäbe, die dabei eingesetzt werden, immer mit Schmerzen für diese Tiere einhergehen.[58] Die Mortalitätsrate bei Tiertransporten beläuft sich auf 0 bis 1 %. Eine Reduzierung dieser Rate und von Hämatomen bei transportierten Tieren konnte festgestellt werden, wenn die LKW-Fahrer und andere an diesem Prozess beteiligte Arbeiter Prämien für möglichst wenig tote Tiere bzw. Abzüge für Hämatome erhielten, was Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen diesen Arbeitern und diesen Tieren zulässt.[59]
Auch im weiteren Verlauf der Fleischerzeugung sind unangenehme Zustände für die nicht-menschlichen Tiere unvermeidbar. So seien „alle eingesetzten Betäubungsverfahren […] beim Tier mit physiologischen [sic!] Stress verbunden“[60] . Dabei gibt es stets Risiken zur Schmerzverstärkung u. a. durch Fehlbetäubungen, vorzeitige Stromstöße, Einhängen von Vögeln in den Schlachtbügel und „mechanische Belastungen“[61] durchs Personal; laut Röbken werden die verschiedenen Betäubungs- und Tötungsverfahren vom Verbraucher meistens verdrängt[62] , was einen erwähnenswerten Aspekt des Verhältnisses zwischen Menschen und nicht-menschlichen Tieren andeutet. Nach Helga Milz besteht eine permanente Abschottung von „der tierquälerischen Fleisch-, Milch-, Eierproduktion […], um uns die Freude am Heimtier und Lust am Essen nicht zu verderben […].“[63]
Warum aber müssen wir etwas verdrängen, dass nicht nur gemeinhin als legitim gilt, sondern tatsächlich gesetzlich festgeschrieben ist?
Psychologische Verdrängungsmechanismen sind wichtig, ja in manchen Fällen sogar essentiell zum (Über-)Leben. Betrifft dieser Verdrängungsapparat aber veränderbare, kritische Vorgänge und Strukturen (nicht nur im Bereich des Umgangs mit nicht-menschlichen Tieren, sondern auch z. B. in Bezug auf Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Textilien, Kaffee und anderen Produkten, die wir nutzen), ist er dann angemessen, um diese zu ertragen oder unangemessen, weil er sie perpetuiert?
Über das Wirbeltier Fisch halten sich derweil noch immer hartnäckige Annahmen vom empfindungslosen Wesen mit dem 3-Sekunden-Gedächtnis, das allgemein auch eher in Abgrenzung zu anderen „Nutztieren“ gesehen wird (man denke an verschiedene Definitionen des Begriffes Vegetarier, die zum Teil das Konsumieren von Fischen und Fischprodukten mit einschließen).
So stieß die Biologin Victoria Braithwaite auf teils vehemente Anfeindungen als sie in Anlehnung an Jeremy Bentham[64] (1748-1832) die Frage „Do Fish Feel Pain?“ in ihrem gleichnamigen Buch aufwirft. Zur Untersuchung konzipierte sie Experimente mit Fischen, was sie als „ethically and morally challenging“[65] empfand, da diese darauf ausgelegt waren, Schmerzen zu verursachen. Sie fand dabei heraus, dass die Cortisol-Ausschüttung in und nach stressvollen Situationen, sowie die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes bei Fischen große Ähnlichkeiten zu den physiologischen Reaktionen beim Menschen aufweisen und dass das Fischgehirn über einen auf negative und angstbezogene Stimuli spezialisierten Bereich verfügt.[66] Braithwaite präsentiert sogar zahlreiche Experimente, die logisches Denken, Formen des Bewusstseins und einen unserem limbischen System ähnlichen Bereich im Vorderhirn der Fische nahelegen.[67]
[...]
[1] Wenngleich der schottische Philosoph David Hume schon vor über 250 Jahren postulierte, dass moralische Entscheidungen vom Menschen stets intuitiv gefällt und erst im Nachhinein vom Verstand gerechtfertigt und mit den jeweils passenden Argumenten versehen werden und dies durch wissenschaftliche Experimente zunächst bestätigt schien (vgl. dazu: Precht, Richard David: Die Kunst, kein Egoist zu sein. Warum wir gerne gut sein wollen und was uns davon abhält, München 2010, S. 112-117), relativierte der Neuropsychologe Joshua D. Greene diese Ansicht durch weitere wissenschaftliche Experimente an der University of Harvard; ebd. S. 121-125.
[2] Vgl. Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael in: Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009.
[3] Vgl. Balluch, Martin: Die Kontinuität von Bewusstsein. Das naturwissenschaftliche Argument für Tierrechte, Wien/Mülheim a. d. Ruhr 2005, S. 375.
[4] Otterstedt, Carola: Die Mensch-Tier-Beziehung im interkulturellen Vergleich, in: Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009, S. 313.
[5] Vgl. z. B. http://www.antiveganforum.com/wiki/Hauptseite ggü. http://de.veganwiki.org/.
[6] Aufgrund der negativen, abwertenden Konnotation des Begriffes „tierisch“ verwende ich stattdessen den Begriff „tierlich“.
[7] Wirth, Sven: Fragmente einer anthropozentrismus-kritischen Herrschaftsanalytik. Zur Frage der Anwendbarkeit von Foucaults Machtkonzepten für die Kritik der hegemonialen Gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnisse, in: Chimaira-Arbeitskreis für Human-Animal Studies (Hg.): Human-Animal Studies. Über die gesellschaftliche Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen, Bielefeld 2011, S. 43.
[8] Vgl. Rosen, Aiyana: Vom Aufschrei gegen Tierversuche zu Gesellschaftskritik. Zur Bedeutung von Framing-Prozessen in der Tierrechtsbewegung der BRD 1980-1995, in: Chimaira-Arbeitskreis für Human-Animal Studies (Hg.): Human-Animal Studies. Über die gesellschaftliche Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen, Bielefeld 2011, S. 282f.
[9] Sowohl Analogien, als auch Unterschiede zwischen Mensch und Tier sind sehr zahlreich, so kann die hier vorgestellte Auswahl keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
[10] Chimaira-Arbeitskreis: Eine Einführung in Gesellschaftliche Mensch-Tier-Verhältnisse und Human-Animal Studies, in: Chimaira-Arbeitskreis für Human-Animal Studies (Hg.): Human-Animal Studies. Über die gesellschaftliche Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen, Bielefeld 2011, S. 8.
[11] So sind im Folgenden mit den Begriffen nicht-menschliche bzw. andere Tiere alle die Tiere gemeint, die nicht zur Spezies Homo Sapiens gezählt werden, während der Begriff Tiere alle Tiere inkl. der Spezies Homo Sapiens bezeichnet. Wörtliche Zitate werden nicht verändert und sind im Kontext zu verstehen.
[12] Vgl. Clarke, Paul Barry; Linzey, Andrew (Hg.): Das Recht der Tiere in der menschlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort von Tom Regan, London 1990, S. 164.
[13] Russell, Bertrand zitiert nach Clarke/Linzey, S. 129.
[14] Kotrschal, Kurt: Die evolutionäre Theorie der Mensch-Tier-Beziehung, in: Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009, S. 55.
[15] Vgl. ebd., S. 59.
[16] Ebd., S. 55.
[17] Vgl. Balluch, S. 99f.
[18] Vgl. Balluch, S. 101.
[19] Vgl. ebd., S. 59f.
[20] Vgl. Olbrich, Erhard: Bausteine einer Theorie der Mensch-Tier-Beziehung, in: Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009, S. 115f.
[21] Vgl. Beetz, Andrea M.: Psychologie und Physiologie der Bindung zwischen Mensch und Tier, in: Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009, S. 133 und 141f.
[22] Vgl. ebd., S. 145f, S. 148 und die Geschichte des japanischen Hundes Hachikō, der über zehn Jahre auf sein verstorbenes „Herrchen“ wartete.
[23] Vgl. ebd., S. 147.
[24] Vgl. Reichholf, Josef H.: Die Bedeutung der Tiere in der kulturellen Evolution des Menschen, in: Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009, S. 11.
[25] Tierschutzgesetz online/Internetpräsenz des Bundesministeriums der Justiz: http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html#BJNR012770972BJNG000103377.
[26] Maisack, Christoph: Zum Begriff des vernünftigen Grundes im Tierschutzrecht, Diss., Hamburg 2006, S. 389.
[27] Ebd.
[28] Ebd., S. 390.
[29] Wie ernst es der Regierung mit dem Tierschutz ist, zeigt sich u. a. auch daran, dass die jedwedem Tierschutzgedanken zuwider laufende „Massentierhaltung“ äußerst großzügig subventioniert wird. Vgl. hierzu u.a. http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/eine-milliarde-euro-subventionen-pro-jahr-fuer-industrielle-gefluegel-und-schweineproduktion-bund/.
[30] Die Unterschiede zwischen Tierschutz und Tierrecht lassen sich vereinfacht so darstellen: Während ersterer Töten von nicht-menschlichen Tieren „humaner“ gestalten und Käfige bequemer machen will, fordert letzterer gar kein Töten und das Abschaffen von Käfigen.
[31] Vgl. Balluch.
[32] Türcke, Christoph: Mensch und Tier. Reichweite des „Speziesismus“, in: Witt-Stahl, Susann (Hg.): Das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen. Beiträge zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere, Aschaffenburg 2007, S. 165.
[33] Ebd.
[34] Balluch, S. 262f. Dort ist seine Ableitung ausführlicher beschrieben.
[35] Vgl. Bujok, Melanie: Die Somatisierung der Naturbeherrschung. Körpersoziologische Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.): Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006, 2 Bde., Frankfurt am Main 2008, S. 5120.
[36] Fischer, Michael: Differenz, Indifferenz, Gewalt. Die Kategorie „Tier“ als Prototyp sozialer Ausschließung in: Arbeitskreis Junger KriminologInnen (Hg.): Kriminologisches Journal, 33. Jahrgang, Heft 3, Weinheim 2001, S. 170f.
[37] Ebd., S. 171.
[38] Der Begriff „Ausbeutung“ darf hier nicht als polemisch, sondern im Wortsinn verstanden werden.
[39] Precht, Richard David: Noahs Erbe. Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen, Hamburg 1997, S. 20. Der in der vorliegenden Arbeit häufig zitierte Richard David Precht wird zwiespältig rezipiert und oftmals als populärwissenschaftlich angesehen; nach Sichtung der hier zitierten Werke kann ich diesen Eindruck nicht teilen.
[40] Balluch, S. 131.
[41] Balluch, S. 133. Martin Balluch erwähnt an dieser Stelle das Beispiel von weiblichen Schweinen, die besonders wählerisch in Bezug auf ihre Sexualpartner seien und die bei eben diesen „Deckungen“ zur Produktion von Nachkommen festgebunden werden, schreien, sich wehren und anschließend in faktische Depression versinken.
[42] Mütherich, Birgit: Das Fremde und das Eigene, in: Brenner, Andreas (Hg.): Tiere beschreiben, Erlangen 2003, S. 19.
[43] Ebd., S. 17-18.
[44] Ebd., S. 20.
[45] Precht 1997, S. 9. Dieses Phänomen der unterschiedlichen Wertung von Ereignissen, die in keiner Relation zu stehen scheinen, lässt sich bei vielerlei Nachrichtenmeldungen finden. So wird beispielsweise betont, wie bedauerlich es sei, dass ein bestimmter Lebensmittelpreis ansteigt, weil bei einer Flutkatastrophe Ernten vernichtet worden sind, während die dabei getöteten Lebewesen nur eine Randnotiz zu sein scheinen.
[46] Schweitzer, Albert in: Gräßer, Erich (Hg.): Albert Schweitzer. Ehrfurcht vor den Tieren, München 2011, S. 25.
[47] Hoffmann, Arnd: „Ein Königstiger als Vegetarianer“. Zur Kritik an der Utopielosigkeit von Antispeziesismus und Veganismus, in: Witt-Stahl, Susann (Hg.): Das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen. Beiträge zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere, Aschaffenburg 2007, S. 184.
[48] Neben der relevanteren Frage nach der Schmerzempfindungsfähigkeit bei nicht-menschlichen Tieren gibt es mittlerweile auch zahlreiche Hinweise auf ein komplexes, emotionales Innenleben von verschieden Spezies. Vgl. dazu u. a.: http://www.psychologytoday.com/blog/animal-emotions. Beispiele über soziale Kompetenzen, moralische Gefühle und Altruismus bei nicht-menschlichen Tieren lassen sich u. a. bei Martin Balluch finden: Vgl. Balluch, S. 222-231. Pjotr Kropotkin spricht sogar von „Elternliebe in allen Klassen des Tierreichs“; Kropotkin, Pjotr zitiert nach Clarke/Linzey, S. 127.
[49] Darwin, Charles in: Wille, Bruno (Hg.): Darwins Weltanschauung von ihm selbst dargestellt. Geordnet und eingeleitet von Dr. Bruno Wille, Heilbronn 1906, S. 127.
[50] Ebd., S. 128f.
[51] Galert, Thorsten: Vom Schmerz der Tiere. Grundlagenprobleme der Erforschung tierischen Bewußtseins, Paderborn 2005, S. 223.
[52] Vgl. ebd., S. 296-298.
[53] Vgl. ebd., S. 289-298.
[54] Röbken, Ute: Risikoaspekte in der Fleischerzeugung. Ergebnisse einer Expertenbefragung, Diss., Göttingen 2006.
[55] Ebd., S. 53.
[56] Wirth, S. 52.
[57] Vgl. Röbken., S. 52.
[58] Vgl. ebd., S. 57.
[59] Vgl. ebd., S. 61.
[60] Ebd., S. 65.
[61] Ebd., S. 56.
[62] Vgl. ebd., S. 65f.
[63] Milz, Helga: Mensch-Tier-Beziehungen in der Soziologie, in: Otterstedt, Carola und Rosenberger, Michael (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009, S. 250.
[64] Zu Beginn ihrer Arbeit begründet sie ihr Forschungsinteresse unter anderem mit dem vom brit. Philosophen Jeremy Bentham aufgeworfenen Problem: “The question is not can they reason, nor can they talk, but can they suffer?” (The Principles of Morals and Legislation), zitiert nach Braithwaite, Victoria: Do Fish Feel Pain? Oxford 2010, S. 14.
[65] Braithwaite, S. 4f.
[66] Braithwaite, S. 11 und S. 102.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert das Verhältnis zwischen Menschen und nicht-menschlichen Tieren aus verschiedenen Perspektiven, darunter historische, ethische, philosophische und wissenschaftliche.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie: Einleitung, Analogien und Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren, begriffliche Unterscheidungen, Schmerzempfindungsfähigkeit und Emotionen bei nicht-menschlichen Tieren, historische Aspekte des Verhältnisses Mensch-Tier, Reflexionen über dieses Verhältnis von der Antike bis zur Neuzeit, Zusammenhang zwischen friedlichem/gewalttätigem Umgang mit Tieren und dessen Wirkung auf den Menschen, globale Auswirkungen des industrialisierten Herrschaftsverhältnisses Mensch-Tier, friedlicher Umgang mit Tieren als Beitrag zur Friedenserziehung, Fazit, Literatur- und Quellenverzeichnis, Anhang und Erklärung.
Was wird in der Einleitung diskutiert?
Die Einleitung betont die Sonderrolle des Menschen aufgrund seiner Reflexionsfähigkeit und die damit verbundene Verantwortung für sein Verhalten gegenüber Tieren. Es werden die vielfältigen und oft widersprüchlichen Beziehungen zwischen Menschen und Tieren aufgezeigt und Fragen nach den Auswirkungen dieser Beziehungen auf die geistige Entwicklung des Menschen aufgeworfen.
Welche Analogien und Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren werden hervorgehoben?
Das Dokument thematisiert genetische Ähnlichkeiten, grundlegende Emotionen, Gehirnstrukturen und Empathiefähigkeit, die Menschen und viele andere Tiere teilen. Es wird jedoch auch die einzigartige Reflexionsfähigkeit des Menschen und die daraus resultierende Verantwortung betont. Rechtliche Unterschiede und das deutsche Tierschutzgesetz werden ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Wahrnehmung von Tieren?
Das Dokument argumentiert, dass die Sprache eine entscheidende Rolle bei der Entsubjektivierung von Tieren spielt. Begriffe wie "Nutzvieh" reduzieren Tiere auf ihre Funktion für den Menschen und verdecken ihre Individualität. Schimpfwörter, die Tierbezeichnungen verwenden, unterstreichen die unterschiedliche Wertigkeit von Menschen und Tieren.
Was wird über die (Schmerz)empfindungsfähigkeit und Emotionen bei nicht-menschlichen Tieren ausgesagt?
Es wird diskutiert, dass Tiere Schmerzen empfinden können, gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse über Nozizeption und physiologische Reaktionen. Das Schnabelkupieren bei Hühnern, Enthornen bei Rindern und Kastrieren von Ferkeln ohne Betäubung werden als schmerzhafte Eingriffe genannt. Es wird auf Forschungsergebnisse hingewiesen, die nahelegen, dass Fische ebenfalls Schmerzen empfinden und über ein komplexes emotionales Innenleben verfügen.
Was ist die Bedeutung des deutschen Tierschutzgesetzes im Kontext des Verhältnisses Mensch-Tier?
Das Tierschutzgesetz wird als juristische Legitimation der systematischen Gewalt gegen nicht-menschliche Tiere und als Spiegelbild des gesellschaftlichen Umgangs mit ihnen betrachtet. Der "vernünftige Grund" im Gesetz ermöglicht die Zufügung von Schmerzen, Leiden oder Schäden an Tieren, wenn dies aus menschlicher Sicht erforderlich und verhältnismäßig ist.
Welche Auswirkungen hat der Umgang mit Tieren auf die geistige Entwicklung des Menschen?
Das Dokument argumentiert, dass der Umgang mit Tieren, insbesondere in der Kindheit und Jugend, einen prägenden Einfluss auf das Weltbild des Menschen hat. Das Lernen, dass bestimmte Lebewesen minderwertig sind und nur einem menschlichen Nutzen dienen, kann sich massiv auf das Verhältnis zu Tieren auswirken und zu gewalttätigen Strukturen führen.
- Citation du texte
- Robert Pilgrim (Auteur), 2012, Verhältnis Mensch-Tier und seine Bedeutung für die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202145