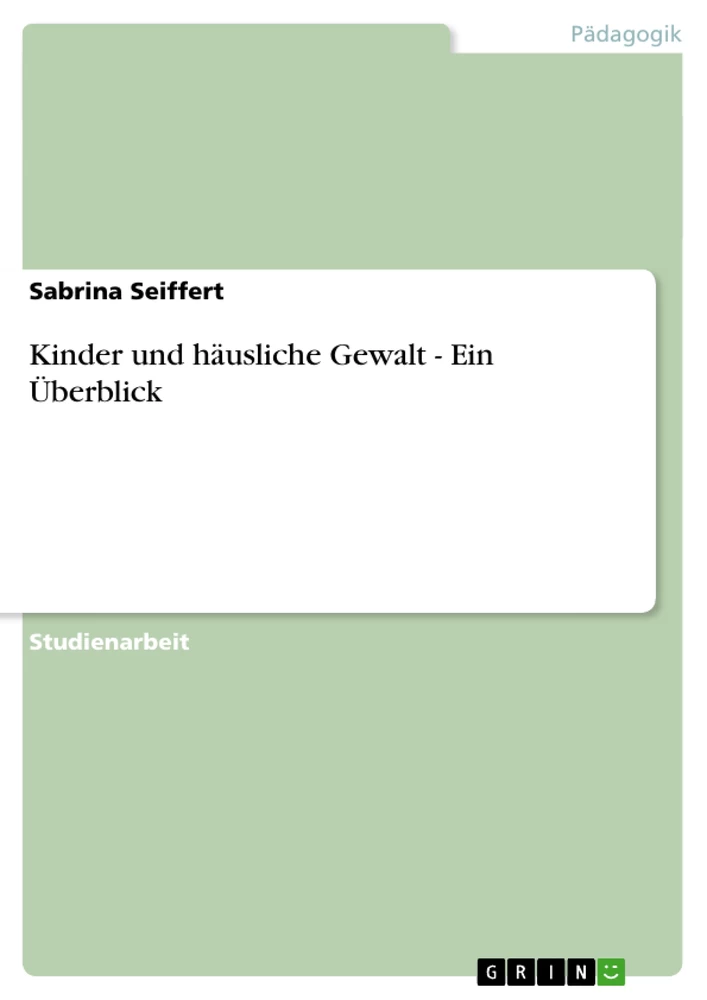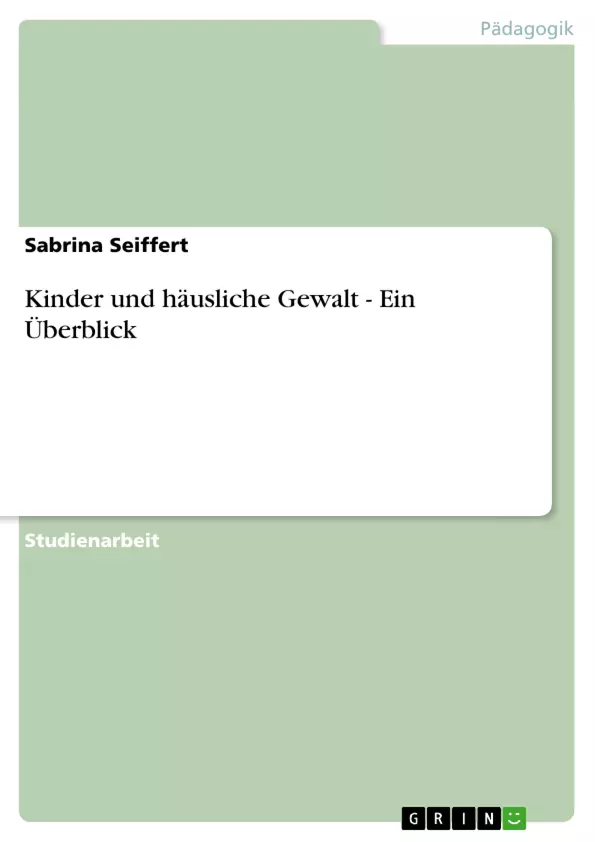Die Familie, in Form von Mutter und Vater, ist die erste und wichtigste soziale Einheit im Leben des Kindes. Hier soll es Schutz, Geborgenheit, Sicherheit und Liebe erhalten. Die Institution Familie bereitet auf das Leben vor, es bildet das erziehungsbedürftige Kind bestenfalls zu einem Ich-starken und selbstbewussten Individuum. Ohne Erziehung der älteren Generation wäre es dem Tode geweiht. Es lernt durch Mutter und Vater als Vorbild, seine eigene Rolle in der Gesellschaft zu finden. Bröckelt diese Institution, so steht die ganze Persönlichkeit des Kindes auf wackeligen Beinen. Wird das Kind Zeuge von häuslicher Gewalt oder gerät es sogar mitten hinein, so verwandelt sich das eigentlich behütende Heim in einen Ort der Angst. Sind solche Zustände nicht nur einmalig, sondern kommen regelmäßig vor, sind die Auswirkungen beträchtlich. Dass dies aber leider der Fall ist, belegt eine repräsentative Studie aus dem Jahr 2004, bei welcher 10.000 Frauen nach ihren Gewalterlebnissen in Partnerschaften befragt wurden. Demnach erlebten 25% von ihnen mindestens einmal Gewalt durch einen männlichen Beziehungspartner, zwei Drittel davon mehr als nur einmal.
50% aller befragten Frauen lebten zu dem Zeitpunkt mit Kindern zusammen und gaben an, die Kinder hätten die Gewaltausbrüche überwiegend
miterlebt. So hatten 57% der Kinder die Gewalt gehört, 50% von ihnen hatte
sie gesehen und 21% gerieten selbst mit hinein.1 10% der Kinder wurden sogar
direkt angegrien. Des Weiteren wird angegeben, dass die Kinder zumeist sehr
lange mit der Gewalt konfrontiert werden, da sie, wenn überhaupt, erst mit
Trennung vom Partner endet. Auch wenn die Misshandlung der Mutter der
häugste Kontext von Kindesmisshandlung ist, soll dies nicht Thema der Arbeit
sein. Ich möchte besonders auf die Auswirkungen solcher Fälle eingehen,
bei denen die Kinder Gewalt gegen die Mutter miterlebten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffserklärung
2.1 Häusliche Gewalt
2.2 Physische Gewalt
2.3 Psychische Gewalt
2.4 Sexualisierte Gewalt
2.5 Soziale Gewalt
2.6 Ökonomische Gewalt
2.7 Kinder und häusliche Gewalt
3 Folgen und Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder
4 Gefahren im Hinblick auf die Trennung
5 Fazit
Literatur
1 Einleitung
Die Familie, in Form von Mutter und Vater, ist die erste und wichtigste soziale Einheit im Leben des Kindes, Hier soll es Schutz, Geborgenheit, Sicherheit und Liebe erhalten. Die Institution Familie bereitet auf das Leben vor, es bildet das erziehungsbedürftige Kind bestenfalls zu einem Ieh-starken und selbstbewussten Individuum, Ohne Erziehung der älteren Generation wäre es dem Tode geweiht. Es lernt durch Mutter und Vater als Vorbild, seine eigene Rolle in der Gesellschaft zu finden. Bröckelt diese Institution, so steht die ganze Persönlichkeit des Kindes auf wackeligen Beinen, Wird das Kind Zeuge von häuslicher Gewalt oder gerät es sogar mitten hinein, so verwandelt sieh das eigentlich behütende Heim in einen Ort der Angst, Sind solche Zustände nicht nur einmalig, sondern kommen regelmäßig vor, sind die Auswirkungen beträchtlich. Dass dies aber leider der Fall ist, belegt eine repräsentative Studie aus dem Jahr 2004, bei welcher 10,000 Frauen nach ihren Gewalterlebnissen in Partnerschaften befragt wurden. Demnach erlebten 25% von ihnen mindestens einmal Gewalt durch einen männlichen Beziehungspartner, zwei Drittel davon mehr als nur einmal, 50% aller befragten Frauen lebten zu dem Zeitpunkt mit Kindern zusammen und gaben an, die Kinder hätten die Gewaltausbrüche überwiegend miterlebt. So hatten 57% der Kinder die Gewalt gehört, 50% von ihnen hatte sie gesehen und 21% gerieten selbst mit hinein,1 10% der Kinder wurden sogar direkt angegriffen. Des Weiteren wird angegeben, dass die Kinder zumeist sehr lange mit der Gewalt konfrontiert werden, da sie, wenn überhaupt, erst mit Trennung vom Partner endet,1 Auch wenn die Misshandlung der Mutter der häufigste Kontext von Kindesmisshandlung ist, soll dies nicht Thema der Arbeit sein. Ich möchte besonders auf die Auswirkungen solcher Fälle eingehen, bei denen die Kinder Gewalt gegen die Mutter miterlebten,
2 Begriffserklärung
Zunächst sollen die wichtigsten Begriffe zu diesem Thema erläutert werden. Die einzelnen Gewaltformen treten meist nicht getrennt voneinander auf, sondern greifen ineinander und ergeben eine bedrohliche Gesamtsituation, Zusammen führen sie zu einer Vereinsamung der Frau und machen es ihr schwer, Hilfe zu finden. Dies ist einer der Gründe, warum Frauen häufig so lange bei dem gewalttätigen Partner verharren.
2.1 Häusliche Gewalt
Unter häuslicher Gewalt wird im Allgemeinen jene Gewalt verstanden, welche von Erwachsenen, die in engen Beziehungen leben oder bis vor kurzem gelebt haben, gegeneinander ausgeübt wird. Dies ist unabhängig davon zu betrachten, ob sie in einem gemeinsamen Haushalt leben. Laut der Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt umfasst häusliche Gewalt die Formen der physischen, sexuellen, psychischen, sozialen und ökonomischen Gewalt.2 Hier ist in der Regel die Rede von Erwachsenen, die sieh in ehelichen und nieht-eheliehen Lebensgemeinschaften, aber auch in anderen Verwandtsehafts- beziehungen befinden können. Ähnlich definiert sieh der Begriff Partnergewalt. Diese „bezeichnet allgemein alle Formen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt zwischen Erwachsenen (manchmal auch Jugendlichen), die sieh durch eine Partnerschaft miteinander verbunden fühlen oder gefühlt haben.“3 Hierbei werden zwei Formen unterschieden. Zum Einen die selten und wenig ver- letzungsträehtige, wechselseitige Gewalt und zum Anderen Gewalt, welche die Abwertung und Kontrolle der Partnerin miteinsehließt und zudem wiederholt und verletzungsträehtig ist.4 Die meisten der vorliegenden Studien beziehen sieh auf die zuletzt genannte.
2.2 Physische Gewalt
Unter physischer Gewalt versteht man körperliche Misshandlungen, wie schlagen, treten, stoßen, boxen, an den Haaren ziehen oder der Einsatz von Waffen. Auch Essensentzug zählt zu physischer Gewalt.
2.3 Psychische Gewalt
Psychische Gewalt ist eine der destruktivsten Gewaltformen, da sie das Selbst- wertgefiihl und die psychische Gesundheit dauerhaft gefährdet. Zudem ist sie von außen nur begrenzt sichtbar. Hierunter zählen: verbale Erniedrigungen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Drohungen wie beispielsweise die Kinder wegzunehmen oder umzubringen, die Frau in der Öffentlichkeit lächerlich machen, sie für verrückt erklären oder Äußerungen dahingehend, die Frau sei ohne ihren Mann nichts wert, bis hin zu Todesdrohungen.
2.4 Sexualisierte Gewalt
Unter sexualisierter Gewalt wird der Zwang zu sexuellen Handlungen oder Vergewaltigung bezeiehnet. Aneli sexuelle Erniedrigung, Belästigung, der Zwang zu sexuellen Handlungen vor anderen oder zur Prostitution zählen darunter.
2.5 Soziale Gewalt
Es handelt sieh um soziale Diskriminierung, wie Einsperren, Kontaktverbot, das Verbot zu telefonieren oder das Haus zu verlassen. Die Frau wird von der Gesellsehaft isoliert. Die Entseheidungsmaeht obliegt allein dem Mann. Er entscheidet, was mit der Frau geschieht.
2.6 Ökonomische Gewalt
Ökonomische Gewalt dient ebenfalls der Aufrechterhaltung der Macht des Mannes. Geld wird hier als Mittel benutzt, es soll die Frau an die Beziehung binden. Der Mann entzieht der Frau das Geld, er allein verfügt über finanzielle Ressourcen und trifft dahingehend Entscheidungen. Ihr wird beispielsweise die Sozialhilfe oder das Haushaltsgeld entzogen. Auch das Verbot der Erwerbstätigkeit fällt in das Feld der ökonomischen Gewalt.
2.7 Kinder und häusliche Gewalt
Ist die Rede von Kindern und häuslicher Gewalt, so handelt es sieh hierbei um Gewalt in der Partnerbeziehung, die die Kinder (mit-) erleben. Genauer geht es um wiederholt schwere körperliche und anhaltend psychische Gewalt des (sozialen) Vaters oder eines Lebensgefährten gegen ihre Mutter.
3 Folgen und Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder
Wie bereits erwähnt erleben Kinder häufig die Gewalt des Vaters gegen ihre Mutter mit. In vielen Fällen können sie direkt sehen, wie die Mutter geschlagen oder vergewaltigt wird. Sie können die Gewalt spüren, selbst wenn sie nicht selbst davon betroffen sind und auch, wenn sie nicht einmal im selben Raum sind. Vom Kinderzimmer aus müssen sie mit anhören, wie der Vater die Mutter ansehreit, die Sehmerzenssehreie der Mutter, ihr wimmern und der Krach der
Gegenstände, die zerstört werden. Letztendlich ist auch das verstummen der Schreie fiir die Kinder eine direkte Belastung, Die stark ausgeprägte Phantasie der Kinder lässt sie sieh das schlimmste ansmalen. Sie spüren die angespannte Atmosphäre häufig bereits vor der eigentlichen Gewalttat, Es brant sieh zusammen und die Situation eskaliert, Kinder, die häusliche Gewalt häufig erleben, kennen bereits den Ablauf der Situation - und fürchten ihn.
Die Auswirkungen hängen von der Intensität und Anzahl der Gewaltakte, vom Entwicklungsstand des Kindes und die Ressourcen, die ihm zur Bewältigung von Belastungen zur Verfügung stehen, ab. Häusliche Gewalt hat daher eine doppelt negative Auswirkung, Sie belastet das Kind und nimmt ihm gleichzeitig die Ressourcen, um mit dieser Belastung zurechtzukommen.5
Kinder schildern bezüglich der Gewalttat Gefühle wie Angst, Mitleid, Erstarrung und Hilflosigkeit, Die Gewaltsituation stellt für sie eine Belastung, Verunsicherung und Überforderung dar,6 In der Studie „Kinder legen Zeugnis ab“ schildern sie ihre Angstgefühle: Zittern, Herzklopfen, Schwäche- und Lähmungsgefühle, Krämpfe, Kribbeln, ein unangenehmes Gefühl im Bauch,7 Es sind unkontrollierbare Empfindungen, die die Kinder nur schwer in Worte fassen können, Kinder misshandelter Mütter verlieren emotionale Sicherheit und das Erlebte holt sie in Alpträumen immer wieder ein. Sie haben oft Probleme mit dem Einschlafen, Zudem beziehen Kinder Geschehnisse häufig auf sieh. Sie geben sieh selbst die Schuld für die Gewalt des Vaters, Vielleicht hätten sie ihn beruhigen können oder den Streit verhindern. Sie hätten die Mutter besser schützen müssen oder umgreifen sollen. Diese gefühlte Verantwortung stellt eine große Belastung für sie dar. Sie fühlen sieh hilflos, da sie nichts tun können, um der Mutter zu helfen. Oft sind sie starr vor Angst, sie möchten helfen, sind aber wie gelähmt. Um es der Mutter nicht noch schwerer zu machen, verbergen sie ihre eigene Traurigkeit, Kinder, die häusliche Gewalt miterleben, müssen häufig schnell erwachsen werden und die Mutter unterstützen, gegebenenfalls für die Geschwister sorgen. Das Kind muss nicht altersgerechte Aufgaben übernehmen und die eigenen Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Es findet eine Rollenumkehrung zwischen Eltern und Kind statt, sie werden „parentifiziert“. Diese Kinder opfern häufig einen großen Teil der eigenen Kindheit/Jugend, Diese „seelische Verwaisung“ kommt dem Verlust der Eltern gleich,8
[...]
1 Wgl.3, Seite 15f.
2 Vgl. fl], Seite 3.
3 [3j, Seite 36.
4 Vgl. [31, Seite 37.
5 Vgl.4, Seite 91.
6 Vgl-3, Seite 36.
7 Vgl.3, Seite 54.
8 Vgl.3, Seite 58.
- Citation du texte
- Sabrina Seiffert (Auteur), 2010, Kinder und häusliche Gewalt - Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202162