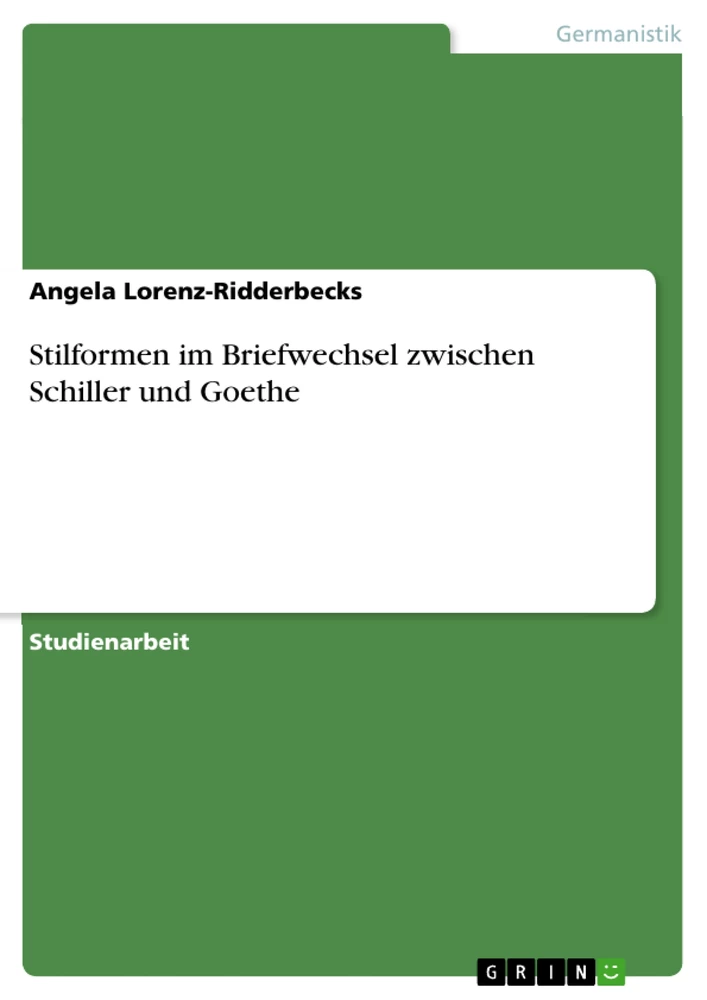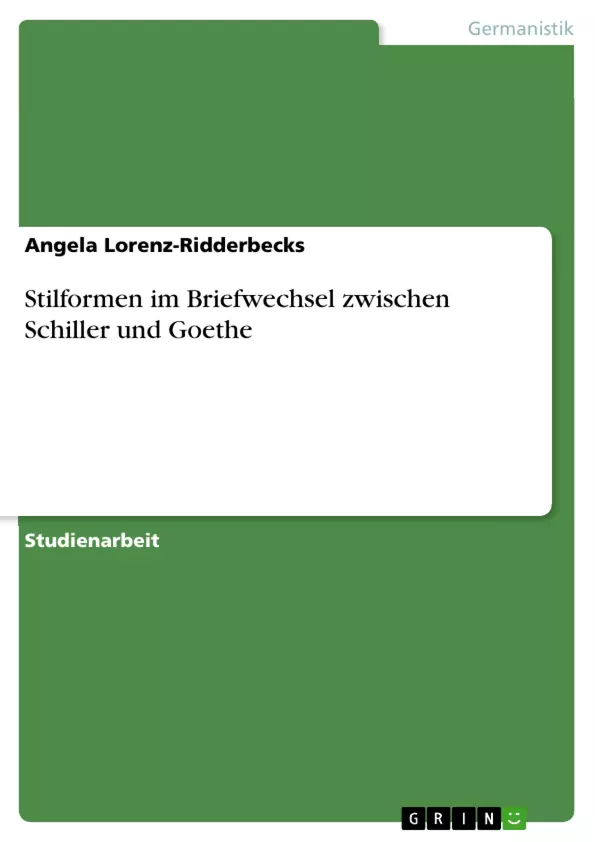“Wir konnten früher, wir konnten später zusammengeführt werden; aber daß wir es gerade in der Epoche wurden, wo ich die italienische Reise hinter mir hatte und Schiller der philosophischen Spekulation müde zu werden anfing, war von Bedeutung und für beide von größtem Erfolg.”
Es hat vorher schon Anknüpfungspunkte gegeben, doch sollten Schiller und Goethe erst im Jahre 1794 soweit sein, miteinander in einen freundschaftlichen und fruchtbaren Kontakt zu kommen, wie er dann im Briefwechsel zwischen 1794 – 1805 dokumentiert ist.
Schiller und Goethe – zwei Gegensätze ziehen sich an. Während Schiller groß und schlank ist, wirkt Goethe kleiner und untersetzt. Als sie 1794 zusammentreffen, ist der eine, Schiller, ein unermüdliches „Arbeitstier“, noch jung, gerade 35 Jahre alt, ständig krank, hat finanzielle Schwierigkeiten, eine Professur an der Jenaer Universität und hat sich gerade literarisch durchgesetzt, während Goethe, ein „Lebensgenießer“, zehn Jahre älter, hypochondrisch aber relativ gesund, finanziell abgesichert ist, sozial höher steht und literarisch weit über Weimar hinaus tonangebend ist. Ihnen bleiben zehn Jahre intensiven, gemeinsamen Schaffens in der Epoche der deutschen Klassik, die sie maßgeblich mitgestalten. Während Schiller nur 45 Jahre alt wird, stirbt Goethe erst nach 82 Lebensjahren.
Im „Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe“ zeichnet sich die große Unterschiedlichkeit der beiden Hauptpersonen vor allem für ihre literarische Vorgehensweise ab, die dennoch für beide äußerst gewinnbringend ist. Sie überträgt sich auf ihr gesamtes literarisches Wirken. Gerade in ihrem beginnenden Briefwechsel 1794 wird nachvollziehbar, worin diese Dialektik der Persönlichkeiten besteht, die beiden sehr bewusst ist und aus der beide fruchtbaren Nutzen ziehen wollen. Schiller bezeichnet seinen Verstand als „symbolisierend“, während er Goethes „intuitiv“ nennt. Schillers Basis ist die deduktiv arbeitende Philosophie, die ausgeht von einer Idee und sich allgemeiner Spekulation bedient. Er ist ein Analytiker, der Typ des sentimentalischen Dichters. Goethe dagegen geht induktiv vor. Seine Basis ist die empirische Naturwissenschaft, die Erfahrung, der sinnliche Eindruck. Seine Kunstproduktion basiert auf einem schöpferischen Akt, sodass er als Typus des naiven Dichters gelten kann. Schiller wird 1795 über diese Typen der Dichtung eine Abhandlung schreiben.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Brieflehren Christian Fürchtegott Gellerts und Karl Philipp Moritz‘
2.1 Gellerts Brieflehre
2.2 Moritz Brieflehre
3 Vergleich
3.1 Goethe an Schiller, 14. November 1796
3.2 Schiller an Goethe, 17. Januar 1797
3.3 Schiller an Goethe, 24. Januar 1797
3.4 Goethe an Schiller, 13. Juni 1797
4 Fazit
Literaturverzeichnis
Monographien
Zeitschriftenartikel
Internetquellen
- Quote paper
- Angela Lorenz-Ridderbecks (Author), 2012, Stilformen im Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202264