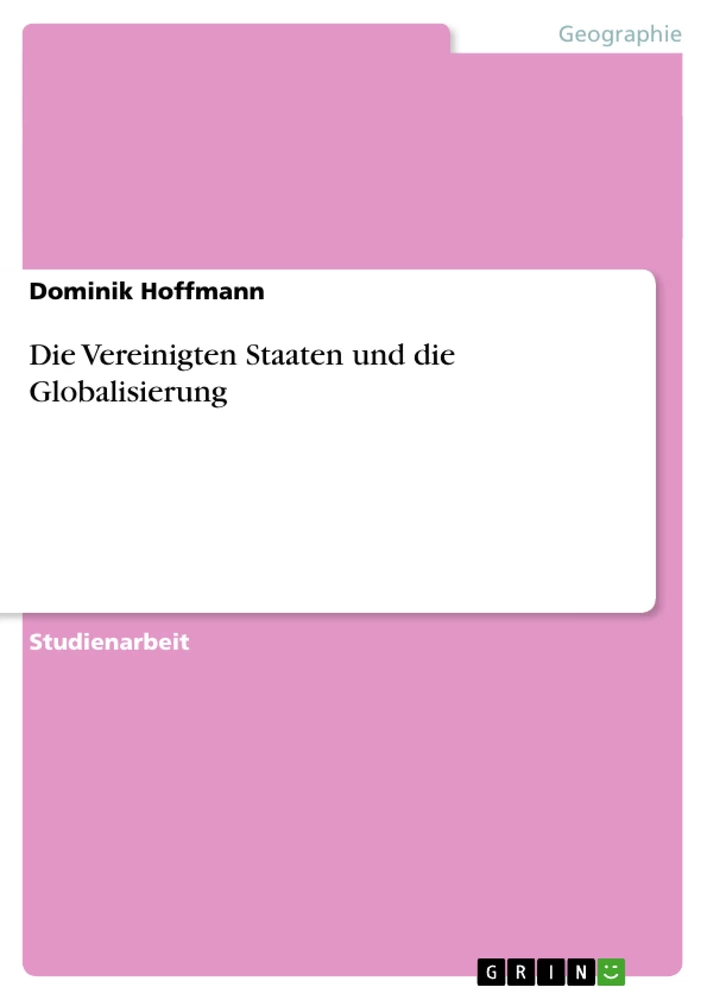Fast jeder kann sich heutzutage unter dem Begriff „Globalisierung“ etwas vorstellen. Gehe man auf die Straße und würde mit den Passanten eine Art „Brainstorming“ durchführen, fielen neben den Worten „Wirtschaft“, „Verflechtung“, „weltweit“ und „Beziehung“, früher oder später sicherlich die Begriffe „USA“ und „MC Donalds“. Eine Umfrage der Bloomberg Businessweek bestätigt diese Vermutung und zeigt auf, dass 56% der Befragten, Globalisierung und die USA in einen Kontext setzen würden. Der US-amerikanische Trendforscher John Naisbitt geht diesbezüglich sogar noch einen Schritt weiter und setzt beide Begriffe gleich. Demzufolge verstünde man unter Globalisierung nicht die „weltwirtschaftliche Verflechtung“, sondern allein die wirtschaftlichen Aktivitäten der USA.1 Doch wie kommt es zu einer solchen Gleichsetzung bzw. warum werden auf die Frage hin, was Globalisierung sei, ausschließlich die USA genannt um eine allumfassende Definition zu geben?
In dieser Arbeit werde ich näher auf diese Frage eingehen und versuchen, dieser Art Verknüpfungsmuster, anhand einiger Beispiele auf den Grund zu gehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Das Phänomen „Globalisierung“ und die USA
2. Global Player „USA“
3. Die „Amerikanisierung“ der Gesellschaft
4. Generation „Nike Mc´Coke“
5. Die Schattenseiten der „Amerikanisierung“
6. Die Wirtschaftsmacht als „Motor der Globalisierung“
7. USA oder Europa - Wer übernimmt die Macht des Wirtschaftsimperiums?
. Literaturverzeichnis
1. Das Phänomen „Globalisierung“ und die USA
Fast jeder kann sich heutzutage unter dem Begriff „Globalisierung“ etwas vorstellen. Gehe man auf die Straße und würde mit den Passanten eine Art „Brainstorming“ durchführen, fielen neben den Worten „Wirtschaft“, „Verflechtung“, „weltweit“ und „Beziehung“, früher oder später sicherlich die Begriffe „USA“ und „MC Donalds“. Eine Umfrage der Bloomberg Businessweek bestätigt diese Vermutung und zeigt auf, dass 56% der Befragten, Globalisierung und die USA in einen Kontext setzen würden. Der US-amerikanische Trendforscher John Naisbitt geht diesbezüglich sogar noch einen Schritt weiter und setzt beide Begriffe gleich. Demzufolge verstünde man unter Globalisierung nicht die „weltwirtschaftliche Verflechtung“, sondern allein die wirtschaftlichen Aktivitäten der USA.1 Doch wie kommt es zu einer solchen Gleichsetzung bzw. warum werden auf die Frage hin, was Globalisierung sei, ausschließlich die USA genannt um eine allumfassende Definition zu geben?
In den folgenden Unterpunkten werde ich näher auf diese Frage eingehen und versuchen, dieser Art Verknüpfungsmuster, anhand einiger Beispiele auf den Grund zu gehen.
Projizieren wir zunächst den Begriff „Globalisierung“ auf das weltweite wirtschaftspolitische Spielfeld und klammern den Regionalisierungsaspekt anhand Dezentralisierungsprozessen aus, erfährt dieser eine grundlegende Bedeutung. Globalisierung ist kein Produkt der Zeit, sondern ein tiefgreifendes, dauerhaftes Phänomen welches durch „globale Wirtschaftsverflechtungen“ gekennzeichnet ist. Demnach ist Globalisierung kein autonomer, selbsterhaltender Prozess sondern bedingt sich der Zusammenarbeit zwischen Regierungen auf höchster Ebene.2
Sie impliziert nicht nur nachhaltiges Wirtschaftswachstum, sondern führt auch zu einer sukzessiven Ausdehnung des wirtschaftlichen Wohlstands auf neue Teile der Erde.3
Viele Politiker aber auch Wirtschaftswissenschaftler stehen diesen Aussagen jedoch skeptisch gegenüber und sehen die Globalisierung als höchste Stufe des Kapitalismus, welcher den USA zu einem kontinuierlichen Aufstieg verhilft, indem sie versuchen alle anderen Länder einer amerikanischen Prägung zu unterziehen.
Muss demnach davon ausgegangen werden dass sich die USA den internationalen Spielregeln einfach wiedersetzt, oder lässt der Rest der Welt einfach gewähren da wir uns ja in einem „funktionierendem System“ befinden?
Es lässt sich nicht leugnen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sowohl militärisch als auch ökonomisch den weltweiten Führungsanspruch erheben. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991, ist die USA die einzige wirkliche Weltmacht.4
Doch wie groß ist deren Einfluss auf unser Leben, die Kultur und das Denken wirklich?
Die Verbreitung von Technologien und das Wachstum der Wechselbeziehungen zwischen den Märkten, Politiken und Gesellschaften führen früher oder später unaufhaltsam zu einer Globalisierung der Lebensweisen. Wirtschaftliche und politische Abhängigkeit impliziert die Unterdrückung der eigenen Identität und grenzt persönliche Entscheidungsräume erheblich ein. In diesem Zusammenhang kann also bestätigt werden, dass die USA schließlich eine gewisse kulturelle Vormacht einnimmt!5
2. Global Player „USA“
Innovationskraft sowie wirtschaftliche und kulturelle Stärke ermöglichen weltweiten Einfluss auf die Handlungsweisen der Bevölkerung.6 Die Zeichen des amerikanischen Globalisierungsprozesses sind allgegenwärtig. So finden sich selbst in indischen Kleinstädten Filialen der Imbisskette McDonald´s. Im weit entfernten Tansania ertönt amerikanische Rapmusik, in den Kinos von Taiwan und Ägypten fahren Batman und Robin über die Leinwände, im tibetischen Hochland finden sich amerikanische Buchtitel und in argentinischen Andendörfern kaut man Kaugummis, trägt Bluejeans oder bewegt den Kopf zur Musik von Jay-Z.
[...]
1 NAISBITT (1986, S. 23).
2 MEIER-WALSER (2002, S. 279).
3 MEIER-WALSER (2002, S. 280).
4 MEIER-WALSER (2002, S. 283).
5 ECKES, JR. et.al. (2003, S. 256).
6 FÄßLER (2007, S. 227).
Häufig gestellte Fragen
Warum werden die USA oft mit Globalisierung gleichgesetzt?
Viele Menschen assoziieren Globalisierung mit den wirtschaftlichen Aktivitäten der USA und Marken wie McDonald's. Trendforscher wie John Naisbitt sehen Globalisierung primär als Ausdehnung amerikanischer Wirtschaftsaktivitäten.
Was bedeutet der Begriff „Amerikanisierung“ der Gesellschaft?
Er beschreibt die weltweite Verbreitung amerikanischer Lebensweisen, Kultur und Konsummuster, wie z.B. das Tragen von Bluejeans, das Hören von Rap-Musik oder den Besuch amerikanischer Fast-Food-Ketten.
Ist Globalisierung ein rein wirtschaftlicher Prozess?
Nein, sie ist ein tiefgreifendes Phänomen, das auch politische Zusammenarbeit auf höchster Ebene erfordert und kulturelle sowie gesellschaftliche Identitäten beeinflusst.
Welche Rolle spielen die USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion?
Seit 1991 gelten die USA als die einzige verbliebene Weltmacht, die sowohl militärisch als auch ökonomisch einen weltweiten Führungsanspruch erhebt.
Was sind die Schattenseiten der Amerikanisierung?
Kritiker sehen darin eine Form des Kapitalismus, die zur Unterdrückung lokaler Identitäten führt und persönliche Entscheidungsräume durch wirtschaftliche Abhängigkeit einschränkt.
- Citation du texte
- Dominik Hoffmann (Auteur), 2012, Die Vereinigten Staaten und die Globalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202325