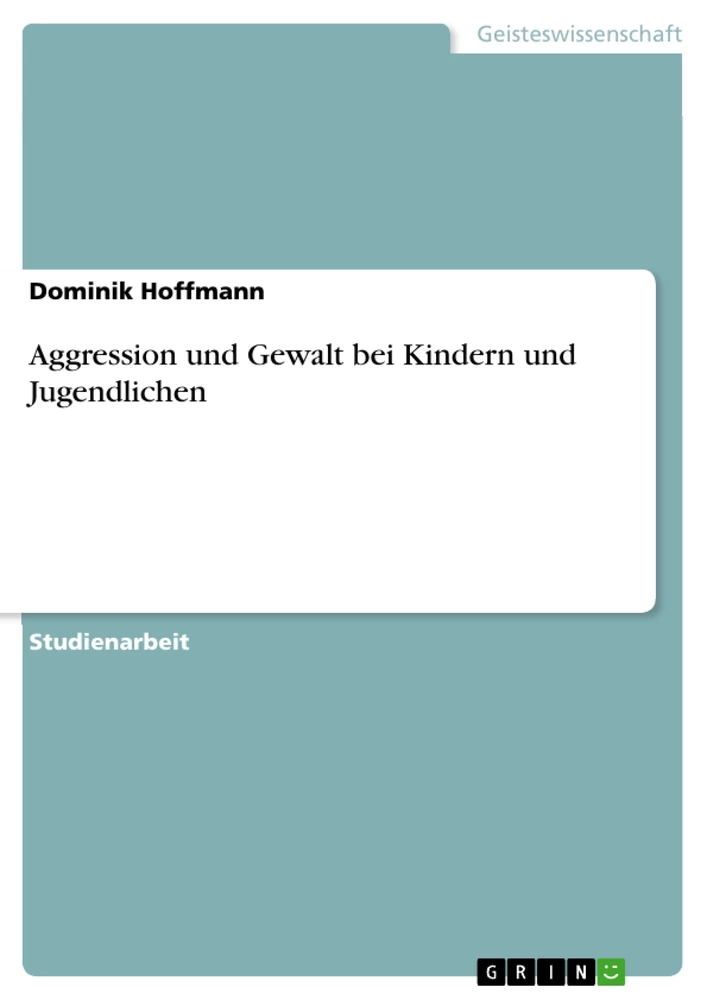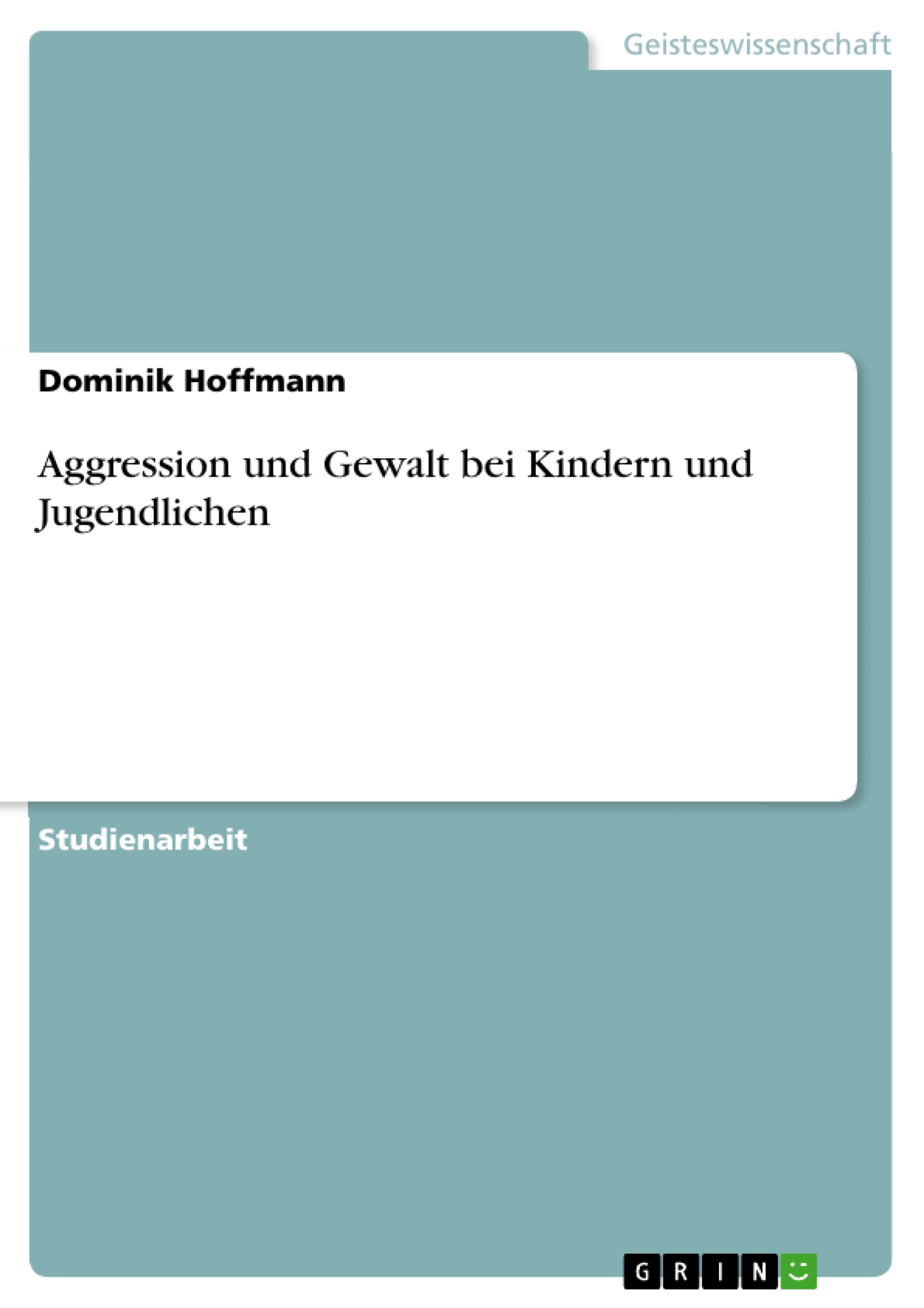Gewalt unter Schulkindern ist zweifellos ein sehr altes Phänomen. Die Tatsache, dass einige Schulkinder häufig und systematisch von anderen Kindern gemobbt und angegriffen werden, wurde bereits in unzähligen Werken der Literatur beschrieben die zeitlich gesehen sehr weit zurückreichen. Obwohl viele mit dem Problem „Gewalttäter/Gewaltopfer“ vertraut sind, wurden doch erst in jüngerer Zeit, genauer gesagt in der frühen 70er Jahren, systematische Untersuchungen bezüglich der Häufigkeit von Mobbing und Gewalttätigkeit unter Schulkindern durchgeführt.
Ein starkes gesellschaftliches Interesse weckte das Problem Gewalttäter/Gewaltopfer als Erstes in Schweden in den ausgehenden 1960er und frühen 1970er Jahren. Diesbezüglich wurde Anfang der 70er Jahre eine Kampagne gestartet, die ihre Schüler aufforderte, an einer Fragebogenaktion hinsichtlich Gewalttätigkeit an Schulen teilzunehmen.
Auf der Grundlage dieser landesweiten Erhebung lässt sich sagen, dass etwa 84.000 Schulkinder oder 15 Prozent der gesamten Schülerschaft der Grund- und weiterführenden Schulen (568.000 Schüler und Schülerinnen in den Jahren 1983 – 84) „hin und wieder“ bzw. „desöfteren“, als Gewalttäter und Gewalttäterinnen oder Gewaltopfer, an Gewalt beteiligt waren. Projizieren wir diese erschreckenden Tatsachen auf andere Länder und vergleichen hierzu die aus Deutschland stammenden Ergebnisse, stellen wir fest, dass hier zu Lande ausgehende von Datenerhebungen des Jahres 2009, bereits 35,2 Prozent aller Schüler an Gewaltakten beteiligt gewesen sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Aggressivität und Gewalttätigkeit bei Schulkindern
2. Definition von Aggressivität, Gewalttätigkeit und Mobbing
2.1 Aggressivität
2.2 Gewalttätigkeit
2.3 Mobbing
3. Theoretische Erklärungsansätze (Gewalttätigkeit, Aggressionen
3.1 Psychologische Theorien
3.1.1 Triebtheorie nach Freud
3.1.2 Frustrationstheorie nach Dollard
3.2 Soziologische Theorien
3.2.1 Anomietheorie nach Merton
3.2.2 Subkulturtheorie
3.3 Integrative Theorien
3.3.1 Geschlechtsspezifischer Ansatz
4. Präventionsmaßnahmen
4.1 Primär-, Sekundär und Tertiärprävention
4.2 Allgemeine Möglichkeiten der Prävention
5. Interventionsmaßnahmen
5.1 Verschiedene Interventionsprogramme gegen Gewalt und Mobbing
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Anteil von Gewalt an deutschen Schulen?
Laut Datenerhebungen aus dem Jahr 2009 waren bereits 35,2 Prozent aller Schüler in Deutschland an Gewaltakten beteiligt, entweder als Täter oder als Opfer.
Wie wird Mobbing in dieser Arbeit definiert?
Mobbing wird als eine Form von Gewalt verstanden, bei der Schüler häufig und systematisch von anderen Kindern angegriffen oder ausgegrenzt werden.
Welche psychologischen Theorien erklären Aggression?
Die Arbeit nennt unter anderem die Triebtheorie nach Freud, die Aggression als inneren Drang sieht, und die Frustrationstheorie nach Dollard, die Gewalt als Reaktion auf versagte Wünsche interpretiert.
Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Tertiärprävention?
Primärprävention setzt an, bevor Gewalt entsteht (allgemeine Aufklärung). Sekundärprävention richtet sich an Risikogruppen, während Tertiärprävention Maßnahmen zur Rückfallverhinderung nach bereits erfolgten Taten umfasst.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei Gewalt?
Ja, die Arbeit thematisiert integrative Theorien und geschlechtsspezifische Ansätze, um die unterschiedlichen Ausdrucksformen und Ursachen von Aggression bei Jungen und Mädchen zu erklären.
- Citar trabajo
- Dominik Hoffmann (Autor), 2012, Aggression und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202342