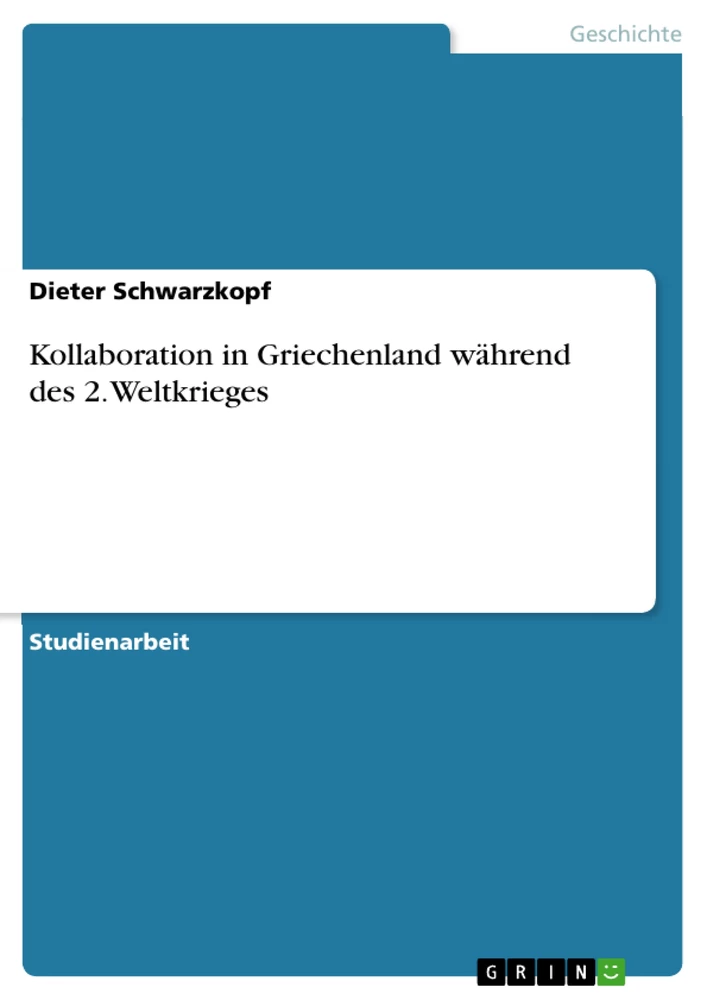Die Kollaborationsgeschichte des 2. Weltkrieges umfasst heutzutage ein sehr breites Spektrum der Geschichtswissenschaft, bezogen nicht nur auf die Kollaboration während des 2. Weltkrieges selbst, sondern auch auf die Zeit danach. Sie stellt noch bis heute in den meisten europäischen Ländern, die von Nazideutschland besetzt wurden, ein zentrales Thema der historischen Aufarbeitung des 2. Weltkrieges dar und kann immer noch bisweilen Kontroversen und z.T. bereits Jahrzehnte zurückliegende gesellschaftliche Spaltungen aufkommen bzw. aufbrechen lassen. Der Umgang und die Aufarbeitung der Kollaborationsgeschichte mit den Nazis offenbaren jedoch, je nach Land, unterschiedliche Merkmale und dementsprechend differierende Intensitäten und Ansichtsweisen mit der Beschäftigung dieser Historie. Dies hängt unter anderem mit der uneinheitlichen Okkupationspolitik der Nazis zusammen, die in den von ihnen besetzten Ländern primär auf die militärischen Bedürfnisse des Dritten Reiches ausgerichtet war. Die Nationalsozialisten traten, je nachdem, entweder als sich eher im Hintergrund zurückhaltende Besatzer auf, die eine von ihnen selbst installierte Regierung an die politische Spitze des Landes setzten und durch diese Kollaborationsregierungen das Land beherrschten, oder sie traten wesentlich deutlicher als Okkupanten auf, in dem sie z.B. wie im Falle Frankreichs rund die Hälfte des Landes militärisch besetzt hielten und eigenständig verwalteten. Im Fokus der Nazis standen fast überall das militärisch strategische und das wirtschaftliche Interesse. Die Bevölkerung der besetzten Länder wurde als ein nachrangiger Einflussfaktor betrachtet. Nach dem Verständnis der Nazis hatten sich die Menschen der okkupierten Länder den neuen Herrschern unterzuordnen und sich dienlich zu machen. Unter solchen Voraussetzungen stießen die Deutschen oftmals in breiten Schichten der Bevölkerung auf Ablehnung und unterschwelligen Hass, der in nicht wenigen Fällen auch im bewaffneten Widerstand mündete. Diejenigen, die sich den Nazis als Kollaborateure anboten oder aus welchen Gründen auch immer mit ihnen kollaborierten, wurden folglich von der Mehrheit der Bevölkerung als Verräter betrachtet. So entwickelte sich der Begriff „Kollaboration“ nach dem Krieg i.d.R. zu einer abwertenden Bezeichnung für all jene, die den Nationalsozialisten durch ihr Handeln Nutzen brachten, obgleich die Kollaboration neutraler, taktischer, bedingter oder bedingungsloser Natur war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Abschaffung der Metaxas-Diktatur und die Installierung einer deutschen Marionettenregierung
- Griechische Kollaborateure und ihre Motive bis Ende 1942 und die Auswirkungen ihrer Kollaborationsbereitschaft auf die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
- Die Regierung Rallis unter den Vorzeichen einer deutschen Niederlage
- Wirtschaftspolitik der deutschen Okkupanten und die Kollaboration der griechischen Bevölkerung
- Destabilisierung der griechischen Wirtschaft
- Wirtschaftliche Kollaboration
- Die Abschaffung der Metaxas-Diktatur und die Installierung einer deutschen Marionettenregierung
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Kollaboration in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere mit der deutschen Besatzungspolitik und den Motiven der griechischen Kollaborateure. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der deutschen Besatzung auf die griechische Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und untersucht, inwieweit die Kollaboration als eine nationale Notwendigkeit betrachtet werden kann oder ob sie primär von opportunistischen Erwägungen geleitet war.
- Die deutsche Besatzungspolitik und ihre Ziele in Griechenland
- Die Motive der griechischen Kollaborateure
- Die Auswirkungen der Kollaboration auf die griechische Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
- Die Rolle des Schwarzmarktes und der Hyperinflation
- Die Frage der Reparationsforderungen aus heutiger Sicht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Kollaborationsgeschichte des Zweiten Weltkriegs beleuchtet und den besonderen Kontext Griechenlands hervorhebt. Im Hauptteil wird zunächst die Abschaffung der Metaxas-Diktatur und die Installierung einer deutschen Marionettenregierung unter Generalleutnant Georgios Tsolakoglou beschrieben. Die Arbeit analysiert die Motive der Kollaborateure, insbesondere die Furcht vor einer Zerschlagung der nationalen Einheit Griechenlands und die antikommunistische Stimmung. Außerdem werden die Auswirkungen der Kollaboration auf die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft untersucht.
Im zweiten Teil des Hauptteils wird die Regierung von Ioannis Rallis unter den Vorzeichen einer deutschen Niederlage analysiert. Die Arbeit beleuchtet die veränderte deutsche Besatzungsstrategie und die Rolle der Sicherheitsbataillone. Außerdem werden die Motive der Kollaborateure in dieser Phase, insbesondere die Furcht vor einer kommunistischen Machtübernahme, untersucht.
Der dritte Teil des Hauptteils befasst sich mit der Wirtschaftspolitik der deutschen Okkupanten und der Kollaboration der griechischen Bevölkerung. Die Arbeit beschreibt die Destabilisierung der griechischen Wirtschaft durch die Ausbeutung der Ressourcen und die hohen Besatzungskosten. Außerdem werden die Gewinner der Besatzungssituation, wie Unternehmer und hohe Beamte, sowie die Rolle des Schwarzmarktes und der Hyperinflation analysiert.
Die Arbeit endet mit einer Schlussbemerkung, die die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die Frage der Reparationsforderungen aus heutiger Sicht diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kollaboration in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs, die deutsche Besatzungspolitik, die Motive der griechischen Kollaborateure, die Auswirkungen der Besatzung auf die griechische Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die Rolle des Schwarzmarktes und der Hyperinflation sowie die Frage der Reparationsforderungen aus heutiger Sicht.
Häufig gestellte Fragen
Wie war die politische Lage in Griechenland zu Beginn der Besatzung?
Nach der Abschaffung der Metaxas-Diktatur installierten die deutschen Besatzer eine Marionettenregierung unter Generalleutnant Georgios Tsolakoglou.
Was motivierte griechische Bürger zur Kollaboration mit den Nazis?
Motive waren oft Antikommunismus (Angst vor einer Machtübernahme der EAM/ELAS), die Hoffnung auf den Erhalt der nationalen Einheit oder schlichter Opportunismus zur persönlichen Bereicherung.
Wie wirkte sich die Besatzung auf die griechische Wirtschaft aus?
Es kam zu einer totalen Destabilisierung, massiver Hyperinflation und einer Hungersnot, da die Ressourcen des Landes für die militärischen Bedürfnisse des Dritten Reiches ausgebeutet wurden.
Wer profitierte von der wirtschaftlichen Kollaboration?
Vor allem Schwarzmarkthändler, bestimmte Unternehmer und hohe Beamte konnten durch die Zusammenarbeit mit den Okkupanten beträchtliche Gewinne erzielen.
Was war die Rolle der Regierung Rallis?
Die Regierung unter Ioannis Rallis gründete gegen Ende des Krieges die sogenannten Sicherheitsbataillone, um den bewaffneten kommunistischen Widerstand zu bekämpfen.
Ist das Thema Reparationsforderungen heute noch aktuell?
Ja, die Arbeit diskutiert die heutige Sicht auf die damaligen Zerstörungen und die daraus resultierenden moralischen und finanziellen Forderungen Griechenlands gegenüber Deutschland.
- Citar trabajo
- Dieter Schwarzkopf (Autor), 2012, Kollaboration in Griechenland während des 2. Weltkrieges, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202366