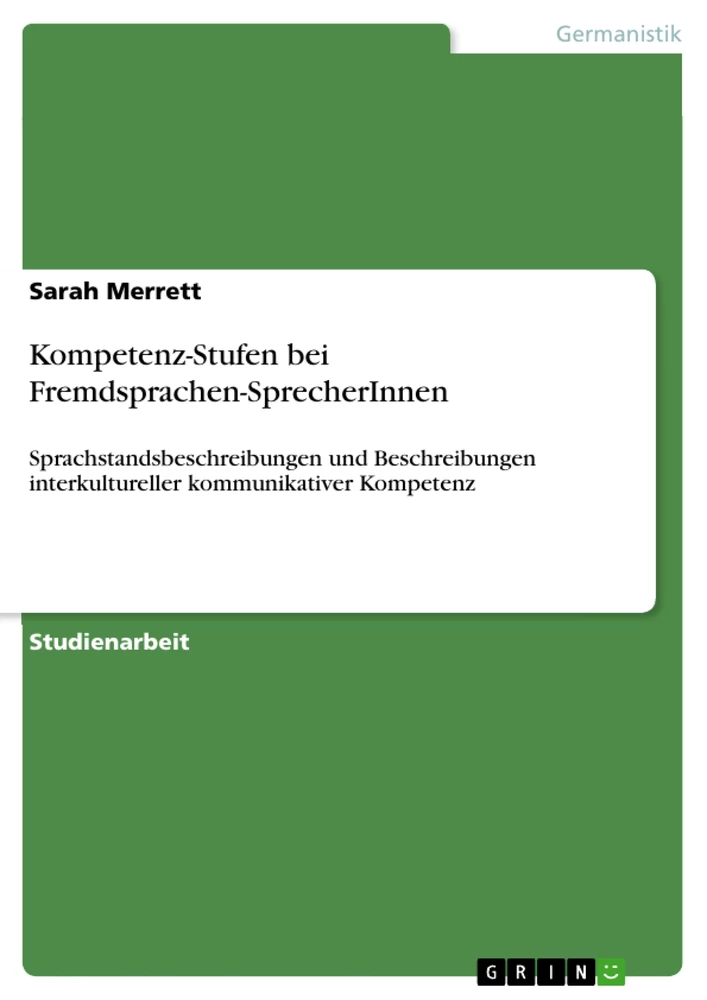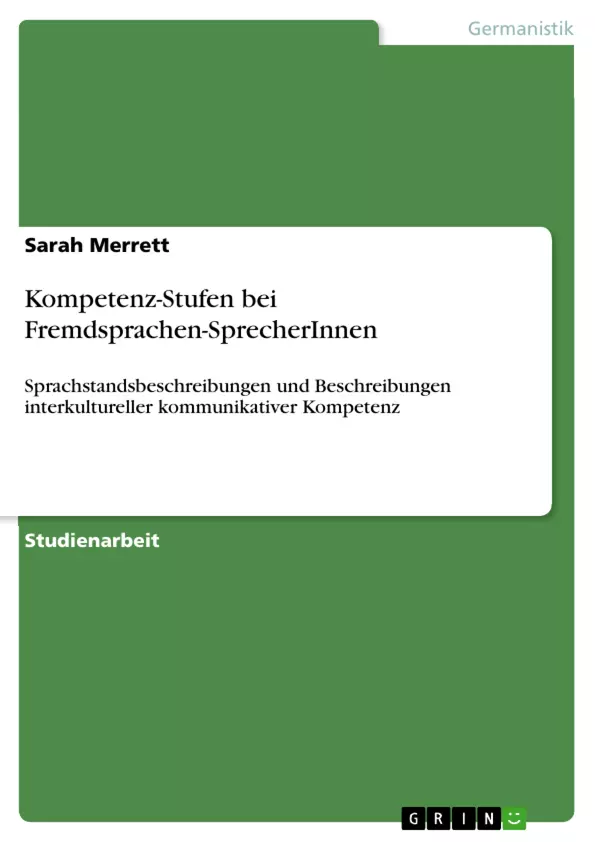Sie sprechen aber gut Deutsch“ - Wie häufig diese Worte doch fallen! Nicht nur DaFSprecherInnen dürfte auf Grund ihres fremdsprachlichen Akzents dieser Ausspruch sehr geläufig sein. Auch Deutsch-Muttersprachler, die Xenismen anderer, nicht-sprachlicher Art produzieren, etwa durch eine dunkle Hautfarbe, durch krauses Haar oder durch ein Kopftuch, werden vermutlich nicht selten mit diesen Worten konfrontiert. Doch was genau meint man hier mit „gut“? Kann wie in unserem Beispiel einem Fremdsprachen-Sprecher und einem Muttersprachler dasselbe sprachliche Kompetenzniveau – nämlich
„gut“ – zugeschrieben werden? Und wie würde man die Sprachkompetenz von jemandem einschätzen, dessen Deutsch kaum zu verstehen ist, etwa als „nicht gut“, „miserabel“ oder „grottenschlecht“?
Im Alltag erscheinen meiner Erfahrung nach jenseits der Bewertung „gut Deutsch sprechen“, „nicht so gut Deutsch sprechen“ und „schlecht Deutsch sprechen“ kaum andere, präzisere Beschreibungen des Sprachstandes eines Fremdsprachen-Sprechers. Doch wenn es darum geht, L2-Sprecher auf ihr Sprachniveau hin zu prüfen und ihnen hierfür Zertifikate auszustellen, reichen solch einfache Bewertungen nicht
aus. Hier gilt es, exakte, ausführliche Sprachstandsbeschreibungen heranzuziehen. Wenn nun ein DaF-Sprecher aus seinem Heimatland nach Deutschland kommt, um etwa als Au-pair zu arbeiten, wird es allerdings vermutlich nicht genügen, über hervorragende Deutschkenntnisse zu verfügen, um einen reibungslosen Aufenthalt bei
der Gastfamilie zu garantieren. Hierfür müssen interkulturelle Kompetenzen eingesetzt werden, um mögliche kulturell bedingte Konflikte mit der Gastfamilie zu minimieren. In dieser Arbeit soll eine Übersicht über die verschiedenen Kompetenz-Stufen bei Fremdsprachen-SprecherInnen gegeben werden, wobei hier nicht nur der Schwerpunkt auf rein sprachliche Kompetenzen gelegt wird, sondern auch auf interkulturelle (kommunikative) Kompetenzen.
Im Fazit der Hausarbeit wird diskutiert, inwiefern sprachliche und interkulturelle Kompetenzen theoretisch miteinander zusammenhängen
und wie man eine Verknüpfung der beiden praktisch umsetzen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kompetenz-Stufen
- 2.1 Sprachstandsbeschreibungen
- 2.1.1 Das Dreieck der Europäischen Sprachenpolitik
- 2.1.1.1 Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen
- 2.1.1.2 Das europäische Sprachenportfolio
- 2.1.1.3 Profile Deutsch
- 2.1.2 Sprachtests
- 2.1.2.1 DSH
- 2.1.2.2 TestDaF
- 2.1.3 Beispiel einer Sprachstandsbeschreibung: „M. Liedke – Eindruck und Diskurs“
- 2.2 Konzepte interkultureller Handlungskompetenz
- 2.2.1 Definitionen interkultureller Kompetenz
- 2.2.2 Listen- und Komponentenmodelle interkultureller Kompetenz
- 2.2.3 Entwicklungsmodelle interkultureller Kompetenz
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt einen Überblick über Kompetenzstufen bei Fremdsprachensprechern, wobei sowohl sprachliche als auch interkulturelle kommunikative Kompetenzen im Fokus stehen. Ziel ist es, verschiedene Konzepte und Methoden zur Beschreibung dieser Kompetenzen zu präsentieren und deren Zusammenhänge aufzuzeigen.
- Sprachstandsbeschreibungen und deren Anwendung
- Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER)
- Europäisches Sprachenportfolio und Profile Deutsch
- Konzepte interkultureller Handlungskompetenz
- Verknüpfung sprachlicher und interkultureller Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Problematik der ungenauen Beschreibung von Sprachkompetenzen im Alltag gegenüber den Anforderungen exakter Sprachstandsbeschreibungen für Zertifizierungen heraus. Sie betont die Notwendigkeit, neben rein sprachlichen auch interkulturelle Kompetenzen zu berücksichtigen, besonders im Kontext von Auslandsaufenthalten. Der Fokus der Arbeit auf die Darstellung verschiedener Kompetenzstufen für sprachliche und interkulturelle Fähigkeiten wird deutlich gemacht.
2. Kompetenz-Stufen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Kompetenzstufen zur Erfassung und Bewertung von Fähigkeiten. Es wird argumentiert, dass präzise Kompetenzbeschreibungen sowohl für Lernende als auch Lehrende essentiell sind, um Leistungen fair und einheitlich beurteilen und international vergleichen zu können. Das Kapitel leitet über zur detaillierten Betrachtung von Sprachstandsbeschreibungen und Konzepten interkultureller Kompetenz.
2.1 Sprachstandsbeschreibungen: Dieses Kapitel erläutert die Notwendigkeit von Sprachstandsbeschreibungen zur genauen Erfassung der Kompetenzen von Fremdsprachenlernenden. Es stellt den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) vor, der europaweit vergleichbare Sprachkenntnisse ermöglicht. Weiterhin werden das Europäische Sprachenportfolio und Profile Deutsch als weitere Instrumente zur Sprachstandsbeschreibung besprochen. Der Einfluss des GER auf standardisierte Sprachprüfungen wird ebenfalls behandelt, und eine empirische Studie von Liedke dient als Beispiel für die Erfassung von Sprachkompetenzen.
2.2 Konzepte interkultureller Handlungskompetenz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Beschreibung interkultureller Handlungskompetenzen. Es werden verschiedene Konzepte vorgestellt, um diese Kompetenzen zu erfassen und zu beschreiben. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung unterschiedlicher Modelle und deren Anwendung.
Schlüsselwörter
Sprachstandsbeschreibung, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER), Europäisches Sprachenportfolio, Profile Deutsch, interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Kompetenz, Sprachtests, DSH, TestDaF, Fremdsprachenlernen, Kompetenzstufen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kompetenzstufen bei Fremdsprachensprechern
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Kompetenzstufen bei Fremdsprachenlernenden. Der Fokus liegt auf der Beschreibung sowohl sprachlicher als auch interkultureller kommunikativer Kompetenzen. Die Arbeit präsentiert verschiedene Konzepte und Methoden zur Beschreibung dieser Kompetenzen und zeigt deren Zusammenhänge auf.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Sprachstandsbeschreibungen und deren Anwendung, den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER), das Europäische Sprachenportfolio und Profile Deutsch, Konzepte interkultureller Handlungskompetenz und die Verknüpfung sprachlicher und interkultureller Kompetenzen. Konkrete Sprachtests wie DSH und TestDaF werden ebenfalls erwähnt.
Was sind Sprachstandsbeschreibungen und warum sind sie wichtig?
Sprachstandsbeschreibungen dienen der genauen Erfassung der Kompetenzen von Fremdsprachenlernenden. Sie sind wichtig, um Leistungen fair und einheitlich beurteilen und international vergleichen zu können. Der GER ermöglicht europaweit vergleichbare Sprachkenntnisse. Das Europäische Sprachenportfolio und Profile Deutsch sind weitere Instrumente zur Sprachstandsbeschreibung.
Was ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER)?
Der GER ist ein europaweit anerkanntes System zur Beschreibung von Sprachkenntnissen. Er ermöglicht einen Vergleich von Sprachkompetenzen verschiedener Personen und Sprachen und bildet die Grundlage für viele standardisierte Sprachprüfungen.
Welche Rolle spielen interkulturelle Kompetenzen?
Die Arbeit betont die Bedeutung interkultureller Kompetenzen neben rein sprachlichen Fähigkeiten. Verschiedene Konzepte und Modelle zur Beschreibung und Erfassung dieser Kompetenzen werden vorgestellt und diskutiert.
Welche Sprachtests werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt den DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) und den TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) als Beispiele für standardisierte Sprachtests.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einem Kapitel zu Kompetenzstufen (inklusive Sprachstandsbeschreibungen und interkultureller Handlungskompetenz), einem Fazit und einem Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende, Lernende, Sprachprüfer und alle, die sich mit der Beschreibung und Bewertung von Sprach- und interkulturellen Kompetenzen befassen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sprachstandsbeschreibung, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER), Europäisches Sprachenportfolio, Profile Deutsch, interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Kompetenz, Sprachtests, DSH, TestDaF, Fremdsprachenlernen, Kompetenzstufen.
- Citation du texte
- Sarah Merrett (Auteur), 2011, Kompetenz-Stufen bei Fremdsprachen-SprecherInnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202434