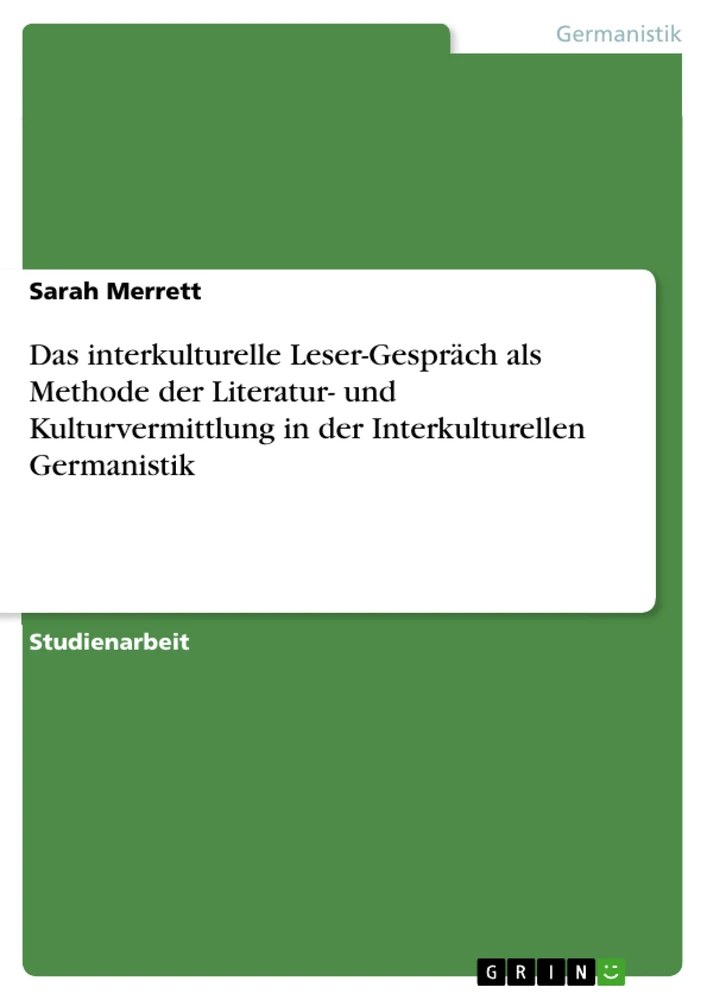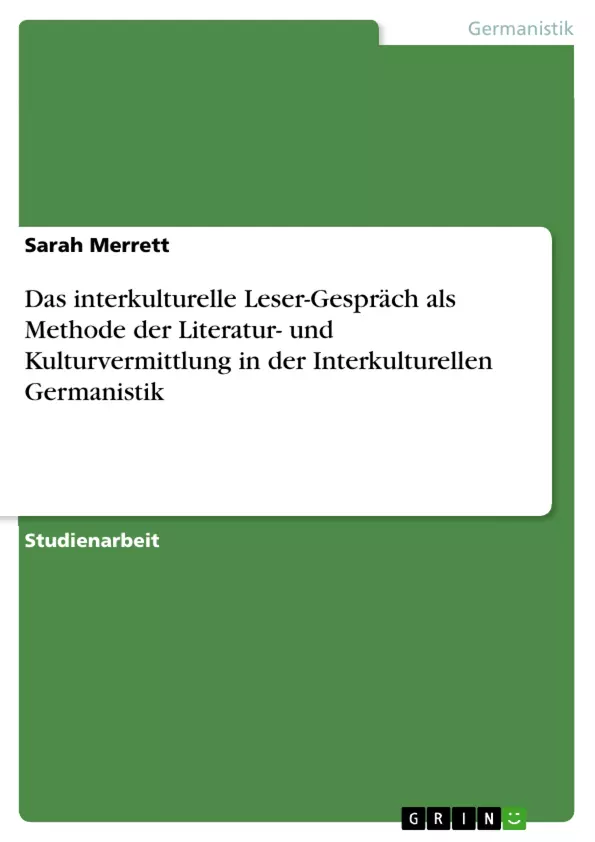„Aha?! Das versteh' ich aber ganz anders!“ Diese oder ähnliche Worte dürften wohl jedem bekannt sein, der schon mal seine Lese-Erfahrung mit jemanden ausgetauscht hat, der denselben Text gelesen hat. Nun, stellen wir uns vor, diese beiden Leser stammen aus verschiedenen Kulturkreisen, so dürfte es umso wahrscheinlicher erscheinen, dass unterschiedliche Vorstellungen/Verständnisse von ein und demselben Text vorherrschen. Dies kann häufig sogar mal zu einer Verstrickung in eine Endlos-Diskussion führen. Dabei reicht eine unterschiedliche Auffassung von einem einzigen Begriff häufig aus, um ein solches Gespräch zu evozieren. Selbstverständlich trifft dies nicht nur
auf das Lesen zu, sondern auch auf die Rezeption anderer Medien, wie etwa am Philosophieren über ein Theaterstück, einen (Kino-)Film oder ein Kunstwerk deutlich wird.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch auf dem Gespräch über das Gelesene, wobei hier nicht, wie in unserem Beispiel, auf willkürliche Gespräche über Lese-Erfahrungen eingegangen wird, sondern auf das gesteuerte (interkulturelle) Leser-Gespräch im Rahmen der Kultur- bzw. Literaturvermittlung.
Dazu werde ich nach einer allgemeinen Einführung über die Rolle der deutschsprachigen Literatur in der Praxis der Kulturvermittlung speziell auf das interkulturelle Leser-Gespräch eingehen und
seine Funktion in der interkulturellen Germanistik herausarbeiten. Im Zusammenhang mit dem Leser-Gespräch darf der Aspekt der Psychologie des Lesens nicht vernachlässigt werden, weshalb ich in Kapitel 3 auf den Leseakt selbst eingehen werde und skizzieren werde, welche Prozesse ein Leser eigentlich durchschreitet, wenn er einen (fremden) Text liest. Im nächsten Kapitel soll dann auf die Aufnahme literarischer Werke eingegangen werden, also auf die Rezeptionsästhetik bzw. speziell auf die Begriffe Rezeption und Interpretation, wobei das Ziel sein wird, diese Begriffe
voneinander abzugrenzen. Anschließend werde ich in Kapitel 4 drei literarische Texte analysieren und ihr Potential zur Initiierung von Leser-Gesprächen herausarbeiten, bevor ich dann im letzten
Kapitel zum Fazit meiner Arbeit komme.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das interkulturelle Leser-Gespräch als Methode der Literatur- und Kulturvermittlung in der Interkulturellen Germanistik...
- 2.1 Die Rolle der deutschsprachigen Literatur in der Praxis der Kulturvermittlung..
- 2.2 Das interkulturelle Leser-Gespräch........
- 2.2.1 Das Leser-Gespräch als Gegenstand der Interkulturellen Germanistik..
- 3. Lesen, rezipieren, interpretieren………...
- 3.1 Allgemeines.......
- 3.2 Die Psychologie des Lesens.
- 3.3 Rezeptionsästhetik...........
- 3.4 Das Problem der interkulturellen Rezeption und Interpretation.
- 4. Analyse dreier literarischer Texte
- 4.1 Max Frisch: Fragebogen zum Thema Heimat..
- 4.2 Rudolf Otto Wiemer: Empfindungswörter
- 4.3 Reiner Kunze: Fünfzehn..
- 5. Fazit..
- 6. Literaturverzeichnis...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem interkulturellen Leser-Gespräch als Methode der Literatur- und Kulturvermittlung in der Interkulturellen Germanistik. Sie untersucht die Rolle der deutschsprachigen Literatur in der Praxis der Kulturvermittlung und analysiert die Funktion des interkulturellen Leser-Gesprächs in diesem Kontext. Des Weiteren wird der Aspekt der Psychologie des Lesens betrachtet und das Problem der interkulturellen Rezeption und Interpretation beleuchtet.
- Die Bedeutung der deutschsprachigen Literatur in der interkulturellen Sprach- und Kulturvermittlung
- Das interkulturelle Leser-Gespräch als Methode der Literatur- und Kulturvermittlung
- Die Psychologie des Lesens und die Rolle der Rezeptionsästhetik bei der Interpretation fremdsprachiger Texte
- Das Problem der interkulturellen Rezeption und Interpretation literarischer Werke
- Analyse dreier literarischer Texte und deren Potential zur Initiierung von Leser-Gesprächen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfragen vor. Kapitel 2 beleuchtet die Rolle der deutschsprachigen Literatur in der Praxis der Kulturvermittlung und erläutert die Funktion des interkulturellen Leser-Gesprächs in der interkulturellen Germanistik. Kapitel 3 behandelt den Aspekt der Psychologie des Lesens und skizziert die Prozesse, die beim Lesen eines fremdsprachigen Textes ablaufen. Kapitel 4 analysiert drei literarische Texte und arbeitet deren Potential zur Initiierung von Leser-Gesprächen heraus.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Germanistik, Literaturvermittlung, Kulturvermittlung, interkulturelles Leser-Gespräch, Psychologie des Lesens, Rezeptionsästhetik, interkulturelle Rezeption, interkulturelle Interpretation, Fremdliteratur, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein interkulturelles Leser-Gespräch?
Es handelt sich um ein gesteuertes Gespräch über literarische Texte zwischen Lesern aus verschiedenen Kulturkreisen. Ziel ist der Austausch über unterschiedliche Interpretationen und das Verständnis kultureller Differenzen.
Welche Rolle spielt Literatur in der Kulturvermittlung?
Literatur dient als Medium, um fremde Lebenswelten, Werte und Perspektiven erfahrbar zu machen. Sie bietet Anlass zur Reflexion über eigene und fremde kulturelle Prägungen.
Was versteht man unter der "Psychologie des Lesens"?
Sie untersucht die kognitiven und emotionalen Prozesse beim Lesen. Besonders bei fremden Texten spielen Vorwissen und kulturelle Schemata eine entscheidende Rolle für das Verständnis.
Was ist der Unterschied zwischen Rezeption und Interpretation?
Rezeption beschreibt die Aufnahme und Verarbeitung eines Werkes durch den Leser. Interpretation ist die gezielte Deutung und Sinngebung des Textes, die oft kulturell beeinflusst ist.
Welche Autoren eignen sich für interkulturelle Leser-Gespräche?
Texte von Autoren wie Max Frisch, Rudolf Otto Wiemer oder Reiner Kunze bieten durch ihre Themen (z. B. Heimat, Sprache) ein hohes Potenzial, um Diskussionen über kulturelle Identität anzustoßen.
- Arbeit zitieren
- Sarah Merrett (Autor:in), 2010, Das interkulturelle Leser-Gespräch als Methode der Literatur- und Kulturvermittlung in der Interkulturellen Germanistik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202435