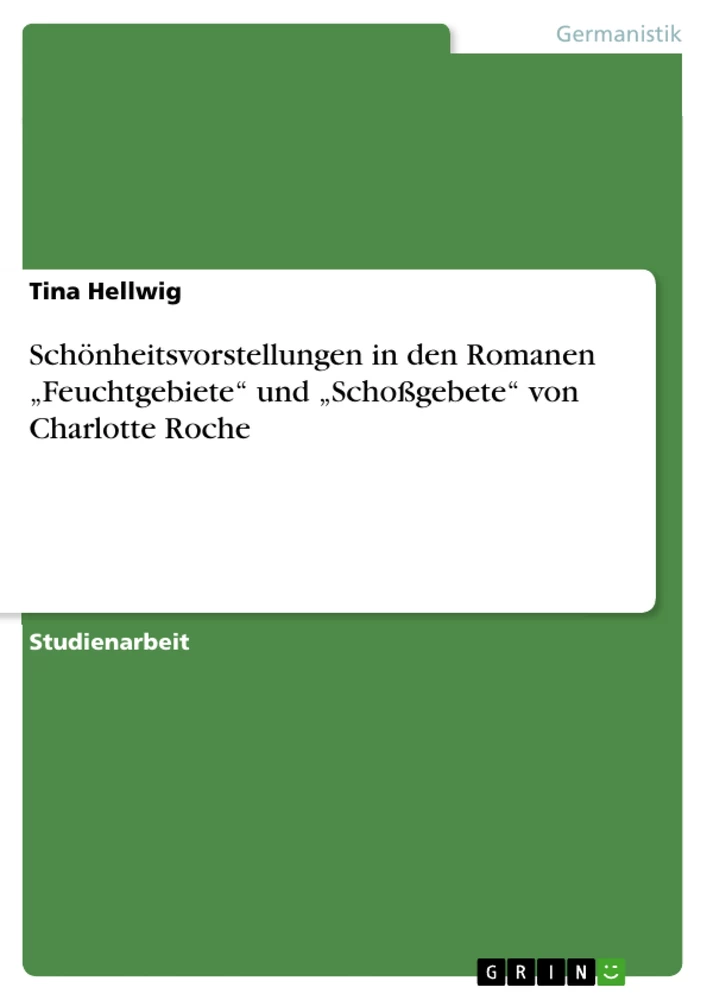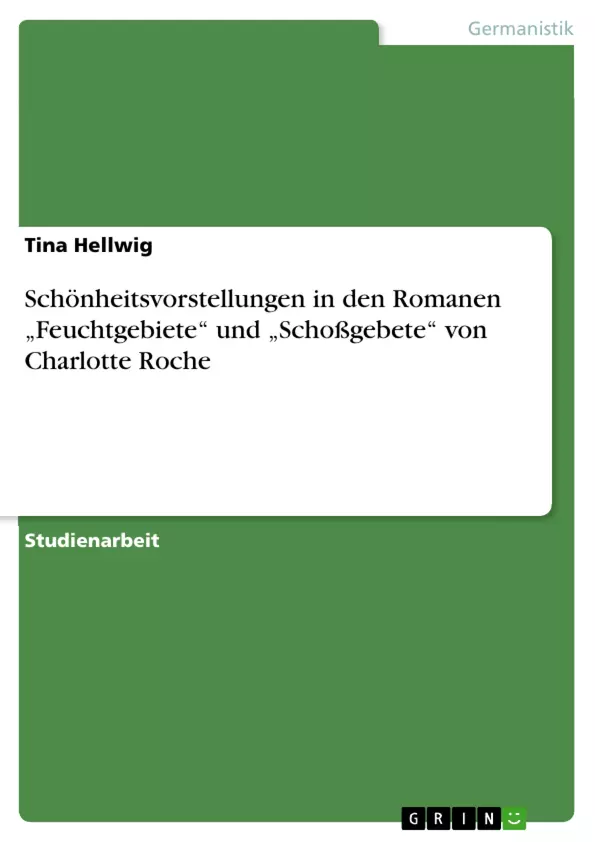Mit dem Erscheinen des zweiten Romans „Schoßgebete“ von Charlotte Roche im August
2011 wurde wie bereits bei der Veröffentlichung ihres ersten Buches „Feuchtgebiete“
eine brisante öffentliche Diskussion darüber geführt, ob und in welcher Art und Weise
man gesellschaftliche Tabuthemen wie etwa dem ungeschönte Sexualleben der Frau in
der Literatur diskutieren darf. Die detaillierten Schilderungen der Autorin wurden von
vielen Personen als zu provokant empfunden und galten als reine Inszenierung von
Schockmomenten, um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen.
Die feministischen Denkansätze, die sich in beiden Romanen finden lassen und die sich für
die natürliche Schönheit der Frau aussprechen, wurden demgegenüber nur selten
thematisiert. Dabei spielt die Ästhetik des Weiblichen in der Geschichte der Helen Memel,
die Protagonistin in „Feuchtgebiete“ und Elizabeth Keil, der Hauptfigur in „Schoßgebete“
eine wichtige Rolle, die in Anbetracht von gesellschaftlichen Zwängen, Partnerschaften
und auch dem eigenen Selbstwertgefühl neu diskutiert werden muss.
Die folgende Arbeit wird die Ansichten der beiden Frauen genauer untersuchen und
gegenüberstellen. Der Fokus liegt hierbei auf den geschlechtsspezifischen vorgestellten
Schönheitsidealen. Weiterhin wird der Zusammenhang zwischen Hygiene und
Attraktivität näher beleuchtet, der besonders im ersten Buch eine ganz zentrale Rolle
spielt. Abschließend soll noch einmal resümiert werden, wie sich die vermittelten
Vorstellungen von Schönheit in dem Schreibstil der Autorin wiederfinden. Können also
Bücher, die unschöne Themen wie Körperausscheidungen und mangelnde Intimhygiene
abhandeln, überhaupt schöne Literatur sein? Die in den Büchern verwendeten Wörter,
Redewendungen aber auch die Syntax werden bei dieser finalen Analyse eine
wesentliche Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundsätzliches zu den Romanen „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“
- 1.1 Inhaltsangaben
- 1.1.1 Feuchtgebiete
- 1.1.2 Schoßgebete
- 1.2 Wirkung der Romane in der Öffentlichkeit
- 1.1 Inhaltsangaben
- 2. Geschlechtsspezifische Schönheitsvorstellungen
- 2.1 Die Schönheit des Mannes
- 2.2 Die Schönheit der Frau
- 3. Hygiene und Sexualität
- 4. Schönheit und Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Romane „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“ von Charlotte Roche, mit besonderem Fokus auf die Darstellung geschlechtsspezifischer Schönheitsvorstellungen und deren gesellschaftliche Einbettung. Die Analyse beleuchtet den Umgang der Autorinnen mit Tabuthemen wie Körperlichkeit und Sexualität und deren Rezeption in der Öffentlichkeit. Dabei wird der Zusammenhang zwischen Hygiene, Sexualität und dem Selbstbild der weiblichen Protagonistinnen untersucht.
- Geschlechtsspezifische Schönheitsvorstellungen in den Romanen
- Der Umgang mit Tabuthemen wie Körperlichkeit und Sexualität
- Die Rolle von Hygiene und Attraktivität
- Der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf das Selbstbild der Protagonistinnen
- Die sprachliche Gestaltung und ihre Verbindung zu den dargestellten Schönheitsidealen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Romane „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“ von Charlotte Roche ein und skizziert die kontroverse öffentliche Diskussion um deren Darstellung von Tabuthemen. Sie hebt die feministischen Aspekte hervor, die in den Romanen zu finden sind, und kündigt die detaillierte Untersuchung geschlechtsspezifischer Schönheitsvorstellungen und des Zusammenhangs zwischen Hygiene und Attraktivität an. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage, ob Bücher, die unschöne Themen behandeln, dennoch als schöne Literatur gelten können, und deutet die Bedeutung des Schreibstils für die Analyse an.
1. Grundsätzliches zu den Romanen „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die beiden Romane. Es beginnt mit Inhaltsangaben zu „Feuchtgebiete“, das den Krankenhausaufenthalt der 18-jährigen Helen Memel beschreibt und ihre Erlebnisse, Erinnerungen, sowie ihre Ansichten zu Körperhygiene, Sexualität und gesellschaftlichen Tabus beleuchtet. Die tragische Familiengeschichte Helens und ihre Hoffnungen auf eine Versöhnung der Eltern werden ebenfalls erwähnt. Die Zusammenfassung von „Schoßgebete“ konzentriert sich auf die 33-jährige Elizabeth Keil und ihren Versuch, verschiedene Rollen gleichzeitig zu meistern, während sie mit Selbstmordgedanken und der Erinnerung an einen tragischen Autounfall kämpft. Der Kapitelüberblick veranschaulicht die Ähnlichkeiten in der Erzählperspektive und der Thematisierung von Erinnerungen aus dem Sexualleben, dem familiären Hintergrund und dem Alltag beider Romane.
1.2 Wirkung der Romane in der Öffentlichkeit: Die Veröffentlichung von „Feuchtgebiete“ löste eine heftige Debatte über Perversion und Tabubrüche aus. Während ein Teil der Leser die detaillierte Schilderung von Körperausscheidungen und mangelnder Hygiene als Befreiungsschlag der modernen Frau und als neue feministische Bewegung interpretierte, sahen andere darin reine Provokation zur Erlangung medialer Aufmerksamkeit. Die kritische Rezeption des Romans wird differenziert dargestellt, wobei die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen der feministischen Aussagekraft des Buches beleuchtet werden. Der enorme kommerzielle Erfolg beider Romane wird im Kontext der öffentlichen Wahrnehmung der Autorin und dem autobiographischen Anteil der Bücher diskutiert. Der feministische Ansatz der Autorin, der die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau kritisiert und den Druck auf Frauen im Hinblick auf Schönheitsideale thematisiert, wird ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Charlotte Roche, Feuchtgebiete, Schoßgebete, Schönheitsideale, Körperhygiene, Sexualität, Feminismus, Tabubruch, gesellschaftliche Normen, Schreibstil, mediale Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zu "Feuchtgebiete" und "Schoßgebete" von Charlotte Roche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Romane „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“ von Charlotte Roche. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung geschlechtsspezifischer Schönheitsvorstellungen, dem Umgang mit Tabuthemen wie Körperlichkeit und Sexualität, und deren Rezeption in der Öffentlichkeit. Es wird der Zusammenhang zwischen Hygiene, Sexualität und dem Selbstbild der weiblichen Protagonistinnen untersucht.
Welche Themen werden in den Romanen behandelt und wie werden sie analysiert?
Die Analyse beleuchtet verschiedene Aspekte: geschlechtsspezifische Schönheitsvorstellungen (für Männer und Frauen), den Umgang mit Tabuthemen (Körperlichkeit und Sexualität), die Rolle von Hygiene und Attraktivität, den Einfluss gesellschaftlicher Normen auf das Selbstbild der Protagonistinnen und die sprachliche Gestaltung im Zusammenhang mit den Schönheitsidealen. Die Wirkung der Romane auf die Öffentlichkeit und die kontroversen Debatten werden ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungsfrage formuliert (können Bücher mit unschönen Themen schöne Literatur sein?). Kapitel 1 bietet einen Überblick über die Romane „Feuchtgebiete“ (mit Fokus auf Helen Memel, ihre Erlebnisse und ihre Ansichten zu Hygiene und Sexualität) und „Schoßgebete“ (mit Fokus auf Elizabeth Keil und ihren Kampf mit Selbstmordgedanken und der Erinnerung an einen Unfall). Kapitel 1.2 analysiert die öffentliche Wirkung beider Romane, die kontroversen Reaktionen und den kommerziellen Erfolg. Weitere Kapitel befassen sich mit geschlechtsspezifischen Schönheitsvorstellungen, Hygiene und Sexualität sowie dem Zusammenhang zwischen Schönheit und Sprache.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Charlotte Roche, Feuchtgebiete, Schoßgebete, Schönheitsideale, Körperhygiene, Sexualität, Feminismus, Tabubruch, gesellschaftliche Normen, Schreibstil, mediale Rezeption.
Wie werden die Romane "Feuchtgebiete" und "Schoßgebete" in der Arbeit zusammengefasst?
„Feuchtgebiete“ beschreibt den Krankenhausaufenthalt der 18-jährigen Helen Memel und beleuchtet ihre Erlebnisse, Erinnerungen und Ansichten zu Körperhygiene, Sexualität und gesellschaftlichen Tabus. „Schoßgebete“ konzentriert sich auf die 33-jährige Elizabeth Keil, ihren Versuch, verschiedene Rollen zu meistern, ihre Selbstmordgedanken und die Erinnerung an einen Autounfall. Beide Romane teilen Ähnlichkeiten in der Erzählperspektive und der Thematisierung von Erinnerungen aus dem Sexualleben, dem familiären Hintergrund und dem Alltag.
Welche feministischen Aspekte werden in der Arbeit hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die feministischen Aspekte in den Romanen hervor, indem sie die Kritik an der klassischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und den Druck auf Frauen bezüglich Schönheitsidealen untersucht. Die detaillierte Schilderung von Körperausscheidungen und mangelnder Hygiene wird von einem Teil der Rezeption als Befreiungsschlag der modernen Frau und als neue feministische Bewegung interpretiert.
Wie wird die Rezeption der Romane in der Öffentlichkeit dargestellt?
Die Veröffentlichung von „Feuchtgebiete“ führte zu einer heftigen Debatte über Perversion und Tabubrüche. Die Arbeit differenziert die kritische Rezeption und beleuchtet unterschiedliche Interpretationen der feministischen Aussagekraft des Buches. Der enorme kommerzielle Erfolg beider Romane wird im Kontext der öffentlichen Wahrnehmung der Autorin und dem autobiographischen Anteil der Bücher diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Tina Hellwig (Autor:in), 2011, Schönheitsvorstellungen in den Romanen „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“ von Charlotte Roche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202480