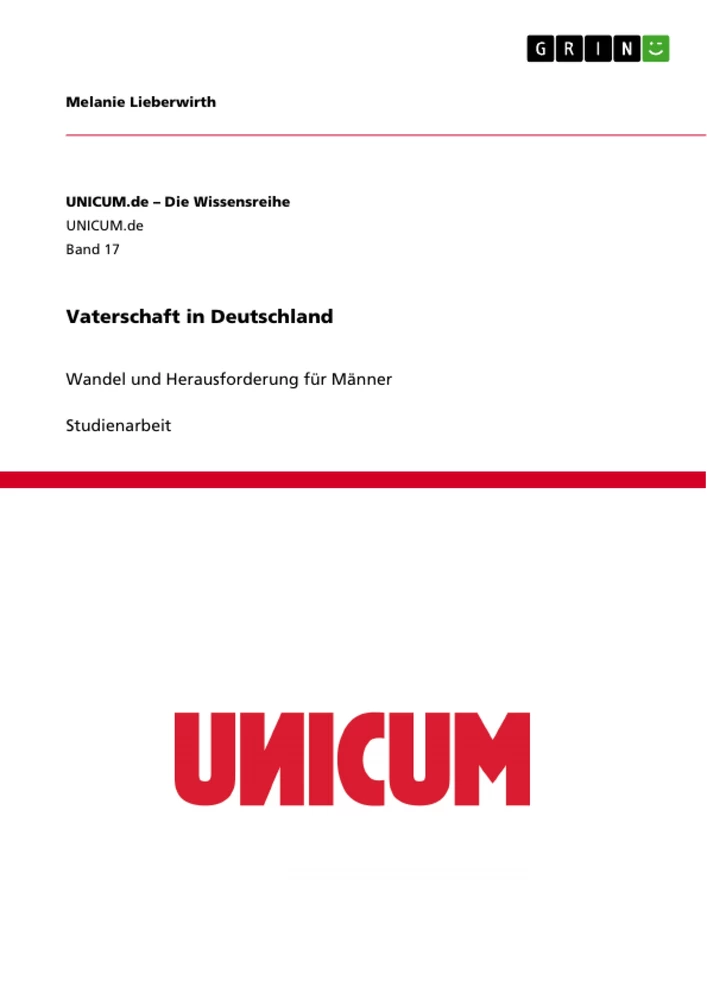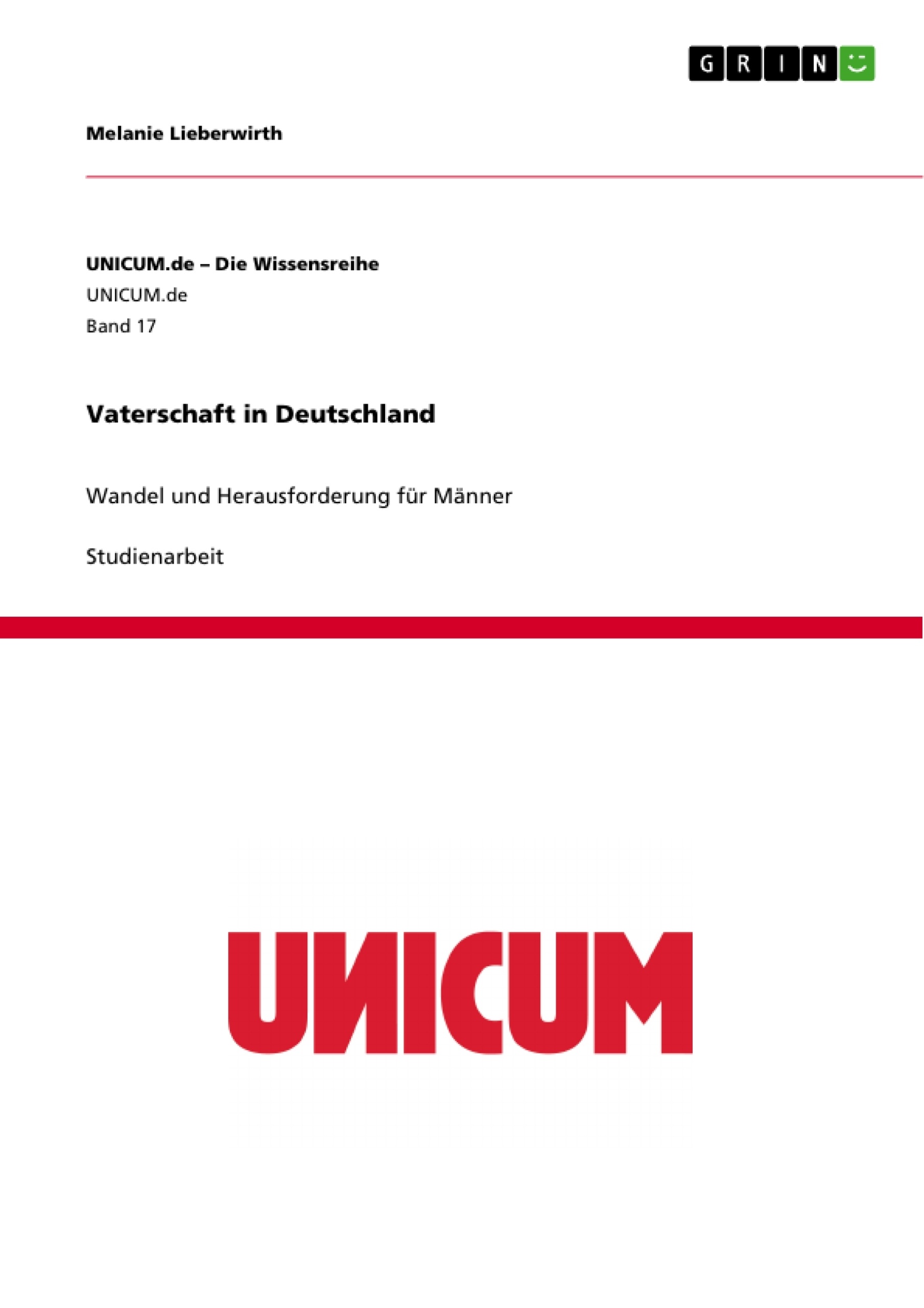Seit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 zeichnet sich in Deutschland ein neuer Trend ab: Immer mehr Männer gehen in Elternzeit und nehmen die Chance wahr, sich in der Kindererziehung und -betreuung zu engagieren. Diese Entwicklung weg vom Versorger hin zum engagierten Vater liegt in der Wandlung von Werten und Wünschen der Männer begründet. Die jüngere Generation der (werdenden) Väter hat den Anspruch, ein Familienmitglied zu sein und nicht nur eine „Randfigur“ des familiären Geschehens. Sie möchten ihre Kinder aufwachsen sehen sowie Aufgaben in der Pflege, in der Betreuung und im Haushalt übernehmen. Natürlich kommt dieser Sinneswandel nicht von alleine, denn durch die wirtschaftliche Lage bildete sich die Notwendigkeit heraus, dass beide Elternteile arbeiten gehen müssen, um eine Familie sicher finanzieren zu können. Immer mehr Frauen möchten ebenso arbeiten, wie ihr Partner und können deshalb nicht mehr alleine verantwortlich für den Haushalt und die Kinder sein - sie brauchen in allen Bereichen Unterstützung durch den Vater. Zudem hat die jetzige Generation junger Männer selbst die Erfahrung von abwesenden Vätern gemacht, da diese sich um den Familienunterhalt kümmern mussten. Die neuen Väter wollen es anders, „besser“, machen und ihren Kindern ein liebevoller, verantwortungsvoller Vater sein. Aber auch die Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschung (z.B. Fthenakis ) tragen dazu bei, engagierte Väter heranzubilden. Es wird nämlich immer deutlicher, dass Kinder ihren Vater brauchen: er ist eine sinnvolle Ergänzung zu der Mutter (Fthenakis: 1985: 320ff). Er kann den Kindern Dinge vermitteln, die die Mutter aufgrund ihres Wesens und ihrer Biologie nicht kann (oder möchte). Das Fehlen eines Vaters führt zu Störungen in der sozio-ökonomischen Entwicklung des Kindes (Fthenakis: 1985: 370ff).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was macht einen Vater aus?
- Verschiedene Vatertypen
- Der traditionelle Vater
- Der „Präsente Vater"
- „Präsente Väter" und das Vereinbarkeitsproblem
- Ausblick auf die Vaterschaft von Morgen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Vaterschaft in Deutschland und den damit verbundenen Herausforderungen für Männer. Sie analysiert die Entwicklung vom traditionellen Versorger hin zum engagierten Vater und beleuchtet die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung des Kindes. Darüber hinaus werden die Problematiken der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter diskutiert und Lösungsansätze für eine zukunftsfähige Vaterschaft vorgestellt.
- Die Rolle des Vaters in der Entwicklung des Kindes
- Der Wandel vom traditionellen Vater zum „Präsenten Vater"
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter
- Die Herausforderungen und Chancen der modernen Vaterschaft
- Die Bedeutung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Vaterschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den aktuellen Trend zunehmender Väterbeteiligung in der Kindererziehung und -betreuung. Die Entwicklung vom Versorger hin zum engagierten Vater wird mit dem Wandel von Werten und Wünschen der Männer sowie der Notwendigkeit der Doppelverdiener-Familie begründet. Die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung des Kindes wird anhand von Forschungsergebnissen unterstrichen, die auf die positive Wirkung eines aktiven Vaters auf die sozio-ökonomische Entwicklung des Kindes hinweisen.
Im zweiten Kapitel wird die Frage „Was macht einen Vater aus?" erörtert. Die spezifischen Aufgaben und Positionen des Vaters in der Eltern-Kind-Triade werden beleuchtet, wobei die traditionelle Rolle des Vaters als Autoritätsperson und die zunehmende Anerkennung seiner Bedeutung für die Entwicklung des Kindes hervorgehoben werden. Die drei grundlegenden Funktionen des Vaters als Förderer der Sozialisation, Lehrer und Bezugsperson werden anhand von Jean Le Camus' Ausführungen erläutert.
Das dritte Kapitel beleuchtet verschiedene Vatertypen, die von Jean Le Camus in seinem Buch „Vater sein heute" beschrieben werden. Der Fokus liegt dabei auf dem traditionellen Vater und dem „Präsenten Vater" als zwei gegensätzlichen Typen. Der traditionelle Vater wird als Repräsentant des Gesetzes und der Autorität dargestellt, während der „Präsente Vater" für Engagement, Verfügbarkeit und Teilnahmsfähigkeit steht.
Im vierten Kapitel wird die Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für „Präsente Väter" diskutiert. Die Herausforderungen, die sich aus der neuen Form der Vaterschaft für die Wirtschaft und die Gesellschaft ergeben, werden beleuchtet. Die Ungleichheit der Geschlechterrollen in der Arbeitswelt und die mangelnde Familienfreundlichkeit vieler Unternehmen werden als Hemmnisse für die aktive Vaterschaft identifiziert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Vaterschaft, den Wandel der Geschlechterrollen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung des Kindes, die Herausforderungen der modernen Vaterschaft sowie die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Vaterschaft. Der Text beleuchtet die Entwicklung vom traditionellen Versorger hin zum engagierten Vater und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für Männer in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Rolle der Väter in Deutschland seit 2007 verändert?
Seit der Einführung des Elterngeldes nehmen immer mehr Männer Elternzeit wahr. Es findet ein Wandel vom reinen "Versorger" hin zum engagierten, "präsenten" Vater statt.
Warum wollen moderne Väter präsenter sein?
Gründe sind veränderte Werte, der Wunsch, die Kinder aufwachsen zu sehen, sowie die wirtschaftliche Notwendigkeit, dass beide Elternteile arbeiten gehen (Doppelverdiener-Modell).
Welche Bedeutung hat der Vater für die Entwicklung des Kindes?
Forschungsergebnisse zeigen, dass Väter eine wichtige Ergänzung zur Mutter sind. Ihr Fehlen kann zu Störungen in der sozio-ökonomischen Entwicklung des Kindes führen.
Was sind die Vatertypen nach Jean Le Camus?
Le Camus unterscheidet unter anderem zwischen dem "traditionellen Vater" (Autoritätsperson) und dem "präsenten Vater" (Engagement, emotionale Verfügbarkeit).
Welches Problem haben präsente Väter in der Arbeitswelt?
Das Hauptproblem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da viele Unternehmen noch immer auf traditionelle Rollenbilder fixiert sind und wenig Flexibilität für engagierte Väter bieten.
- Citar trabajo
- Melanie Lieberwirth (Autor), 2011, Vaterschaft in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202582