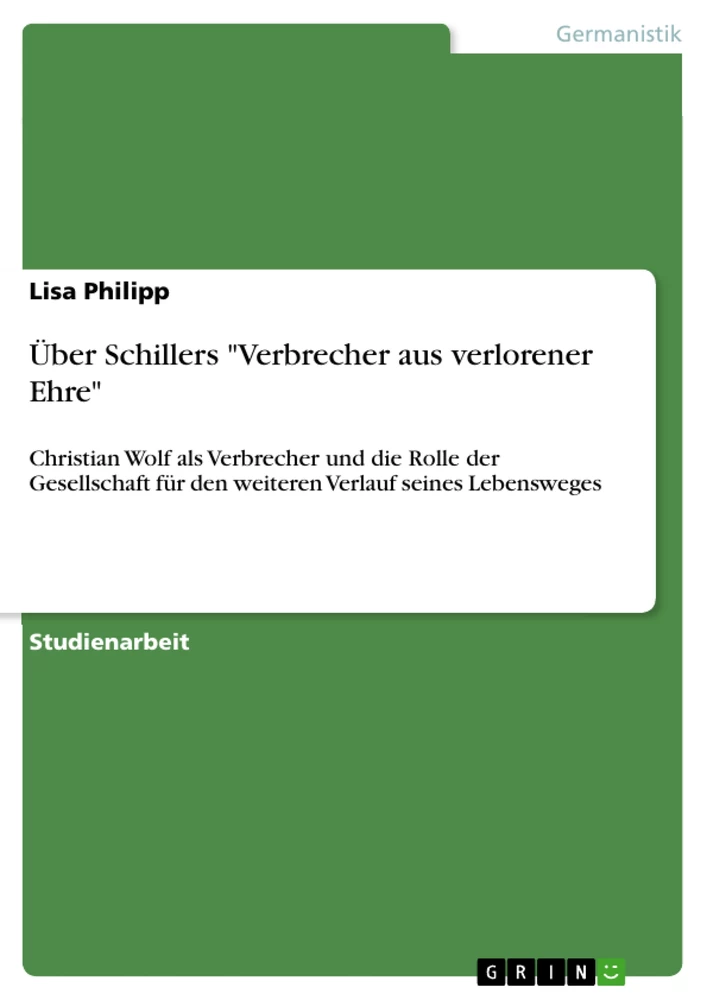1.Einleitung:
Die 1786 im zweiten Heft der Thalia zuerst anonym erschienene Novelle mit dem Titel „Verbrecher aus Infamie. Eine wahre Geschichte“ eröffnet in Deutschland die „Tradition der Kriminalgeschichte“. Der heutige Titel „ Verbrecher aus verlorener Ehre“ stammt aus dem Jahre 1792 und erschien erstmals in dieser Ausführung in Schillers Sammlung „Kleinere prosaische Schriften“.
In dieser Hausarbeit behandle ich die Novelle „Verbrecher aus verlorener Ehre“ von Friedrich Schiller, dabei wird es in erster Linie darum gehen, die Intention des Autors zu behandeln. Ich konzentriere mich dabei auf den literarhistorischen Zusammenhang, versuche letztlich den Stellenwert der Novelle in der Literatur und dessen Gattungsrelevanz zu verdeutlichen, ebenfalls werde ich vereinzelt auf die für die Bearbeitung meiner Fragestellung relevanten biographischen Aspekte Schillers eingehen. Letztlich werde ich der Frage der Schuld des Protagonisten Christian Wolf nachgehen und in diesem Zusammenhang sowohl die Problematik des Ehrverlusts und des scheiternden Integrationsversuches als auch den Stellenwert und das Mitwirken der Gesellschaft für Christian Wolfs Schicksal analysieren. Außer Acht lasse ich jedoch eine detaillierte Nacherzählung des Inhalts, da jene in solchem Maße für die Bearbeitung meiner Fragestellung nicht von Bedeutung ist.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung:
2 Kontext der Entstehung des „Verbrechers aus verlorener Ehre“:
2.1 Die Beweggründe Schillers
2.2 Real-historischer Bezug:
2.3 Gattung:
3 Psychologisierung Christian Wolfs
3.1 Der Stellenwert der Gesellschaft für den Werdegang Christian Wolfs
3.2 Ist Christian Wolf schuldig?
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Schillers Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre"?
Die Erzählung handelt vom sozialen Abstieg Christian Wolfs, der durch Kränkungen und Ausgrenzung zum Mörder wird, und thematisiert die Mitschuld der Gesellschaft.
Welche Rolle spielt der Begriff "Ehre" im Werk?
Der Verlust der bürgerlichen Ehre ist der zentrale Auslöser für Wolfs kriminelle Laufbahn, da ihm nach seiner Haftstrafe jede Rückkehr in die Gesellschaft verwehrt bleibt.
Ist Christian Wolf laut Schiller allein schuldig?
Schiller psychologisiert den Täter und zeigt auf, dass die unerbittliche Reaktion der Umwelt den Protagonisten förmlich in das Verbrechen hineintreibt.
Was ist der real-historische Hintergrund der Geschichte?
Die Geschichte basiert auf dem Fall des Sonnenwirts Friedrich Schwan, dessen Leben Schiller als Vorlage für seine psychologische Studie diente.
Welche literarische Bedeutung hat das Werk?
Es gilt als Begründung der Tradition der deutschen Kriminalgeschichte und als wichtiges Beispiel für die psychologische Prosa der Aufklärung.
- Quote paper
- Lisa Philipp (Author), 2009, Über Schillers "Verbrecher aus verlorener Ehre", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202624