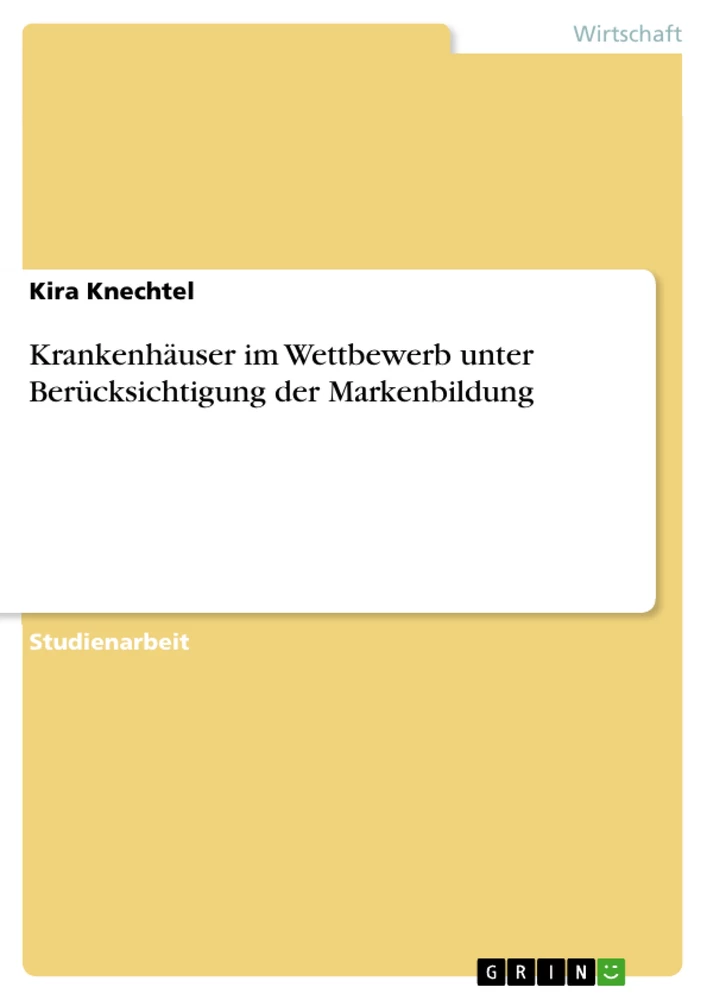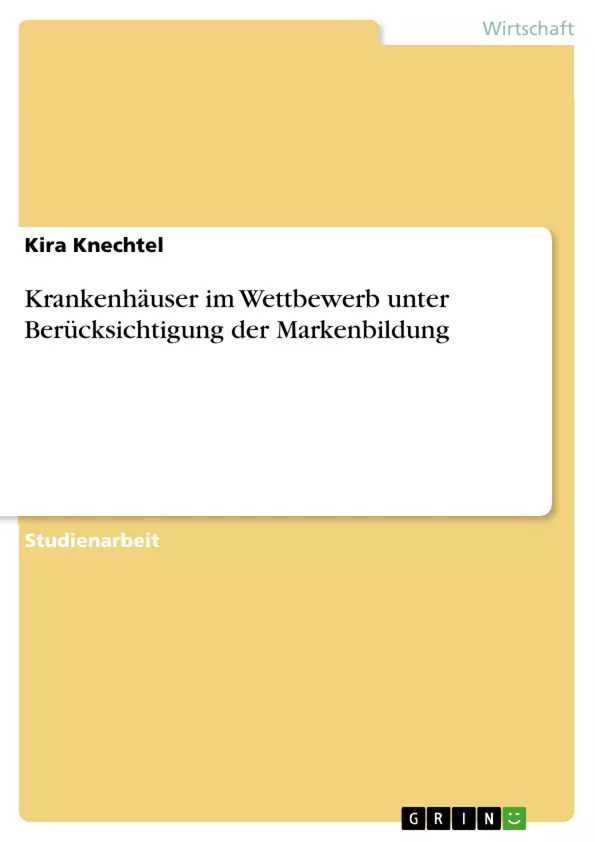Krankenhäuser haben sich im Zuge der letzten Jahrzehnte zu kostenintensiven Institutionen für das Gesundheitswesen entwickelt. Rund ein Drittel aller Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung entfallen auf den deutschen Krankenhausmarkt (vgl. Haseborg, Zastrau 2008, S. 237). In der Vergangenheit waren gute, leistungsstarke Krankenhäuser immer voll ausgelastet und kämpften eher mit langen Wartezeiten als mit einem Mangel an Patienten. Im Vordergrund des eigenen Handelns stand einzig und allein die Sorge um den Patienten sowie die Weiterentwicklung der ärztlichen Heilkunst. Es blieb weder Zeit für ein aktives Werben um den einzelnen Patienten, noch bestand die Notwendigkeit bei einem vollen Wartezimmer (vgl. Safeld, et al. 2009, S. 129). Durch die neue Krankenhausfinanzierung 2005 und die damit verbundene Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) ist der Konkurrenzdruck der Krankenhäuser weiter angestiegen (vgl. Klimpe 2002, S. 119). Somit ist es nicht nur möglich, sondern sogar politisch erwünscht, dass Leistungsvolumen eines Krankenhauses auf qualitativ hochwertige Behandlungen auszudehnen (vgl. Safeld, et al. 2009, S. 129). Dies erfordert eine Umstrukturierung der Krankenhäuser hin zu mehr Wettbewerb mit seinen Instrumenten. Daraus ergeben sich verschieden Fragen: Ist das Krankenhaus in der heutigen Zeit ein Unternehmen? Befindet sich der Gesundheitssektor auf einem Markt? (vgl. Bär 2012, online). Bringt die Einführung von Marken dem Krankenhaus einen Nutzen und werden Nachteile auf Kosten der Patienten in Kauf genommen, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben? Fest steht, dass die Krankenhäuser sich im Wettbewerb um Patienten an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen, um bestehen zu können.
In der Ausarbeitung soll geprüft werden, in wie weit die Einführung von Marken im Krankenhaus den Wettbewerb von Krankenhäusern beeinflusst. Hierzu werden die Vor- und Nachteile herausgearbeitet, um dann kritisch Stellung zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition Marke
- 2.2 Definition Krankenhausmarke
- 3 Krankenhäuser im Wettbewerb — Relevanz der Thematik
- 4 Markenbildung im Krankenhaus
- 4.1 Vorteile einer Marke aus Sicht der Patienten
- 4.2 Vorteile einer Marke aus Sicht der Einweiser
- 4.3 Vorteile einer Marke aus Sicht des Krankenhauses
- 5 Diskussion und Kritik
- 6 Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Markenbildung im Krankenhaussektor und analysiert deren Einfluss auf den Wettbewerb zwischen Krankenhäusern. Die Arbeit zielt darauf ab, die Vor- und Nachteile der Einführung von Marken im Krankenhauswesen zu untersuchen und eine kritische Bewertung der Relevanz von Marken im Gesundheitswesen zu liefern.
- Definition und Bedeutung von Marken im Gesundheitswesen
- Wettbewerbsbedingungen im Krankenhaussektor
- Vorteile einer Marke aus Sicht der Patienten, Einweiser und des Krankenhauses
- Kritik an der Einführung von Marken im Krankenhaus
- Fazit und Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Markenbildung im Krankenhaus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit beleuchtet die Problemstellung der Markenbildung im Krankenhaus. Es wird der Wandel des Krankenhauswesens von einer traditionellen, patientenorientierten Institution hin zu einem wettbewerbsorientierten Unternehmen dargestellt. Die Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) im Jahr 2005 hat den Konkurrenzdruck zwischen Krankenhäusern erhöht und die Notwendigkeit eines unternehmerischen Denkens im Gesundheitswesen hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Markenbildung erläutert. Es werden verschiedene Definitionen des Markenbegriffs vorgestellt und der Schwerpunkt auf den wirkungsorientierten Ansatz gelegt, der die Marke aus der Perspektive des Konsumenten betrachtet. Der Begriff der „Krankenhausmarke" wird definiert und die verschiedenen Arten von Marken im Krankenhaussektor (Einzel-, Familien- und Dachmarken) werden vorgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Relevanz des Wettbewerbs im Krankenhaussektor. Es wird der Wandel von traditionellen, monopolischen Strukturen hin zu wettbewerbsorientierten Märkten dargestellt. Die Einführung des DRG-Systems hat die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern in den Vordergrund gerückt und den Druck auf die Leistungserbringer erhöht, sich am Markt zu behaupten.
Das vierte Kapitel analysiert die Vorteile der Markenbildung im Krankenhaus aus Sicht der Patienten, Einweiser und des Krankenhauses selbst. Es wird gezeigt, dass eine Marke für Patienten Orientierung und Vertrauen schafft, die Entscheidungsfindung erleichtert und den Informationsdefizit im Gesundheitswesen entgegenwirkt. Für Einweiser bietet eine Marke eine klare Positionierung des Krankenhauses und erleichtert die Zusammenarbeit. Für das Krankenhaus selbst ermöglicht eine Marke eine Differenzierung von Wettbewerbern, den Aufbau eines treuen Patientenstamms und eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit.
Das fünfte Kapitel diskutiert die Kritik an der Einführung von Marken im Krankenhaus. Gegner der Markenbildung im Gesundheitswesen argumentieren, dass Krankenhäuser keine markt- oder wettbewerbsorientierten Unternehmen sind und dass die Einführung von Marken zu einer Zweiklassenmedizin führen könnte. Es werden die Nachteile der Markenbildung wie die hohen Investitionskosten, die lange Etablierungszeit und die potenziellen Akzeptanzprobleme beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Markenbildung, Krankenhaus, Wettbewerb, Gesundheitswesen, Patienten, Einweiser, Wirtschaftlichkeit, DRG, Qualitätsmanagement, Informationsasymmetrie, Zweiklassenmedizin.
- Citar trabajo
- Kira Knechtel (Autor), 2012, Krankenhäuser im Wettbewerb unter Berücksichtigung der Markenbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202638