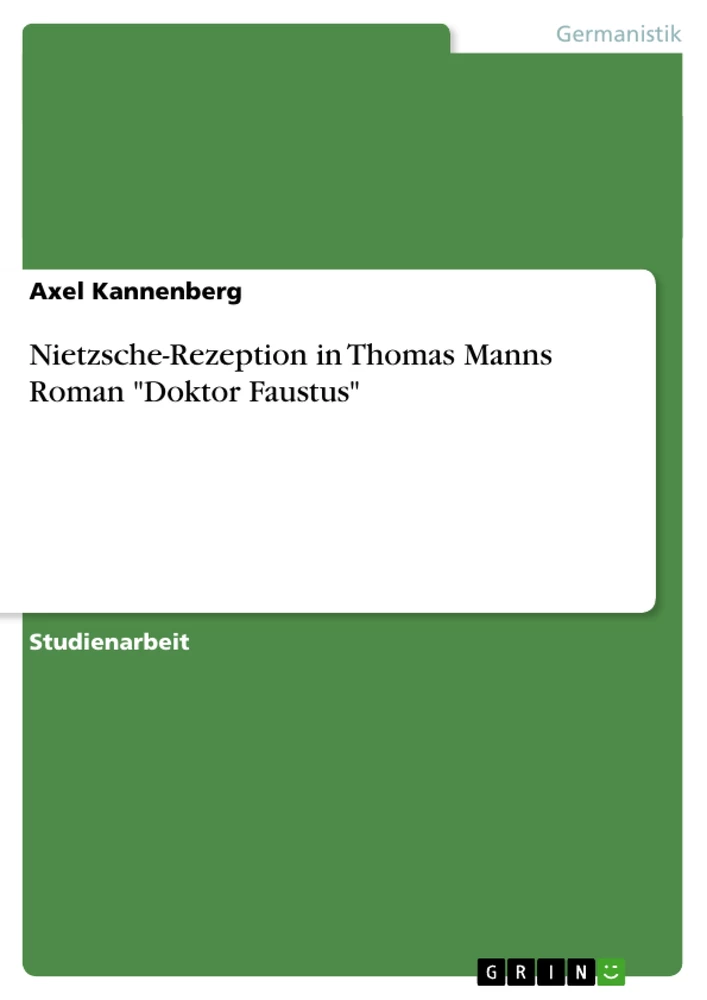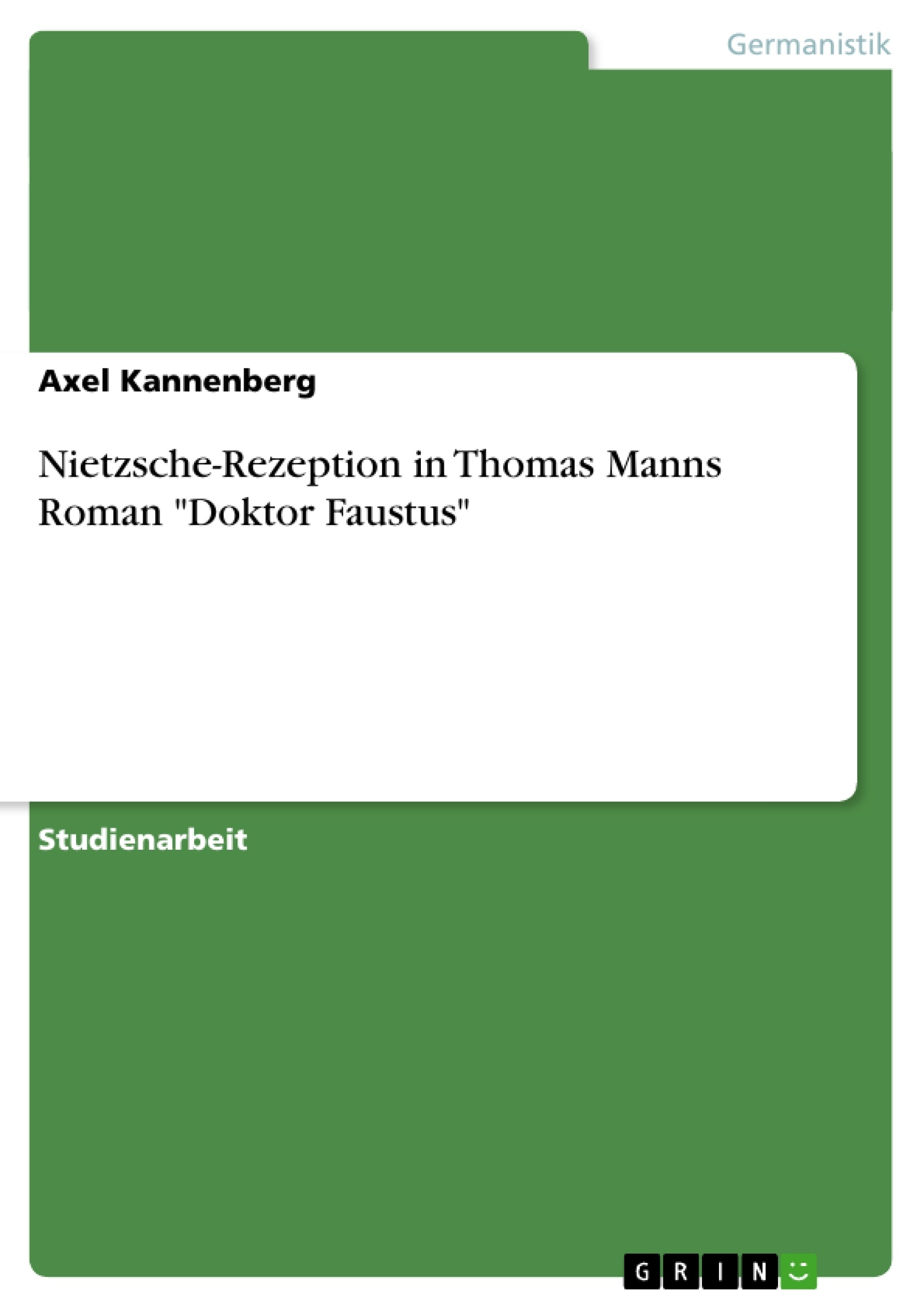Einleitung
Thomas Manns Roman ‚Doktor Faustus′ aufmerksam zu lesen, heißt: Standpunkt beziehen. Wie bei der berühmten Kippfigur Wittgensteins hängt es von unserem Blickwinkel ab, was wir erkennen, den Hasen oder die Ente. Das heißt in diesem Fall: Unser Vorwissen und unseren Interessen bestimmen, welche Verweise, Motive und Sinnzusammenhänge wir hinter der fiktiven Biographie erkennen, die uns erzählt wird von einem Chronisten, der vorgibt, wenig kompetent zu sein. Man mag nun einwenden, dass eigentlich jeder Lesevorgang eine Projektion von bestimmter Perspektive aus ist. Das ist richtig; aber nicht jedes Werk macht die perspektivische Brechung zu seinem ureigenen Grundsatz. Im ‚Doktor Faustus′ ist dies der Fall. Denn Vielschichtigkeit ist Strukturprinzip in diesem Roman: Schon der Versuch, ihn einer Gattung zuzuordnen, bereitet Schwierigkeiten. Ist es ein Zeitroman, ein Deutschlandroman, ein Künstlerroman oder vielleicht eher ein Bildungsroman? Diese unerschöpfliche Frage wird hier nicht beantwortet; eingegrenzter Standpunkt dieser Arbeit soll vielmehr sein: Nietzsche. Es soll den zahlreichen Anspielungen auf Nietzsche nachgegangen werden. Worauf genau wird angespielt? In welcher Weise? Wo kommen die Anspielungen vor? Welche Funktion erfüllen sie? Es wird sich dabei im Laufe der Untersuchung zeigen, dass Nietzsche sowohl bio-graphisch wie auch philosophisch rezipiert wird. Sein Leben ist Vorbild für Figuren des Romans und sein perspektivisches Denken eng eingewoben in die ambivalente Struktur des Romans. Ist ‚Doktor Faustus′ also in erster Linie ein Nietzsche-Roman? Ja. So wie der Hase in erster Linie eine Ente ist.
Inhaltsverzeichnis
- Präambel
- Einleitung
- Nietzsche von der ersten Seite an
- Biographische Anspielungen
- Zeitblom
- Leverkühn
- Die Experimente des Jonathan Leverkühn
- Vererbungsmotiv
- Chladnische Figuren
- Die Art der Anspielung
- Die Bordell-Episode
- Motivzusammenhang
- Nietzsche-Bezug
- Der archaische Stil
- Das Teufelsgespräch
- Wahn oder Wirklichkeit
- Der Perspektivismus der Teufels
- Ecce homo
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption Nietzsches im Roman „Doktor Faustus“ von Thomas Mann. Sie untersucht die zahlreichen Anspielungen auf Nietzsches Philosophie und Biographie im Roman, um deren Funktion und Bedeutung für die Gestaltung der Figuren und die Struktur des Werkes zu analysieren.
- Biographische Anspielungen auf Nietzsches Leben und Werk
- Rezeption von Nietzsches Philosophie im Roman, insbesondere die Themen Vererbung, Perspektivismus und „Ecce Homo“
- Die ambivalente Beziehung zwischen Fiktion und Realität im Roman und die Rolle des Erzählers Serenus Zeitblom
- Die Funktion der Anspielungen auf Nietzsche für die Charakterisierung der Figuren Adrian Leverkühn und Serenus Zeitblom
- Die Beziehung zwischen Nietzsches Gedanken und der musikalischen Komposition Leverkühns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem kurzen Überblick über die Rezeption Nietzsches bei Thomas Mann. Anschließend wird untersucht, wie Nietzsche bereits in der ersten Seite des Romans „Doktor Faustus“ durch ein verdecktes Zitat aus einem Gedicht von Stefan George eingebunden wird.
Im dritten Kapitel werden biographische Anspielungen auf Nietzsche im Roman analysiert, die sich sowohl auf die Figur Adrian Leverkühn als auch auf dessen Biographen Serenus Zeitblom beziehen. Es wird aufgezeigt, dass Zeitblom in seiner Persönlichkeit und seinem Lebensweg einige Parallelen zu Nietzsche aufweist.
Kapitel 4 analysiert die „Experimente“ des Jonathan Leverkühn, die in Bezug zu Nietzsches Philosophie gesetzt werden. Die Kapitel 5 und 6 befasst sich mit der Bordell-Episode und dem Teufelsgespräch, die beide wichtige Aspekte von Nietzsches Gedankenwelt aufgreifen.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Doktor Faustus, Nietzsche, Rezeption, Anspielung, Biographie, Philosophie, Perspektivismus, Ecce homo, Vererbung, Musik, Bildungsbürgertum, Zeitroman, Künstlerroman.
Häufig gestellte Fragen
In welcher Weise wird Nietzsche im Roman „Doktor Faustus“ rezipiert?
Nietzsche wird sowohl biographisch als auch philosophisch rezipiert. Sein Leben dient als Vorbild für Romanfiguren, und sein Denken, insbesondere der Perspektivismus, ist tief in die Struktur des Werkes eingewoben.
Welche Parallelen gibt es zwischen Adrian Leverkühn und Nietzsche?
Die Arbeit untersucht biographische Anspielungen, die sich unter anderem in der Krankheitsgeschichte und bestimmten Lebensstationen Leverkühns widerspiegeln, die eng an Nietzsches Vita angelehnt sind.
Welche Rolle spielt der Erzähler Serenus Zeitblom bei der Nietzsche-Rezeption?
Zeitblom fungiert als Chronist, dessen eigene Persönlichkeit und Perspektive ebenfalls Bezüge zu Nietzsche aufweisen, was die Vielschichtigkeit der Rezeption im Roman erhöht.
Was hat das „Teufelsgespräch“ im Roman mit Nietzsche zu tun?
Das Teufelsgespräch greift zentrale philosophische Themen Nietzsches auf, wie den Perspektivismus und Motive aus „Ecce homo“, und verknüpft diese mit der tragischen Künstlerbiographie Leverkühns.
Ist „Doktor Faustus“ ein Nietzsche-Roman?
Die Arbeit bejaht dies in dem Sinne, dass Nietzsche ein strukturgebendes Element des Romans ist, wobei die Vielschichtigkeit des Werkes auch andere Gattungszuordnungen (Zeitroman, Deutschlandroman) zulässt.
- Citar trabajo
- Axel Kannenberg (Autor), 2003, Nietzsche-Rezeption in Thomas Manns Roman "Doktor Faustus", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20263