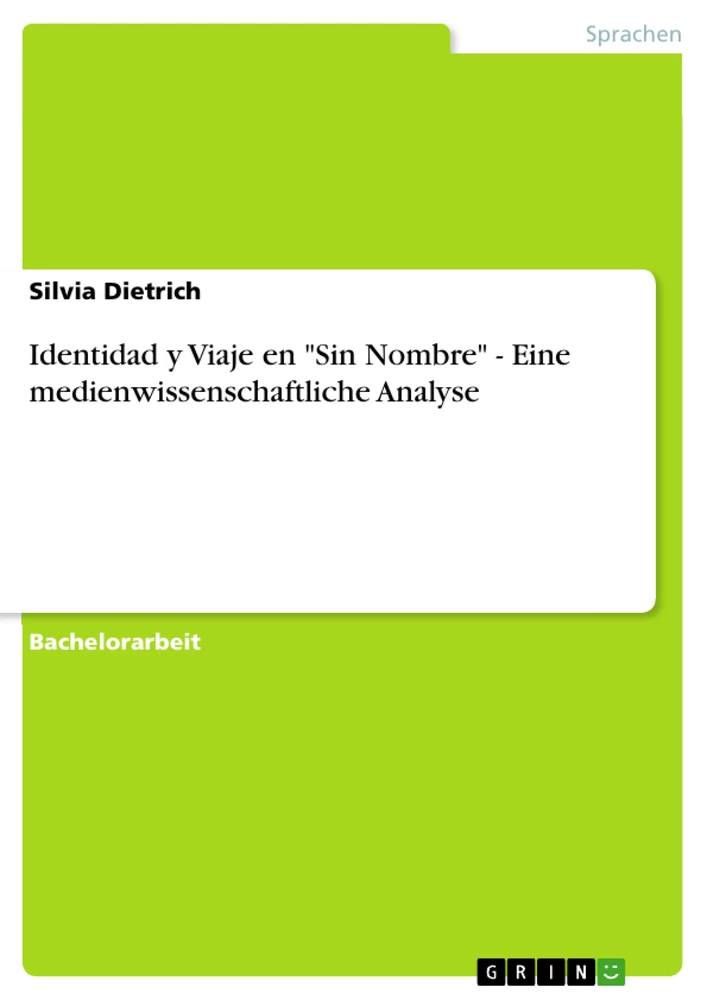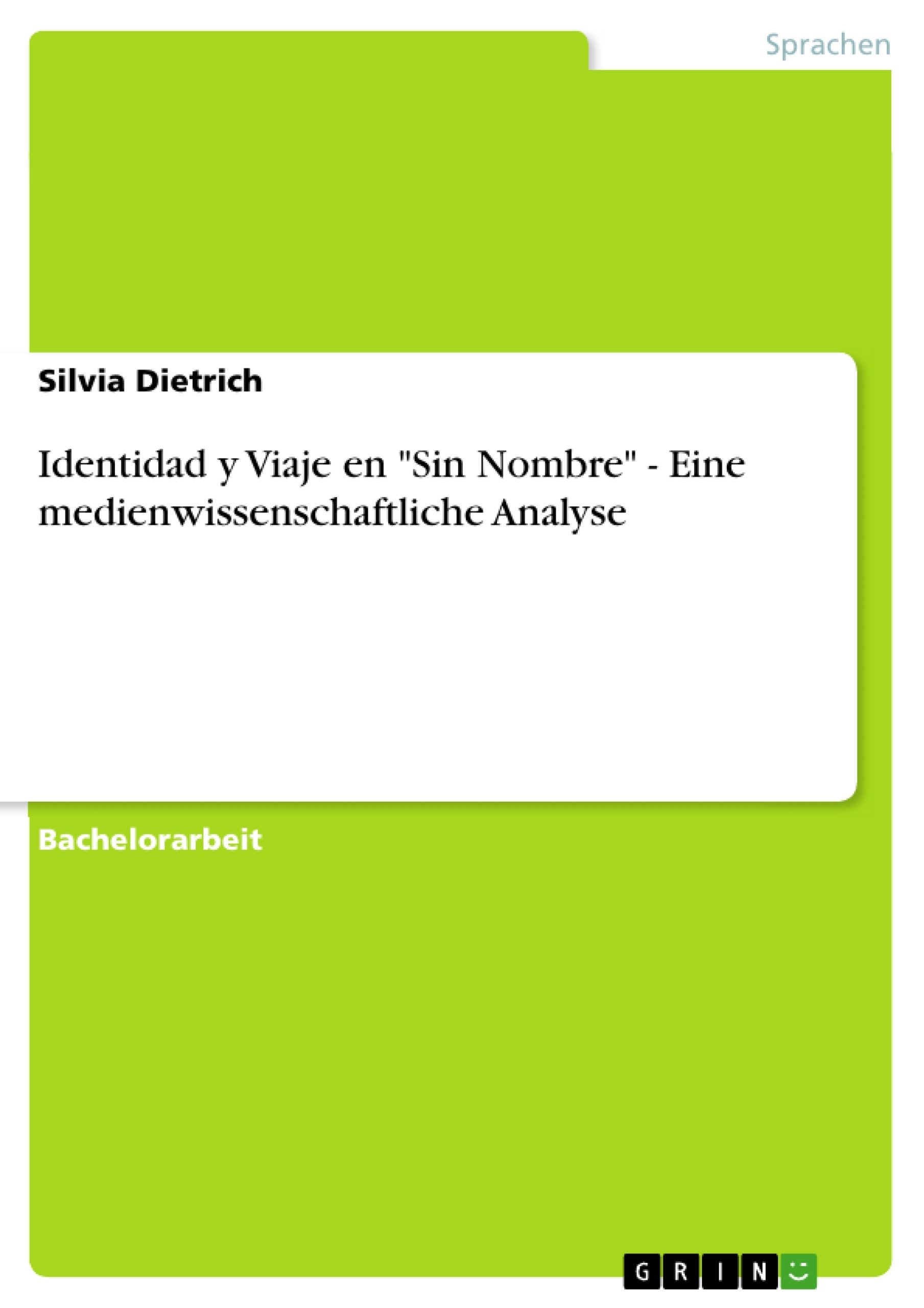Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Analyse des Filmes Sin Nombre von Gary Fukunaga aus dem Jahr 2009. Der Film wurde größtenteils in Mexiko mit unbekannten SchauspielerInnen und einer mexikanisch- amerikanischen Produktion gedreht.
Zu Beginn möchte ich mit einer Zusammenfassung des Inhaltes und mit Hintergrundinformationen zu den beiden Themen Mara Salvatrucha und Migrationsflucht in die USA einen Überblick geben. Darauf folgt eine Einführung in das Genre Roadmovie, um die wichtigsten Punkte des Genres vorzustellen, da die Analyse immer wieder auf die Elemente des Roadmovies zurückgreifen wird. Einen großen Teil der Arbeit stellt als nächstes die Filmanalyse dar. Sie soll Themen wie die Handlung, die Erzählung, die Figuren und die Bauformen aufgreifen und näher beschreiben. Die inhaltlichen Elemente eines Roadmovies werden in einem eigenen Kapitel verarbeitet. Nach der ausführlichen Filmanalyse sollen noch einmal die wichtigsten Bestandteile des Roadmovies zusammengefasst werden und es soll eruiert werden, ob der Film überhaupt geeignet ist dem Genre Roadmovie zugeschrieben zu werden.
Im Anhang finden sich einerseits zwei Protokolle, die für die Analyse des Filmes sehr hilfreich und fast unverzichtbar waren. Während das Szenen- und Sequenzprotokoll einen Überblick über den Ablauf des gesamten Filmes gibt, so bezieht sich das Einstellungsprotokoll „Schwellensituation“ lediglich auf eine Sequenz. Wie der Name schon verrät enthält das Protokoll eine genaue Analyse der Schwellensituation des Willy.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Inhaltliche Zusammenfassung
3 Hintergrundinformationen
3.1 Mara Salvatrucha
3.2 Migrationsflucht in die USA
4 Genre Roadmovie
5 Filmanalyse
5.1 Handlungs- und Erzählanalyse
5.1.1 Szenen und Sequenzen
5.1.2 Handlungsstränge und Handlungsphasen
5.1.3 Perspektiven und Darbietungen des Erzählens
5.1.4 Zeitgestaltung
5.2 Figurenanalyse
5.2.1 Figurenkonstellationen
5.2.2 Sayra
5.2.3 El Caspar und Willy
5.2.4 Benito und El Smiley
5.3 Inhaltliche Elemente des Roadmovies
5.3.1 Aufbruch und Schwellensituation
5.3.2 The Road
5.3.3 Vehikel
5.3.4 Stationen, Passagen
5.3.5 Transgressionen - Grenzüberschreitungen
5.3.6 Begegnung mit dem Fremden
5.3.7 Art der Reise
5.4 Analyse der Bauformen
5.4.1 Bildinhalt und Inhalt in Bildern
5.4.2 Kamera, Einstellungen und Montage
5.4.3 Der Ton
5.4.4 Raum, Licht und Farbe
6 Sin Nombre als Roadmovie
7 Schlusswort
8 Filmographie
9 Bibliographie
10 Internetquellen
11 Anhang
11.1 Szenen- und Sequenzprotokoll
11.2 Einstellungsprotokoll „Schwellensituation“
11.3 Artikel über die Mara Salvatrucha
11.4 Artikel über Migrationsflucht
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Film „Sin Nombre“?
Der Film thematisiert die Flucht von Migranten aus Mittelamerika in die USA und das brutale Leben innerhalb der Gang Mara Salvatrucha.
Kann man „Sin Nombre“ als Roadmovie bezeichnen?
Ja, die Analyse zeigt, dass der Film klassische Elemente wie die Reise, das Vehikel (der Zug) und Grenzüberschreitungen nutzt.
Welche Rolle spielt die Mara Salvatrucha im Film?
Die Gang bildet den bedrohlichen Hintergrund für den Protagonisten Willy (Casper), der versucht, aus der Gewaltspirale auszubrechen.
Was ist eine „Schwellensituation“ in der Filmanalyse?
Es beschreibt Momente des Übergangs oder der Entscheidung, in denen Figuren ihre alte Identität hinter sich lassen und eine neue Reise beginnen.
Wie wird Zeit und Raum im Film gestaltet?
Durch Montage und Kameraführung wird die endlose, gefährliche Weite der Reise auf den Dächern von Güterzügen spürbar gemacht.
- Quote paper
- Silvia Dietrich (Author), 2011, Identidad y Viaje en "Sin Nombre" - Eine medienwissenschaftliche Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202884