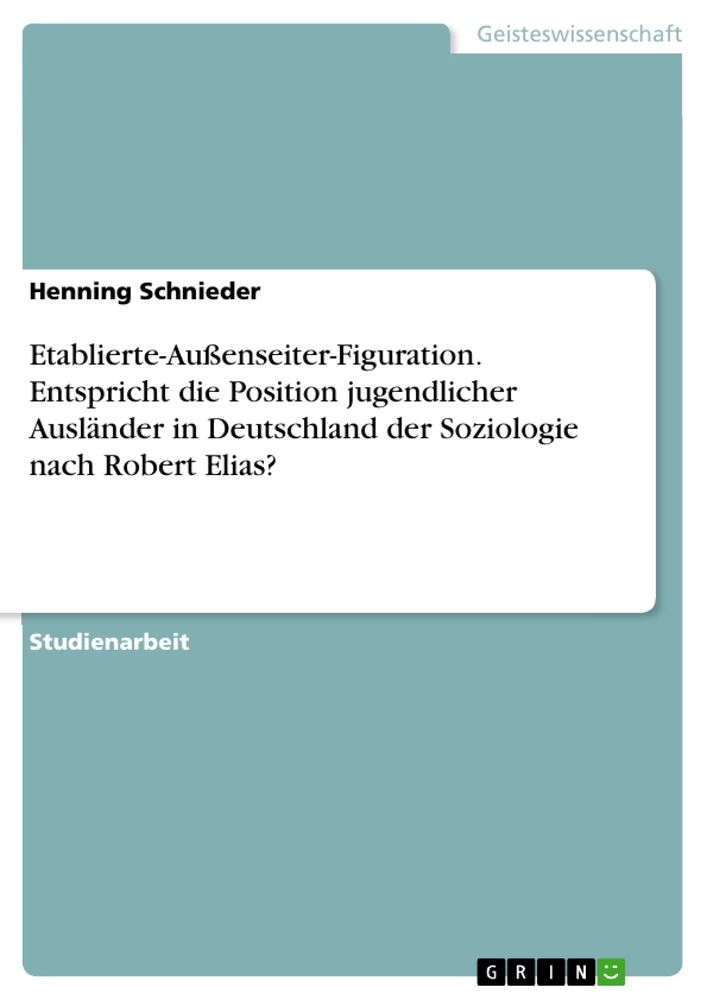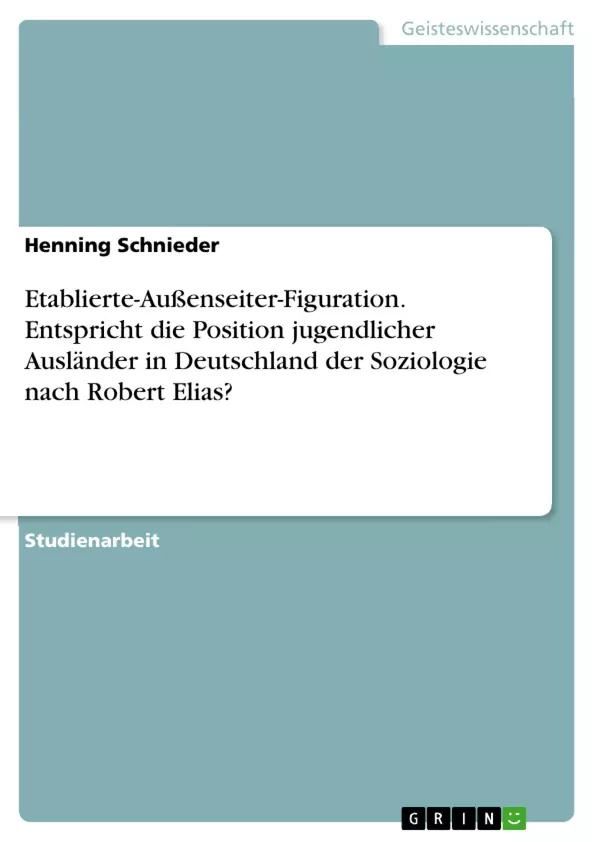Wir leben in einer Welt, in der die soziale Mobilität immer weiter zunimmt. Durch die
Globalisierung ist es den Menschen möglich, sich im Prinzip überall auf der Welt
niederzulassen. Dennoch gibt es Menschen, die aufgrund von Kriegen und Armut oder
aus wirtschaftlichen Gründen ihr Land verlassen müssen und auf der Suche nach einer
besseren Lebenssituation sind. Auf Deutschland bezogen sind hier zum Beispiel die in
den 60er und 70er Jahren angeworbenen Gastarbeiter und deren Nachkommen oder
auch die ca. 1 Millionen hier lebenden Flüchtlinge zu nennen. Überall, egal in welchem
Land, sind zugewanderte Menschen zunächst Neuankömmlinge und treffen in dem
Gastgeberland auf eine feste bestehende soziale Ordnung. Dieses verursacht in vielen
Fällen gesellschaftliche Probleme. Nicht selten sind die zugewanderten Gruppen Opfer
von Diskriminierungen und auch im Gastgeberland noch in besonderem Maße von
Armut betroffen. Als Problemgruppe wird in der Bundesrepublik von Medien, Politikern
oder Experten immer wieder die Gruppe der jugendlichen Ausländer bezeichnet. Sie
sind vor allem in den Kriminalstatistiken überrepräsentiert. Die Erklärungen hierfür sind
genauso vielfach wie die Forderungen der Politik und der Mitte der Gesellschaft nach
einem härteren Umgang mit diesen und der fehlenden Assimilierung der Jugendlichen.
Ich möchte in meiner Arbeit darlegen, dass sich jugendliche Ausländer und die
Mehrheitsgesellschaft der Deutschen in einer ganz bestimmten Positionierung bzw.
Verflechtung zueinander befinden. Um dieses zu verdeutlichen, stelle ich zunächst die
Figurationssoziologie von Norbert Elias vor. Den Begriff Figuration verwendet er das
erste Mal in seiner 1969er Ausgabe `Über den Prozess der Zivilisation`. Der Begriff
besagt, dass sich Menschen immer in Interdependenzen zu anderen Menschen befinden
und nie alleine betrachtet werden können. In diesem Zusammenhang soll erklärt werden,
was Elias unter Machtbalancen versteht und wie er seine theoretischen Schlüsse hierzu
in seine Figurationssoziologie einbindet. Im Anschluss stelle ich seine, zusammen mit
seinem Schüler John L. Scotson im Jahr 1960 durchgeführte und 1965 erschienene,
Studie mit dem Titel ´Etablierte und Außenseiter´ vor. Während der Studie wurde
beobachtet, dass sich alteingesessene Familien eines kleinen englischen Vorortes gegen
zugezogene Familien abschotteten und diese von sämtlichen wichtigen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Figurationssoziolgie von Norbert Elias
- Begriff Figuration
- Machtbalancen
- Etablierte-Aussenseiter-Studie von Norbert Elias
- Vorstellung der Studie
- Theoretischer Schluss
- Ausgrenzungsmechanismen der etablierten Deutschen
- Ein gesellschaftliches Leitbild entsteht
- Ausgewählte Ausschlussmechanismen gegenüber jugendlichen Ausländem
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich die Figuration jugendlicher Ausländer in der Mehrheitsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland auf die Etablierte-Außenseiter-Figuration nach Norbert Elias übertragen lässt. Sie analysiert die Interdependenzen zwischen diesen Gruppen und untersucht die Machtbalancen, die sich daraus ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Vorurteilen und Ausgrenzungsmechanismen, die die Integration von jugendlichen Ausländern erschweren.
- Figurationssoziologie von Norbert Elias
- Etablierte-Außenseiter-Studie von Norbert Elias
- Ausgrenzungsmechanismen gegenüber jugendlichen Ausländern in Deutschland
- Vorurteile gegenüber Ausländern in Deutschland
- Parallelen zwischen der Etablierte-Außenseiter-Figuration und der Situation jugendlicher Ausländer in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der jugendlichen Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland ein und skizziert die Problematik der Ausgrenzung und Diskriminierung. Sie stellt die Figurationssoziologie von Norbert Elias als theoretischen Rahmen für die Analyse vor.
Das zweite Kapitel erläutert die Figurationssoziologie von Norbert Elias. Es wird der Begriff Figuration definiert und die Bedeutung von Machtbalancen in menschlichen Beziehungen herausgestellt. Die Interdependenz zwischen Menschen und die Entstehung von Machtstrukturen im Rahmen von Figurationen werden erläutert.
Das dritte Kapitel stellt die Etablierte-Außenseiter-Studie von Norbert Elias vor. Die Studie untersucht die Beziehungen zwischen alteningesessenen Familien und neuzugezogenen Familien in einer englischen Gemeinde. Es wird gezeigt, wie die Etablierten die Außenseiter durch negative Stigmatisierung und Ausschluss von sozialen Positionen auf Distanz halten.
Das vierte Kapitel analysiert die Ausgrenzungsmechanismen, denen jugendliche Ausländer in Deutschland ausgesetzt sind. Es werden Vorurteile gegenüber Ausländern in Deutschland beleuchtet und verschiedene Formen der Diskriminierung im rechtlichen, schulischen und gesellschaftlichen Bereich aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Figurationssoziologie, die Etablierte-Außenseiter-Figuration, jugendliche Ausländer, Mehrheitsgesellschaft, Ausgrenzung, Diskriminierung, Vorurteile, Machtbalancen, Integration, Integrationsprobleme, Deutschland, Sozialstruktur, Bildung, Arbeitsmarkt, Kriminalität, Flüchtlinge, Gastarbeiter, Kulturkonflikt.
- Arbeit zitieren
- Henning Schnieder (Autor:in), 2011, Etablierte-Außenseiter-Figuration. Entspricht die Position jugendlicher Ausländer in Deutschland der Soziologie nach Robert Elias?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202950