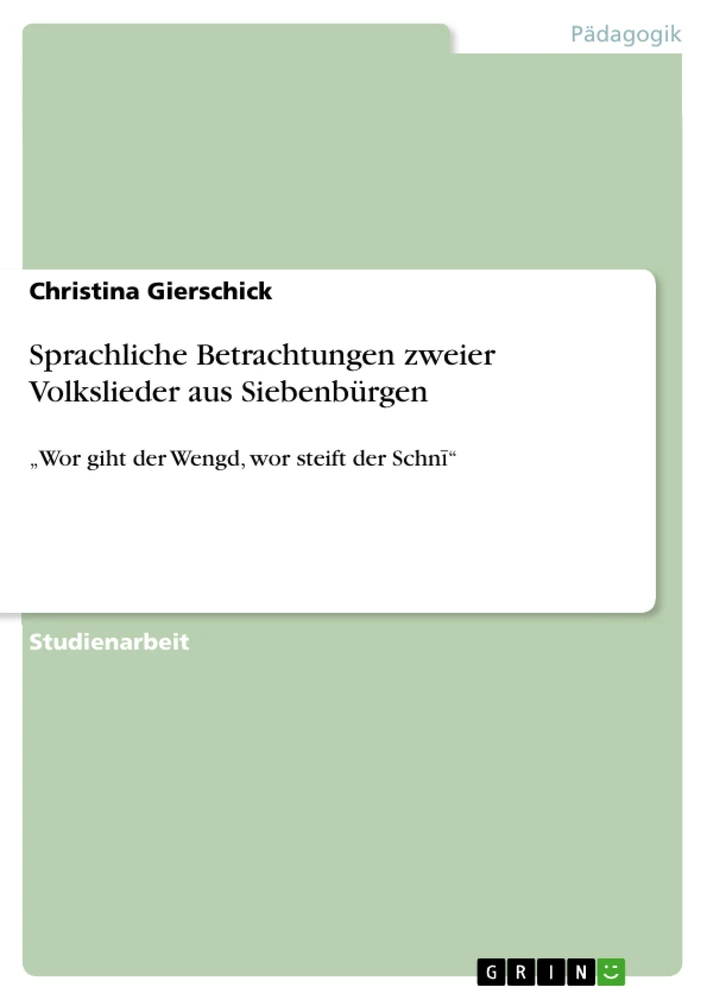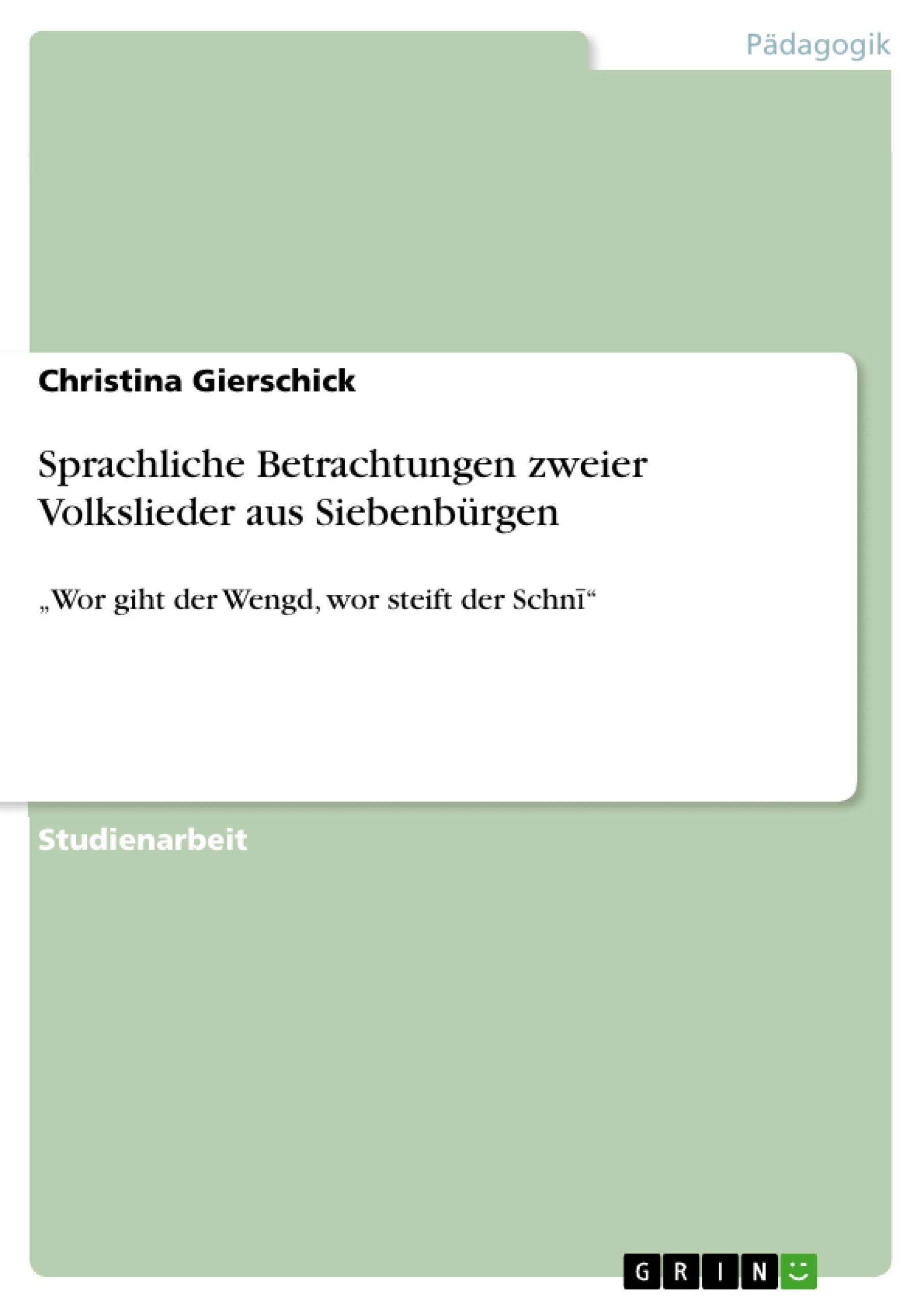Schlōf, Hani, schlōf!
De Vijel säinjen äm Hōf,
de Katze spännen af´em Hiȅrd,
de Ratze knäspern än der Ierd,
te bäst mer tousend Gälde wiȅrt,
schōf [sic], Hani, schlōf!
Dieses Kinderlied entstammt einer Zusammenstellung Siebenbürgisch-Sächsischer Volkslieder aus dem Jahr 1973 durch den Germanisten Michael Markel (1937), dessen Sammlung als „vielgelesen“ in der Siebenbürgischen Zeitung zu seinem 70. Jubiläum betitelt wird. Es solle durch die Forschungen seiner Ehefrau, der Volkskundlerin Hanni Markel (1939) zu einer produktiven Zusammenarbeit gekommen sein. Tatsächlich ist es aber so, dass eine Vielzahl jener Lieder in Deutschland kaum verbreitet sind, wenn man einmal „Es sang ein klein Waldvögelein“ außer Acht lässt. Sprachlich gesehen bieten jene Volkslieder einen Fundus siebenbürgisch-sächsischer Mundarten und ihrer Realisierung, denn das Siebenbürgisch-Sächsische eignet sich, da es ein Inseldialekt ist, auch zum tieferen Verständnis der Entwicklung der deutschen Sprache im Inland, denn die siebenbürgisch-sächsische Sprache habe mit der Hochsprache viele Wörter gemeinsam, allerdings sind diese in der Mundart einen Bedeutungswandel unterzogen bzw. haben ihren Sinngehalt erweitert. Viele Wörter, die auf das Mittelhochdeutsche zurückgehen seien im Siebenbürgisch-Sächsischen noch belegt, während diese in der deutschen Schriftsprache und aus den meisten deutschen Dialekten fast völlig bis vollkommen verschwunden seien. Neben diesen Wörtern gebe es auch Mundartwörter, die das Siebenbürgisch-Sächsische mit deutschen Mundarten gemein habe, besonders aus dem Rheinischen mit deutscher oder altromanischer Herkunft, aber mitunter auch aus dem oberdeutschen.
Anhand des Volksliedes „Das verstoßene Kind“ und „Kein Herd und kein Brot“ sollen die sprachlichen Gegebenheiten des Siebenbürgisch-Sächsischen untersucht werden. Dafür ist es zunächst einmal notwendig geschichtliche Hintergründe zur Entstehung und Ursprung der Sprache zu kennen und deren typischen Unterschiede zum Standartdeutschen zu verdeutlichen. Dabei wird sich größtenteils auf die Schriftsprache beschränkt, da das Volkslied nur in Schriftform und nicht als Aufnahme vorliegt. Des Weiteren werden die grundsätzlichen Voraussetzungen zum Erkennen und Verstehen eines Volksliedes einführend erläutert. Im Anschluss kommt es zur sprachlichen Betrachtung und Einordnung der beiden Volkslieder. Zusammenfassende und abschließende Bemerkungen, sowie Analyseprobleme bilden den Schluss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Siebenbürgisch-Sächsische
- Das Mitteldeutsche und der Oberdeutsche Sprachgebiet
- Allgemeines zur Siebenbürger-Sächsischen Sprache
- Sprachliche Betrachtung zweier Volkslieder
- Das verstoßene Kind
- Im Vergleich hierzu: Kein Herd und kein Brot
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachlichen Besonderheiten des Siebenbürgisch-Sächsischen anhand zweier Volkslieder. Ziel ist es, die sprachlichen Gegebenheiten dieser Mundart aufzuzeigen und ihre Unterschiede zum Standarddeutschen zu verdeutlichen. Die historische Entwicklung der Sprache und ihr Kontext werden ebenfalls beleuchtet.
- Sprachliche Entwicklung des Siebenbürgisch-Sächsischen
- Vergleich des Siebenbürgisch-Sächsischen mit dem Standarddeutschen
- Analyse von sprachlichen Besonderheiten in Volksliedern
- Historischer Kontext der Entstehung des Siebenbürgisch-Sächsischen
- Bedeutung des Siebenbürgisch-Sächsischen für das Verständnis der deutschen Sprachgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden zu untersuchenden Volkslieder vor: „Das verstoßene Kind“ und „Kein Herd und kein Brot“. Sie betont die Bedeutung des Siebenbürgisch-Sächsischen als Inseldialekt für das Verständnis der deutschen Sprachgeschichte und erläutert den Ansatz der Untersuchung, der sich auf die schriftliche Form der Lieder konzentriert.
Das Siebenbürgisch-Sächsische: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Ursprünge des Siebenbürgisch-Sächsischen. Es beschreibt die Einwanderung der Sachsen aus dem mitteldeutschen Raum im 12. Jahrhundert und deren sprachliche Herkunft. Der Kapitelteil betont die sprachliche Entwicklung im Kontext der Siedlungsgeschichte und der kulturellen Einflüsse. Die Rolle des kulturellen Austauschs mit dem deutschen Heimatland wird diskutiert, ebenso wie die Herausbildung des Siebenbürgisch-Sächsischen als eigenständige Mundart mit Bezügen zum Mittelhochdeutschen und anderen deutschen Dialekten. Der Einfluss von benachbarten Sprachräumen wird ebenfalls angesprochen.
Sprachliche Betrachtung zweier Volkslieder: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte sprachliche Analyse der beiden Volkslieder, wobei die Besonderheiten des Siebenbürgisch-Sächsischen im Vergleich zum Standarddeutschen herausgearbeitet werden. Es wird auf spezifische Wörter und grammatikalische Strukturen eingegangen, die für die Mundart charakteristisch sind. Durch den Vergleich der beiden Lieder werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der sprachlichen Gestaltung deutlich. Der Bezug zu den im vorherigen Kapitel beschriebenen historischen und sprachlichen Hintergründen wird hergestellt.
Schlüsselwörter
Siebenbürgisch-Sächsisch, Volkslieder, Mundart, Standarddeutsch, Sprachgeschichte, Mittelhochdeutsch, Dialektologie, Sprachvergleich, historische Sprachentwicklung, Siedlungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Sprachliche Analyse Siebenbürgisch-Sächsischer Volkslieder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die sprachlichen Besonderheiten des Siebenbürgisch-Sächsischen anhand zweier Volkslieder: „Das verstoßene Kind“ und „Kein Herd und kein Brot“. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zum Standarddeutschen und der Einordnung der Mundart in den historischen Kontext.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die sprachlichen Eigenheiten des Siebenbürgisch-Sächsischen aufzuzeigen und seine Unterschiede zum Standarddeutschen zu verdeutlichen. Die historische Entwicklung der Sprache und ihr Kontext werden beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sprachliche Entwicklung des Siebenbürgisch-Sächsischen, einen Vergleich mit dem Standarddeutschen, die Analyse sprachlicher Besonderheiten in Volksliedern, den historischen Kontext der Entstehung der Mundart und deren Bedeutung für das Verständnis der deutschen Sprachgeschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das Siebenbürgisch-Sächsische (inkl. seiner sprachlichen Einordnung und historischen Entwicklung), ein Kapitel zur sprachlichen Analyse der beiden Volkslieder und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was wird im Kapitel über das Siebenbürgisch-Sächsische beschrieben?
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Ursprünge der Sprache, die Einwanderung der Sachsen aus dem mitteldeutschen Raum, die sprachliche Entwicklung im Kontext der Siedlungsgeschichte und kultureller Einflüsse, den Austausch mit dem deutschen Heimatland und die Herausbildung des Siebenbürgisch-Sächsischen als eigenständige Mundart mit Bezügen zum Mittelhochdeutschen und anderen Dialekten. Auch der Einfluss benachbarter Sprachräume wird diskutiert.
Wie wird die sprachliche Analyse der Volkslieder durchgeführt?
Im Kapitel zur sprachlichen Analyse werden die Besonderheiten des Siebenbürgisch-Sächsischen in den beiden Volksliedern im Vergleich zum Standarddeutschen herausgearbeitet. Es wird auf spezifische Wörter, grammatikalische Strukturen und die sprachliche Gestaltung eingegangen, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Liedern deutlich gemacht werden. Der Bezug zu den historischen und sprachlichen Hintergründen wird hergestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind Siebenbürgisch-Sächsisch, Volkslieder, Mundart, Standarddeutsch, Sprachgeschichte, Mittelhochdeutsch, Dialektologie, Sprachvergleich, historische Sprachentwicklung und Siedlungsgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich für Sprachwissenschaft, Dialektologie, deutsche Sprachgeschichte und die Geschichte der Siebenbürger Sachsen interessieren.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit mit der detaillierten sprachlichen Analyse der Volkslieder ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dies ist nur eine Zusammenfassung des Inhalts.
- Citar trabajo
- Christina Gierschick (Autor), 2012, Sprachliche Betrachtungen zweier Volkslieder aus Siebenbürgen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202991