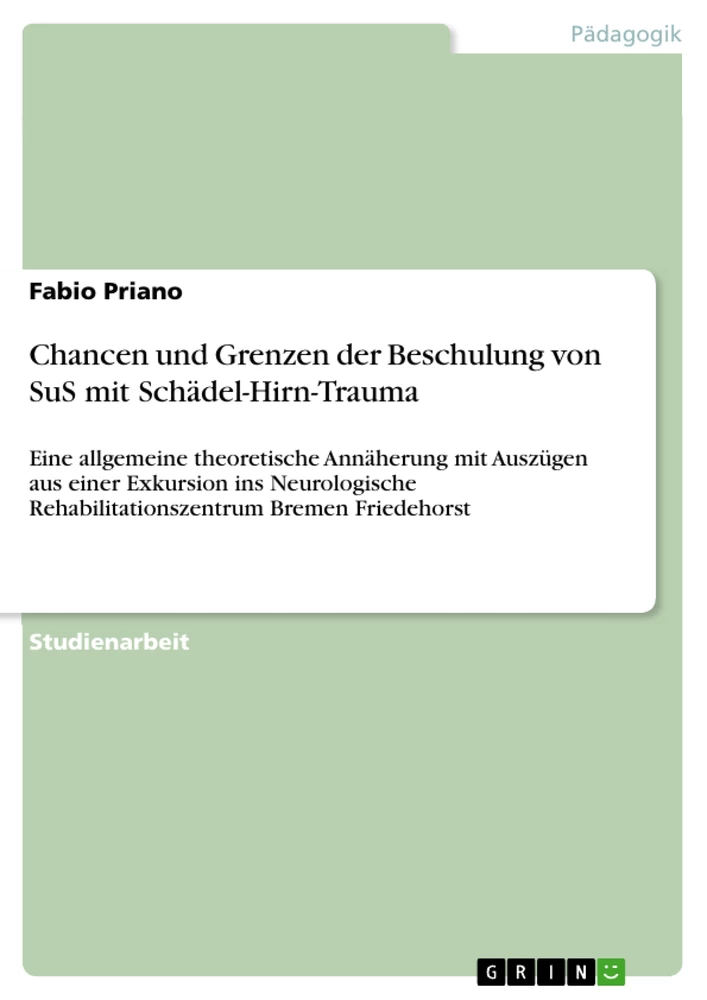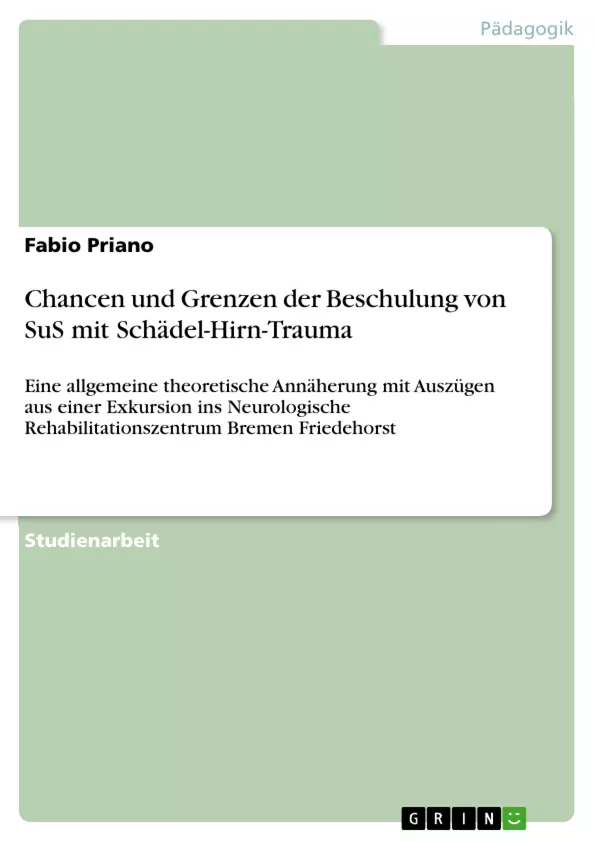„Egal wie ein Kind beschaffen ist, es hat das Recht, alles Wichtige über diese Welt zu erfahren, weil es in dieser Welt lebt.“ (Feuser, 1995, S. 220). Besonders Kinder und Jugendliche sind junge Erwachsene, die sich in der Entwicklung befinden und die Welt in der sie leben noch erfahren müssen. Das Erleiden eines Schädel-Hirn-Traumas (SHT) bedeutet dabei, dass wesentliche Entwicklungsabschnitte, auf denen nachfolgende erst aufbauen, noch nicht vollzogen wurden (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 2007, S. 9). Das Ziel der Rehabilitation dieser Kinder und Jugendlichen ist dabei das Wiedererlangen des Maximums an Mobilität und Selbstständigkeit im Alltag und die Teilhabe und Lebensqualität in Familie, Schule und sozialem Umfeld (vgl. ebd. S. 17). Hin-sichtlich Rehabilitation und deren Ziele treten in dieser Hausarbeit die medizinische Problematik und die medizinischen Aspekte der Rehabilitation in den Hintergrund und die pädagogische Förderung in der Schule rückt in den Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schädel-Hirn-Trauma
- Allgemeine Symptome und Klassifikation
- Ursachen
- Inzidenz- und Prävalenzraten
- Besonderheiten bei Kindern
- Multiprofessionalität als Grundvoraussetzung
- Die Wahl der Schule
- Die Rolle des Sonderpädagogen bei der Schulwahl
- Schulische Eingliederungsphase
- Besonderheiten des Lernens nach SHT
- Gründe für die FS-KME
- SchuIische Rehabilitation
- Chancen in der Komplexität der Situation
- Chancen durch die Lerntheoretische Didaktik
- Exkurs Förderplan
- Neue Lebenslage als Chance?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der schulischen Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen, die ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) erlitten haben. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen der Integration dieser Schüler in das Schulsystem und beleuchtet die Rolle des Sonderpädagogen bei der Schulwahl und der Gestaltung des Lernprozesses. Neben der pädagogischen Perspektive werden auch allgemeine medizinische Aspekte wie Ursachen, Symptome und Folgen von SHT behandelt.
- Die Herausforderungen der schulischen Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen nach einem SHT.
- Die Bedeutung der Multiprofessionalität bei der Rehabilitation von SHT-Patienten.
- Die Rolle des Sonderpädagogen bei der Schulwahl und der Gestaltung des Lernprozesses.
- Die Chancen und Möglichkeiten der Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung (FS-KME) für SHT-Patienten.
- Die Bedeutung der ganzheitlichen Förderung und der Berücksichtigung der neuen Lebenslage der Schüler nach einem SHT.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Schädel-Hirn-Trauma bei Kindern und Jugendlichen dar und verdeutlicht die Bedeutung der Rehabilitation für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie führt in die Thematik ein und skizziert die Schwerpunkte der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Schädel-Hirn-Trauma, wobei verschiedene Aspekte wie allgemeine Symptome, Ursachen, Inzidenz- und Prävalenzraten sowie Besonderheiten bei Kindern behandelt werden. Die Bedeutung der Multiprofessionalität in der Rehabilitation von SHT-Patienten wird ebenfalls hervorgehoben.
Kapitel 3 widmet sich der Wahl der geeigneten Schulform für Kinder und Jugendliche mit SHT. Es wird die Notwendigkeit einer individuellen Betrachtungsweise betont und die verschiedenen Schulformen, die für diese Schülergruppe in Frage kommen, vorgestellt.
Kapitel 4 beleuchtet die Rolle des Sonderpädagogen bei der Schulwahl und der Gestaltung des Lernprozesses. Es werden die Aufgaben und Kompetenzen des Sonderpädagogen im Kontext der Rehabilitation von SHT-Patienten erläutert.
Kapitel 5 befasst sich mit der schulischen Eingliederungsphase. Es werden die Besonderheiten des Lernens nach einem SHT, die Gründe für die Beschulung in der FS-KME sowie die Chancen der schulischen Rehabilitation im Detail analysiert. Die Lerntheoretische Didaktik und die Bedeutung des Förderplans werden im Kontext der schulischen Rehabilitation von SHT-Patienten diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, die schulische Inklusion, die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit Schädel-Hirn-Trauma (SHT), die Rolle des Sonderpädagogen, die FS-KME, die Lerntheoretische Didaktik und die Bedeutung der ganzheitlichen Förderung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die pädagogischen Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas (SHT)?
Ein SHT unterbricht wesentliche Entwicklungsabschnitte, weshalb die pädagogische Förderung individuell auf die neue Lebenslage angepasst werden muss.
Welche Schulform eignet sich für Kinder nach einem SHT?
Oft ist die Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung (FS-KME) geeignet, da sie die notwendige Komplexität der Rehabilitation bietet.
Welche Rolle spielt der Sonderpädagoge bei der Schulwahl?
Er berät bei der Auswahl der Schulform und gestaltet den individuellen Förderplan, um Mobilität und Selbstständigkeit im Alltag zu fördern.
Was ist das Ziel der schulischen Rehabilitation?
Das Erreichen eines Maximums an Teilhabe und Lebensqualität in Familie, Schule und dem sozialen Umfeld.
Warum ist Multiprofessionalität bei SHT so wichtig?
Da medizinische und pädagogische Aspekte eng verzahnt sind, ist die Zusammenarbeit von Ärzten, Therapeuten und Lehrkräften Grundvoraussetzung.
Was bedeutet "Lerntheoretische Didaktik" in diesem Kontext?
Sie bietet Chancen, den Lernprozess trotz der kognitiven Einschränkungen nach einem Trauma strukturiert und erfolgreich neu aufzubauen.
- Quote paper
- Fabio Priano (Author), 2012, Chancen und Grenzen der Beschulung von SuS mit Schädel-Hirn-Trauma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203070