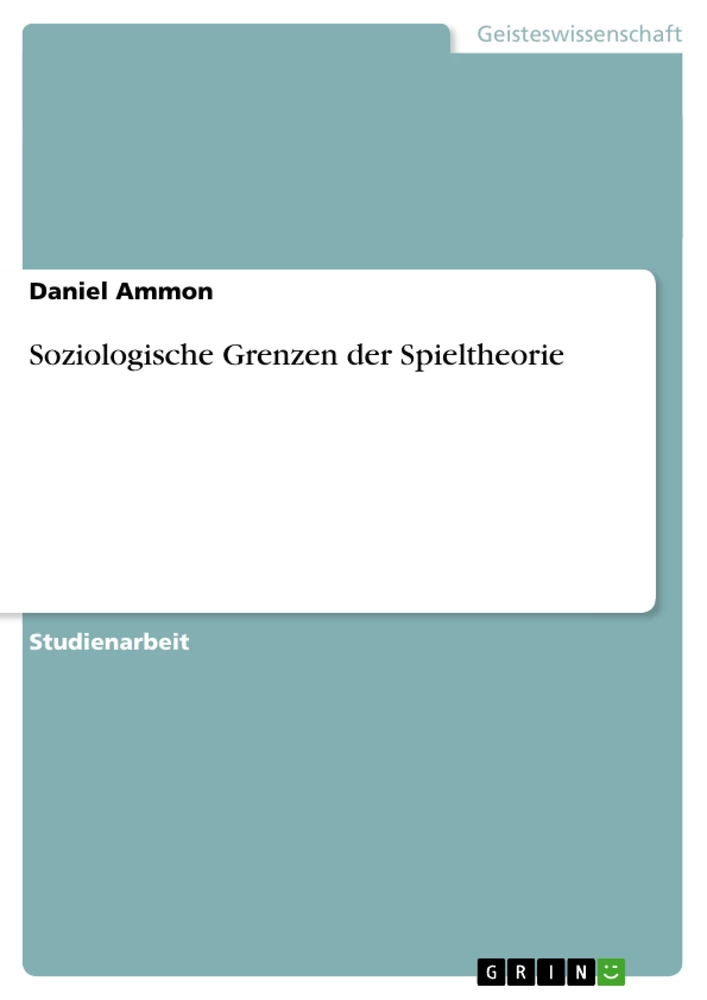Wer unter Soziologen (und besonders unter Soziologiestudenten) behauptet, das sich soziales
Verhalten mit mathematischen Formeln und Computersimulationen analysieren lässt, hat zumeist
mit Desinteresse, skeptischen Blicken oder engagiert vorgetragenen Gegenargumenten
zu rechnen. Soziologie war und ist eine Bücherwissenschaft und ein von aufklärerischen
Prinzipien getragenes wissenschaftliches Diskussionsforum. Sie wird ihrem Gegenstand nur
gerecht, wenn sie die Komplexität der Realität nur so weit reduziert, wie es unbedingt nötig
erscheint, um überhaupt über einen sozialen Sachverhalt eine Aussage machen zu können.
Der Soziologie geht es nicht in erster Linie um formale Reinheit und ein abstraktes, logisch
konsequentes Denken, sondern um eine den Menschen dienliche Analyse der realen
Verhältnisse. Und wer sich einmal ein Statistikseminar im Fach Soziologie gönnt, der wird
bemerken, daß die Studenten diese Veranstaltung aufgrund ihrer mathematischen Ausrichtung
eher als lästige Pflicht betrachten und weniger als Bereicherung ihres wissenschaftlichen
Instrumentariums.
Es gibt also von Seiten der Soziologen sowohl wissenschaftlich begründete als auch persönlich
motivierte Gründe, der Spieltheorie,die letztlich eine Spielart der Mathematik ist, distanziert
gegenüberzustehen. Erschwerend kommt wohl noch die heimliche Befürchtung hinzu,
daß ein funktionierendes mathematisches Modell der sozialen Wirklichkeit der Soziologie die
Existenzberechtigung nehmen oder ihr zumindest viele ihrer ureigenen Gebiete streitig
machen könnte.
Wenn man die sozialwissenschaftliche Literatur zur Spieltheorie überblickt, so findet man
dann auch im wesentlichen Argumente und Beispiele, warum und wo die Sichtweise bzw. die
Grundlagen der Spieltheorie der Wirklichkeit nicht gerecht werden. Es tritt deutlich zutage,
daß das Hauptanwendungsgebiet der Spieltheorie im wirtschaftlichen Bereich liegt. In den
letzten Jahren allerdings wurde von den Spieltheoretikern die evolutionstheoretische
Bedeutung ihrer Wissenschaft hervorgehoben.
Die Wirtschaftswissenschaften mussten von nun an etwas umdenken, denn die Möglichkeit,
daß es nicht unbedingt das „egoistische Gen“ ist, daß den Menschen zum Erfolg führt,
sondern soziales Verhalten viel fruchtbarer ist (wie es die Ergebnisse der spieltheoretischen
Forschungen nahe legen), steht in Opposition zu den bisherigen wirtschaftswissenschaftlichen
Grundannahmen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die sozialwissenschaftliche Kritik der Spieltheorie
- 1.1. Die Relevanzproblematik der Axiome
- 1.2. Die allgemeinen Axiome der Spieltheorie
- 1.3. Der Aspekt der Fehleinschätzung
- 1.4. Das Problem der Spielsituation
- 1.5. Die Definition des Spielendes
- 2. Die evolutionstheoretische Bedeutung der Spieltheorie aus soziologischer Sicht
- 2.1. Das Gefangenendilemma
- 2.2. Die Computerturniere Robert Axelrods
- 2.3. Die ökologischen Turniere
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Grenzen der Spieltheorie in Bezug auf die Soziologie. Er analysiert, inwiefern die spieltheoretischen Annahmen und Methoden auf soziale Phänomene anwendbar sind. Der Autor stellt die Frage, ob die Spieltheorie der Soziologie als nützliches Instrument dienen kann oder ob ihre Annahmen zu unrealistisch sind.
- Kritik der spieltheoretischen Axiome
- Relevanz der Spieltheorie für die Sozialwissenschaften
- Evolutionstheoretische Aspekte der Spieltheorie
- Soziale und wirtschaftliche Aspekte von Spieltheorie
- Das Gefangenendilemma als Beispiel für spieltheoretische Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Kritik der Spieltheorie aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Der Autor diskutiert die Relevanz der spieltheoretischen Axiome und hinterfragt deren Anwendbarkeit auf soziale Situationen. Er stellt fest, dass die Grundannahmen der Spieltheorie oft unrealistisch sind und daher die Gültigkeit ihrer Schlussfolgerungen in Frage stellen.
Das zweite Kapitel widmet sich der evolutionstheoretischen Bedeutung der Spieltheorie aus soziologischer Perspektive. Der Autor erörtert das Gefangenendilemma als ein Beispiel für die Anwendung spieltheoretischer Modelle in der Evolutionstheorie. Er beleuchtet die Bedeutung der Computerturniere von Robert Axelrod und die ökologischen Turniere, die neue Erkenntnisse über die Bedeutung von sozialem Verhalten im Kontext der Evolution liefern.
Schlüsselwörter
Spieltheorie, Sozialwissenschaften, Axiome, Relevanz, Evolutionstheorie, Gefangenendilemma, Computerturniere, ökologische Turniere, soziales Verhalten, Wirtschaft, Globalisierung.
- Arbeit zitieren
- Daniel Ammon (Autor:in), 1999, Soziologische Grenzen der Spieltheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20314