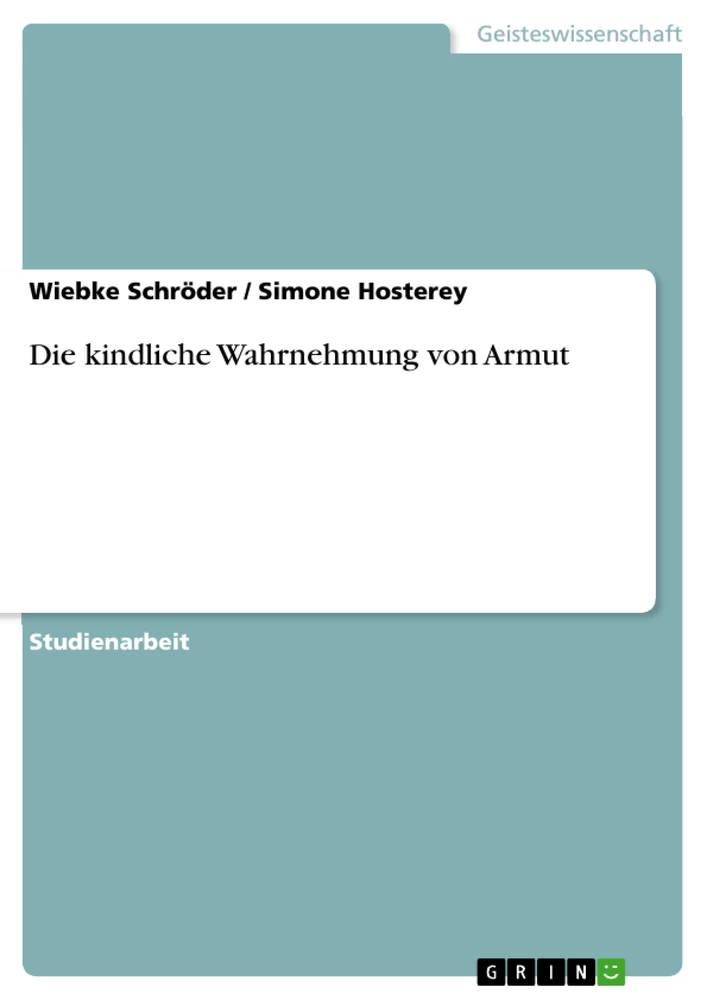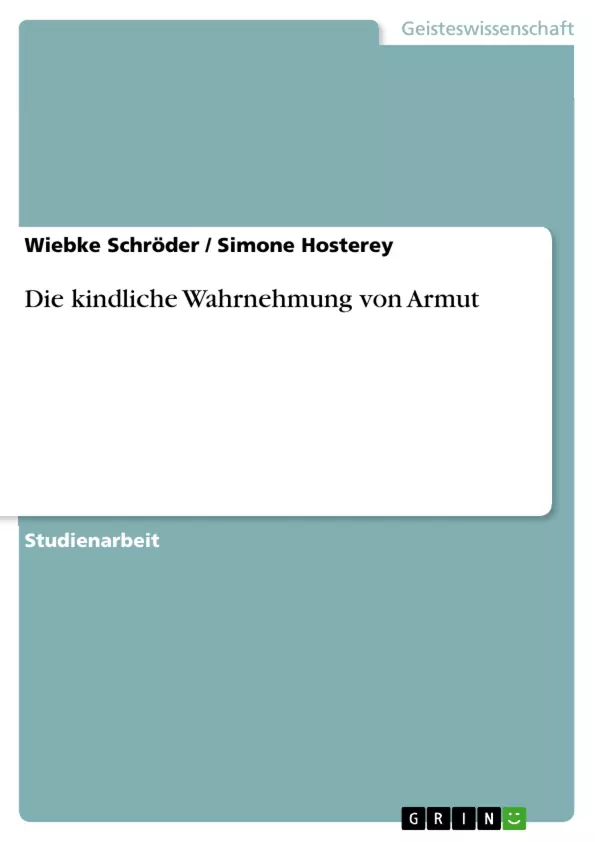Wir werden in dieser Arbeit vor allem auf die Benachteiligungen eingehen, denen arme Kinder in verschiedenen Lebensbereichen ausgesetzt sind. Hierbei sollen in unseren Ausführungen Kinder aus Deutschland im Mittelpunkt stehen, da solche mit Migrationshintergrund noch einmal eine eigene Gruppe darstellen. Ebenso stellen wir die kindliche Wahrnehmung und die verschiedenen Bewältigungsstrategien in den Vordergrund unserer Arbeit.
Im Folgenden werden wir einige verschiedene Armutsbegriffe erläutern, um uns eine Vorstellung darüber zu vermitteln, in wie vielen Facetten Armut auftreten kann, bevor wir eine abschließende Definition von Kinderarmut geben wollen.
Darüber hinaus schließen wir die Ausführungen zur kindlichen Wahrnehmung und deren Bewältigungsversuche an, um uns dann einen kleinen Exkurs in die Rechtslage zu erlauben, der allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern nur eine Anregung bieten soll.
Der letzte Aspekt soll den Blick auf die Möglichkeiten der Unterstützung lenken, bevor wir ein Fazit aus dem riesigen Begriff der Kinderarmut ziehen und einen kurzen Ausblick geben.
Das Essensgeld ist immer noch nicht bezahlt. Sie kommen morgens hungrig in den Kindergarten. Im Winter stapfen sie mit Turnschuhen durch den Schnee.
Der Schulanfang macht große Probleme, wenn Hefte, Stifte und Bücher gekauft werden müssen.
Das sind Kinder, die in knappen finanziellen Verhältnissen aufwachsen, jedenfalls haben wir diese Vorstellung davon.
Finanzielle Knappheit, Arbeitslosigkeit und Armut verdichten sich in vielen Familien zu massiven Problemlagen und die unter diesen Bedingungen erschwerte Gestaltung des Alltags gehört bei vielen Kindern zur alltäglichen Lebens- und Erfahrungswelt.
Diese Lebenswelt inkludiert vor allem die Erfahrung, dass Kinder Mangel und Entbehrung in vielseitigen Bereichen ihres Lebens erfahren müssen. Hinzu kommt die Konfrontation ihrer Situation im Kindergarten und in der Schule, die sie als Diskriminierung und Ausgrenzung erleben (müssen).
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Armutsbegriffe und Armutsdefinitionen
1.1 Relative Armut
1.2 Absolute Armut
1.3 Sichtbare Armut
1.4 Bekämpfte und verdeckte Armut
1.5 Alte Armut
1.6 Neue Armut
1.7 Kinderarmut
2. Wie erleben Kinder Armut?
2.1 Signale für Kinderarmut
2.2 Ursachen von Kinderarmut
2.3 Identifikation mit Armut
2.4 Betrachtungsdimensionen
2.4.1 Einkommens- und Versorgungsspielraum
2.4.2 Kontakt- und Kooperationsspielraum
2.4.3 Muße- und Regenerationsspielraum und die familiäre Dynamik
2.4.4 Lern- und Erfahrungsspielraum
2.4.5 Entscheidungs- und Dispositionsspielraum
2.4.6 Übergänge / Schlüsselmomente
2.4.7 Psychische Beeinträchtigungen
2.4.8 Graphische Darstellung der Betrachtungsdimensionen
3. Bewältigungsversuche
3.1 Bewältigung und Sozialpädagogik
3.2 Entlastende und belastende Faktoren
3.3. Bewältigung und Psychologie
4. Exkurs: Armut als eine „Form“ der Verletzung von Kinder- und Menschenrechten
4.1 Gebiete der möglichen Verletzung von Kinder- Menschenrechten
5. Fazit und Ausblick
6. Literaturverzeichnis
Einleitung
Das Essensgeld ist immer noch nicht bezahlt. Sie kommen morgens hungrig in den Kindergarten. Im Winter stapfen sie mit Turnschuhen durch den Schnee.
Der Schulanfang macht große Probleme, wenn Hefte, Stifte und Bücher gekauft werden müssen.
Das sind Kinder, die in knappen finanziellen Verhältnissen aufwachsen, jedenfalls haben wir diese Vorstellung davon.
Finanzielle Knappheit, Arbeitslosigkeit und Armut verdichten sich in vielen Familien zu massiven Problemlagen und die unter diesen Bedingungen erschwerte Gestaltung des Alltags gehört bei vielen Kindern zur alltäglichen Lebens- und Erfahrungswelt.
Diese Lebenswelt inkludiert vor allem die Erfahrung, dass Kinder Mangel und Entbehrung in vielseitigen Bereichen ihres Lebens erfahren müssen. Hinzu kommt die Konfrontation ihrer Situation im Kindergarten und in der Schule, die sie als Diskriminierung und Ausgrenzung erleben (müssen).
Die Eltern, ihre Familie, Freunde, soweit vorhanden, ihre Lehrer, Erzieher und nicht zuletzt die Gesellschaft verlangt von ihnen in nicht sichtbarer Art und Weise, dass diese Kinder unter diesen erschwerten Bedingungen leben, sich entwickeln und sie bewältigen sollen. Die scheinbar unüberwindbaren Bedingungen stellen aber auch gesundheitliche und psychosoziale Entwicklungsrisiken dar, die als giftige Nebenwirkungen die Kinder oft unbemerkt belasten. So sind Kinder gezwungen, persönliche Schutzfaktoren um sich herum zu entwickeln, mit denen sie die negativen Erfahrungen, die aus den oben genannten Bedingungen resultieren, verarbeiten und kompensieren können.
„Wer arm ist, ist selber schuld“, oder „Armut betrifft mich nicht.“ – so ertönt es aus dem Munde der Gesellschaft. Armut ist ein Tabuthema über das nicht (gern) gesprochen wird.
Doch die vielen Gesichter, die Kinderarmut haben kann, erleichtern es, die Augen vor dieser Realität zu verschließen bzw. Armut als gesellschaftliche Gegebenheit hinzunehmen. Aber, Armut nistet sich auch dort ein, wo man sie gar nicht vermutet, sie ist mehrdimensional.
Jedoch sieht es tatsächlich so aus, dass gerade Kinder in unserer Gesellschaft in Armut leben und die Notleidenden in ihrer Situation sind. Die Steigerung von arm lautet: arm, ärmer, am ärmsten. Müsste aber nicht der Superlativ verändert werden, so dass es heißen müsset: arm, ärmer, Kind?
Ja, Kinderarmut verkörpert eine laut schreiende Ungerechtigkeit, denn für diese Kinder werden Weichen gestellt, die früher oder später aufs Abstellgleis führen. Denn diesen Kindern - und wir müssten uns eigentlich schon selbst verurteilen, weil wir im Zusammenhang mit Kinderarmut von „diesen Kindern“ sprechen müssen, um sie zu differenzieren – werden Vorraussetzungen auferlegt, mit denen sie nur geringe Chancen oder gar keine Chancen haben, später einmal ein „normales“ Leben zu führen.[1]
Ist nicht jeder einzelne von uns gefordert, mag er auch Politiker sein, sich mit dem Thema auseinander zu setzten, und wenn er es nicht schon längst getan hat, seine Überlegungen voranzutreiben, um die unschuldigen Kinder, denn Kinder sind in dieser Lage immer unschuldig, aus ihrer Misere zu erlösen?
Wir werden in dieser Arbeit vor allem auf die Benachteiligungen, die nun schon im geringen Maße angedeutet wurden, eingehen, denen arme Kinder in verschiedenen Lebensbereichen ausgesetzt sind. Hierbei sollen in unseren Ausführungen Kinder aus Deutschland im Mittelpunkt stehen, da solche mit Migrationshintergrund noch einmal eine eigene Gruppe darstellen. Ebenso stellen wir die kindliche Wahrnehmung und die verschiedenen Bewältigungsstrategien in den Vordergrund unserer Arbeit.
Im Folgenden werden wir einige verschiedene Armutsbegriffe erläutern, um uns eine Vorstellung darüber zu vermitteln, in wie vielen Facetten Armut auftreten kann, bevor wir eine abschließende Definition von Kinderarmut geben wollen.
Darüber hinaus schließen wir die Ausführungen zur kindlichen Wahrnehmung und deren Bewältigungsversuche an, um uns dann einen kleinen Exkurs in die Rechtslage zu erlauben, der allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern nur eine Anregung bieten soll.
Der letzte Aspekt soll den Blick auf die Möglichkeiten der Unterstützung lenken, bevor wir ein Fazit aus dem riesigen Begriff der Kinderarmut ziehen und einen kurzen Ausblick geben.
1. Armutsbegriffe und Armutsdefinitionen
Armut macht sich in verschiedenen Lebensbereichen bemerkbar und nimmt verschiedene Formen an. Wenn wir in Deutschland von Kinderarmut sprechen, meinen wir zunächst materielle Armut. Diese Form von Armut offenbart unterschiedliche Ausprägungen von Armut. In der bundesrepublikanischen Gesellschaft treten z.B. „sichtbare“ und „weniger sichtbare“ Formen von Armut auf. Die Armutsforschung unterscheidet in diesem Zusammenhang häufig zwischen „alter“ und „neuer“ Armut. (vgl. Zander S.17)[2]
Es soll nun um die Erläuterung der unterschiedlichen Armutsbegriffe gehen.
1.1 Relative Armut
Bei diesem Armutsbegriff liegt das Erreichen von typisch gesellschaftlichen Standards im Vordergrund. Arm ist der, der hinter allgemein anerkannten minimalen Konsumstandards zurückbleibt, daher bezeichnet die relative Armut auch eine extreme Form der sozialen Ungerechtigkeit, da Betroffene sozial ausgegrenzt werden und somit in unfreiwillig in Randgruppen gedrängt werden.(vgl. www.sign-lang.uni-hamburg.de) Der für arm titulierte Bürger wird bei diesem Ansatz immer in Relation zur übrigen Bevölkerung gesehen, „wenn er über so wenig Einkommen und/oder Vermögen verfügt, dass er das Maß an Lebenschancen, Lebenskomfort und Selbstrespekt, das die Gemeinschaft, der er angehört, als normal ansieht, entbehren muss“. (vgl. Bolte 2001, S.37)
1.2 Absolute Armut
Absolute Armut liegt vor, wenn die betroffenen Menschen nicht einmal über das zum Überleben Notwendige verfügen, d.h. über ausreichende Nahrung, Kleidung, Wohnung und gesundheitliche Betreuung. In dieser Situation sind sie vom Tod durch Hunger, Erfrieren oder durch Krankheiten, die unter normalen Umständen heilbar sind, bedroht. (vgl. www.sign-lang.uni-hamburg.de)
Absolute Armut lässt sich nur in verschwindend geringem Maße in den westlichen Industrieländern nachweisen. Daher ist der relative Armutsbegriff hier wichtiger als der absolute. (vgl. Kaller 2001, S.36)
1.3 Sichtbare Armut
„Besonders kinderreiche Familien, allein erziehende Mütter sowie Kinder und Jugendliche sind von der Obdachlosigkeit betroffen. In den 70er Jahren machten die Familien mit mindestens drei Kindern 40-50% der Bewohner von Obdachlosensiedlungen aus, in der Gesamtbevölkerung aber nur 7%.“ (Geißler 1996, S.191)
Aus diesem Zitat lässt sich die Definition für sichtbare Armut ableiten: Von sichtbarer Armut sind Menschen betroffen, die in Notunterkünften leben, z.B. in Obdachlosenheimen.
1.4 Bekämpfte und verdeckte Armut
Mit dem Begriff der bekämpften Armut soll betont werden, dass „Menschen, die Leistungen der Sozialhilfe beziehen nicht mehr als arm zu bezeichnen sind. Die Leistungen der Sozialhilfe definieren normativ die amtliche Armutsgrenze“. (Adamy 1998, S.8)
Dennoch kann das vorige Zitat keinesfalls als sichere Definition gelten, denn nicht jeder, der einen Anspruch auf Sozialleistung hat, diesen auch wahrnimmt und ist sofern als verdeckt arm zu bezeichnen. (vgl. Joos 1998, S. 21). Gründe für die Nichtinanspruchnahme sind zum einen die Unwissenheit darüber, dass den Betroffenen in einer Armutssituation Sozialleistungen zustehen, zum anderen ist die Schamgrenze, den Weg zum Sozialamt zu gehen, meist unüberwindbar. (vgl. Geißler 2003, S.249)
1.5 Alte Armut
„Alte Armut bezieht sich auf Familien, die die Armutslage gewissermaßen von einer Generation auf die nächste „sozial vererben“ und denen es sichtlich schwer fällt, den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Es handelt sich in der Regel um Familien, wo zur materiellen Armut und zum Bezug von Sozialleistungen weitere soziale Probleme hinzukommen, z.B. Dauererwerbslosigkeit, (…) niedriges Bildungsniveau der Eltern, Leben in Substandartwohnungen und in sozialen Brennpunkten, Schulden oder soziale Isolation. Hinzu kommen aber auch andere familiäre Problemlagen wie chronische Krankheiten, Suchterkrankungen, Behinderungen usw.
Entscheidende Merkmale alter Armut sind Langzeitarmut und wenige Aufstiegsperspektiven für die Erwachsenen. Kinder, die in solchen Familien leben sind häufig an äußeren Erscheinungsmerkmalen erkennbar (z.B. an nicht zweckmäßiger Kleidung, nicht ausreichend gepflegtem Äußeren, auffälligen Umgangsformen usw.) (…)“ (vgl. Zander S.18)
1.6 Neue Armut
Entscheidendes Merkmal der neuen Armut ist, (…) dass es sich um kurzfristig eintretende Verarmungsprozesse handelt, die zu einem allmählichen, manchmal aber auch einem plötzlichen Abrutschen in die Einkommensarmut von Familien führen, die zuvor nicht „auffällig“ geworden waren. Hier kommt es zu eher unsichtbaren und verdeckten Formen von Armut. In den meisten Fällen gelingt es, den betroffenen Familien, die familiäre Armutslage – insbesondere deren Auswirkungen auf die
Kinder – durch Ressourcen wie höheres Bildungsniveau, soziale Netze, Eigenaktivitäten und andere Kompensationsmöglichkeiten zu mildern. Im Gegensatz zur alten Armut handelt es sich hierbei häufiger um zeitlich begrenzte Armutsphasen mit einer früheren oder späteren Ausstiegsperspektive (…). (vgl. Zander S.18-21)
1.7 Kinderarmut
Aufgrund der vielen Bestimmungsformen von Armut, kann man den Begriff „Armut“ an sich nicht definieren, da es ein sehr sensibler Begriff ist, den man nicht pauschalisieren kann. Zum einen variieren die Begriffsbestimmungen erheblich in der Gesellschaft, zum anderen schließt die Armut der Eltern die Kinder mit ein, d.h. sind die Eltern von Armut betroffen, so sind es deren Kinder logischerweise auch. Daher werden wir nun keine allgemein gültige Definition für Kinderarmut anführen, sondern plädieren dafür, wie schon angedeutet, für einen differenzierten Armutsbegriff.
2. Wie erleben Kinder Armut?
Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist, Armut aus der Perspektive von Kindern zu betrachten. Daher möchten wir auf Zitat von Prof. Dr. Margherita Zander zurückgreifen, die sich in ihrem Vortrag, „Normalfall Kinderarmut? Konsequenzen für Prävention und Gesundheitsförderung“, mit diesem Thema auseinandersetzte. Dieses Zitat stammt von einem Kind, das auf die Frage: „Was ist für dich Armut?“ – wie folgt antwortete:
„ Arm ist... „Wenn man nicht genug zum Anziehen kaufen kann. Wenn man nicht so eine große Familie hat, nur 1 oder 2 Personen oder so. Wenn man nicht unter einem Dach lebt. Wenn man nicht genug zum Essen hat. Wenn man keine Arbeitsstelle hat und kein Geld verdienen kann. Wenn man kein warmes Bett hat. Wenn man kein Fahrrad hat oder ein Auto, um mal irgendwo hinzufahren. Wenn man nicht genug Geld hat. Wenn man nicht zur Schule und nicht in den Kindergarten gehen kann. Wenn man nicht genug Licht ins Haus bringen kann. Wenn man keine Stifte hat zum Hausaufgaben machen. Wenn man nicht Einkaufen gehen kann. Wenn man nichts in seiner Freizeit machen kann. Wenn man keinen Fotoapparat hat, für Erinnerungen. Wenn man etwas zur Schule mitbringen muss, ein Buch oder eine Kassette, und man das nicht hat…“ (Zander 2004, S.1)
Diese Antwort ist sehr eindrucksvoll, denn das befragte Kind weiß ohne Zweifel wovon es spricht kann die Perspektive der kindlichen Wahrnehmung sehr bildlich verbalisieren.
Wie erleben Kinder Armut? Was stellen sie sich darunter vor? Was für Strategien entwickeln sie, diese zu verarbeiten und zu bewältigen? Wissen Kinder, was für sie gut ist und was sie brauchen, um glücklich zu sein?
„Die „neue Kindheitsforschung“ hat diesbezüglich einen Perspektivenwechsel vollzogen. Sie will Kinder als eigenständige Subjekte ernst nehmen und nicht als Objekte, die nur reagieren können. Sie fragt sich, ob Erwachsene in der Lage sind, den eigenen Sinn von Kindern zu verstehen und von welchem Erkenntnisinteresse Erwachsene sich dabei leiten lassen. Und was berechtigt sie zur Annahme einer Vorrangstellung in ihrem Verhältnis zu Kindern? Können sie doch weder die Perspektive der Kinder einnehmen, noch deren Zukunft voraussehen. (…) Vielmehr soll die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, dass Kinder ihre eigene soziale Welt konstruieren und dass sie gesellschaftliche Realität mitgestalten.“ (vgl. Zander 2004, S.2f)
Was fordert Zander hier genau? : Sie fordert die Erwachsenen auf - oder wollen wir besser Eltern sagen – Empathie für die Kinder aufzubringen, sich eben in sie hinein zu versetzten und an ihrer „sozialen Welt“ teilzunehmen. Gefordert wird eine Beziehung zu den Kindern, die auf Wechselseitigkeit beruht.
Von dieser Feststellung ausgehend, steigen wir jetzt in das Thema der kindlichen Wahrnehmung ein, lenken aber vorher noch den Blick auf mögliche Signale für Kinderarmut.
2.1 Signale für Kinderarmut
In diesem Aspekt wollen wir nun Anzeichen auflisten, die auf eine denkbare Armutssituation hinweisen können. Wir müssen hier nicht auf Literatur zurückgreifen, da die folgenden Situationen jeder (und wir selber auch) schon einmal beobachtet hat: ein deutlicher Hinweis für ein armutsgefährdetes Kind kann sein, wenn es, besonders montags, das im Kindergarten angebotene Essen, in kurzer Zeit in sich hineinschlingt. Daraus lässt sich sehr deutlich assoziieren, dass dieses Kind nach dem Wochenende hungrig ist, weil die Eltern aus irgendeinem Grund nicht in der Lage waren ihren Kindern eine Mahlzeit zuzubereiten. Wenn man weiter geht, kann man daraus eine gewisse Mangelernährung ableiten, die eine Armutssituation mit sich hervorbringen kann. Ein nächster Hinweis sind Ablehnungen von Einladungen zu Kindergeburtstagen, mit der Begründung, dass das Geld zum Kauf von Geschenken nicht aufgebracht werden kann, was Betroffene in der Regel nicht offen legen, da sie von Schamgefühlen heimgesucht werden.
Ein oft beobachteter Gesichtspunkt ist, dass Kinder unregelmäßig oder gar kein Frühstück mit zur Schule nehmen oder wenn sie bei Klassenfahrten oder Schulausflügen Bauch- oder Kopfschmerzen vorgeben, da viele Eltern den wirklichen Grund, nämlich fehlendes Geld, aus Scham verschweigen.
2.2 Ursachen von Kinderarmut
Kinderarmut erscheint in vielen Facetten und sie ist letztendlich immer auf die Armut der Familie zurückzuführen, in der die Kinder leben.
Arbeitslosigkeit und Niedrigeinkommen sind in erster Linie die auslösenden Faktoren für die Verarmung der Familien. (vgl. www.kija.at, 2004)
Aber auch die Familienform spielt eine wichtige Rolle als Einflussfaktor auf das Armutsrisiko. Die Rede ist von den Alleinerziehenden, die auf eigenes Einkommen angewiesen sind, um ihre Zukunft und die ihrer Kinder sichern zu können. (vgl. www.bmfsfj.de)
Frauen und Kinder gehören zu den Hauptleidtragenden von Scheidungen bzw. Trennungen. (Butterwegge/Holm/Zander u.a. 2004, S.111)
Hans-Jürgen Andreß und Miriam Güllner zeigen empirisch, „dass sich die wesentlichen wirtschaftlichen Veränderungen bereits im Zusammenhang mit der Trennung einer Ehe ergeben und sich nicht erst als Folge der Scheidung erweisen. (…) Mit der Trennung steigt die Armutsquote im Vergleich zur Ausgangssituation auf mehr als das doppelte an. Dabei sind es vor allem die Frauen und die Kinder, die ein erhöhtes Armutsrisiko aufweisen.“ (Andreß/Güllner in: Barlösius/Ludwig-Myerhofer 2001, S. 194) Kinderarmut lässt sich aber auch deuten vor dem Hintergrund fortschreitender Globalisierung, die für eine Reihe von Familien auf den Verlust von Sicherheiten hinausläuft. (Butterwegge/Klundt/Zeng 2005, S.57ff)
„In der neoliberalen Weltsicht erscheint Armut nicht als gesellschaftliches Problem, vielmehr als selbst verschuldetes Schicksal, das im Grunde eine gerechte Strafe für Leistungsverweigerung oder die Unfähigkeit darstellt, sich bzw. seine Arbeitskraft auf dem Markt mit ausreichendem Erlös zu verkaufen, wie der Reichtum umgekehrt als angemessene Belohnung für eine besondere Leistung betrachtet wird. Dagegen sind hohe Löhne bzw. Lohnnebenkosten für Neoliberale der wirtschaftliche Sündenfall schlechthin und müssen als Ursache von Arbeitslosigkeit und Wachstumsschwäche in Deutschland herhalten.“ (Butterwegge/Holm/Zander u.a. 2004, S.99)
Und weiter:
„Wie es scheint sind Kinder (und Jugendliche) deshalb so stark von Armut betroffen, weil das neoliberale Projekt des „Umbaus“ der Gesellschaft und ihres Sozialstaates auf Kosten vieler Eltern geht, die nicht mehr das Maß an Sicherheit haben wie frühere Generationen. (…) Kinder leiden nicht nur besonders und in spezifischer Weise unter Einschränkungen, denen ihre Familien ausgesetzt sind, sondern auch vielmehr als die Erwachsenen unter der zunehmenden Polarisierung einer Gesellschaft, die noch für lange Zeit ihren Lebens- und Gestaltungsraum darstellt. Man kann von einer Auseinanderentwicklung der Lebensbedingungen der heranwachsenden Generation sprechen, welche negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden sowie die Partizipationsmöglichkeiten und Lebenschancen benachteiligter Kinder hat (Butterwegge/Holm/Zander u.a. 2004, S.100):
„Gerade bei Kindern führt die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich zu zahlreichen Anspannungen und Belastungen.“ (Palentien/Klocke/Hurrelmann in: Politik und Zeitgeschichte 18/1999, S.34)
2.3 Identifikation mit Armut
Bei Kindern zeigt sich selten eine Identifikation mit dem Begriff Armut. Die vorherrschenden Bilder sind Hungerleidende, Menschen, denen die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse verwehrt bleibt, Einsamkeit und Krankheit, Obdachlosigkeit, Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit werden gelegentlich auch noch als Armutskriterien genannt.
Auffallend ist, dass oft Extrembeispiele als Erklärung dienen, um dem Begriff der Armut zu begegnen. Da der Begriff in erster Linie an die Basisbedürfnisse von Menschen gekoppelt ist, entsteht nicht wirklich eine Identifikation mit Armut. Die Kinder setzten sich nicht gleich (Ich=arm). Die eigene Situation wird als „normal“ bezeichnet; Armut scheint relativ zu den anderen zu sein.
Das unmittelbare Lebensumfeld der Kinder scheint am wichtigsten zu sein, denn nicht nur das fehlende Geld, also die materielle Seite, wird mit Armut assoziiert, sondern auch das Nichtvorhandensein von Freunden und Bekannten. Wer darauf nicht zurückgreifen kann, ist ebenfalls von Armut betroffen.
Zwar ist es den meisten Kindern bewusst, dass es Menschen gibt, deren Situation viel prekärer ist, als die ihre, doch würden sie sich nicht als arm charakterisieren, da sie in der Regel nie eine andere Situation erlebt haben.
Dies besagt, dass auch vieles darauf hindeutet, dass Armut bereits als Tabu erlernt wird, dass keinesfalls mit einem selber identifizierbar sein darf.[3] (vgl. Kohler, Awender, Raith, Dubath, S.5)
2.4 Betrachtungsdimensionen
Nachdem wir nun einen kurzen Input in das Thema gegeben haben, wollen wir nun auf weitere Aspekte eingehen und stützen unsere Ausarbeitung dabei auf das „Spielräume-Konzept“ von Ingeborg Nahnsen.[4] Das Spielräumekonzept berücksichtigt die armutsbedingten Einschränkungen, welche die Lebenslagen insbesondere von Kindern prägen. (Butterwegge/Holm/Zander u.a. 2004, S.80) Dabei unterscheidet man folgende (Handlungs-) Spielräume, die sich wechselseitig beeinflussen.
[...]
[1] Mit normalen Leben soll hier ein Leben gemeint sein, das den gesellschaftlichen Werten und Normen entspricht oder entsprechen sollte.
[2]
Bei diesem Zitat handelt es sich um eine Übernahme aus einer Broschüre über Kinderarmut, die aus verschiedenen Stellungsnahmen besteht, u.a. von Prof. Dr. Margherita Zander / Aufwachsen in Armut – in einem Wohlfahrtsstaat. Es wurden jedoch keine Jahresquellen angegeben, wodurch wir gezwungen sind, bei weiteren Zitaten, auf die Jahreszahl zu verzichten.
[3] Der Inhalt bezieht sich auf eine Studie im Auftrag der eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ), durchgeführt durch Franz Kohler, Frank Awender, Michael Raith und Viviane Dubath. Befragt wurden von Armut betroffene Kinder und Jugendliche in Einzel- und Gruppengesprächen, zu dem Thema der Selbstwahrnehmung von Kindern und Jugendlichen in Armut. (www.kobra-online.info)
[4] Vgl. Ingeborg Nahnsen, Wichtige Interessen, äußere Umstände und Lebenslage. Auseinandersetzung mit zentralen Elementen des Weisserschen Lebenslagenkonzeptes, Göttingen 1972
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bedeutet ein Mangel am Lebensnotwendigen (Nahrung, Obdach). Relative Armut bezieht sich auf den Lebensstandard der Mehrheitsgesellschaft; wer deutlich weniger hat, wird sozial ausgegrenzt.
Wie äußert sich Kinderarmut im Alltag?
Oft durch fehlendes Geld für Schulmaterialien, unbezahltes Essensgeld, unpassende Kleidung im Winter oder den Ausschluss von sozialen Aktivitäten wie Klassenfahrten.
Was versteht man unter "verdeckter Armut"?
Menschen leben in verdeckter Armut, wenn sie zwar Anspruch auf Sozialleistungen hätten, diese aber aus Scham oder Unwissenheit nicht in Anspruch nehmen.
Welche langfristigen Folgen hat Armut für Kinder?
Armut schränkt Bildungs- und Entwicklungschancen massiv ein, erhöht gesundheitliche Risiken und führt oft zu einer "sozialen Vererbung" der Armutslage.
Wie nehmen Kinder ihre eigene Armut wahr?
Kinder erleben Armut oft als Diskriminierung und Ausgrenzung in Schule und Kindergarten. Sie entwickeln häufig eigene Schutzfaktoren, um mit diesem Mangel umzugehen.
- Citar trabajo
- Wiebke Schröder (Autor), Simone Hosterey (Autor), 2008, Die kindliche Wahrnehmung von Armut, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203226