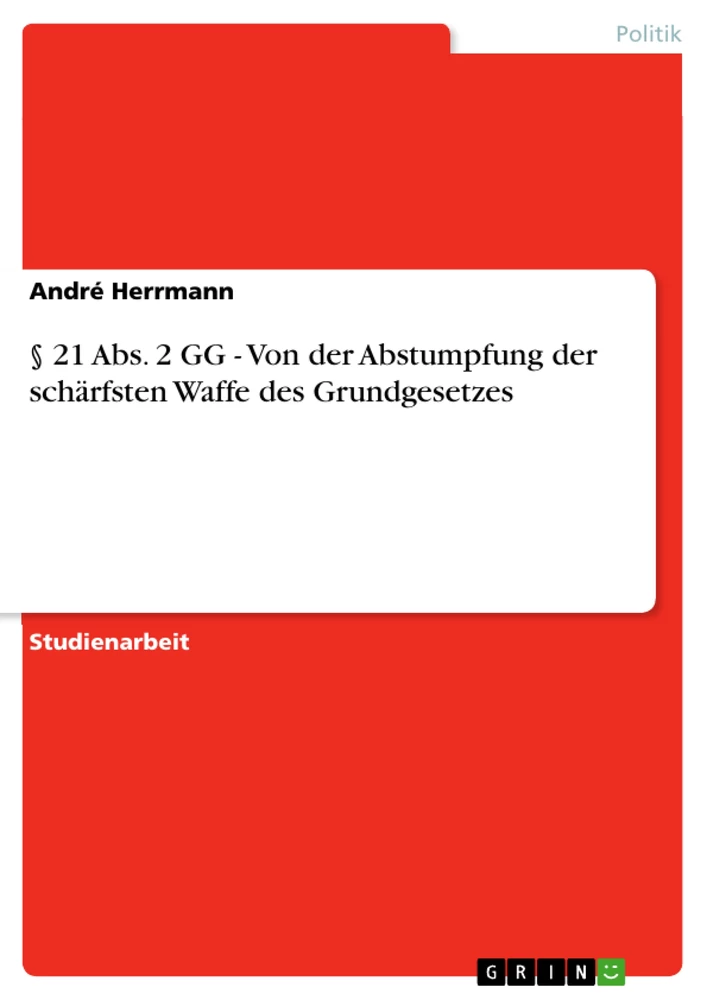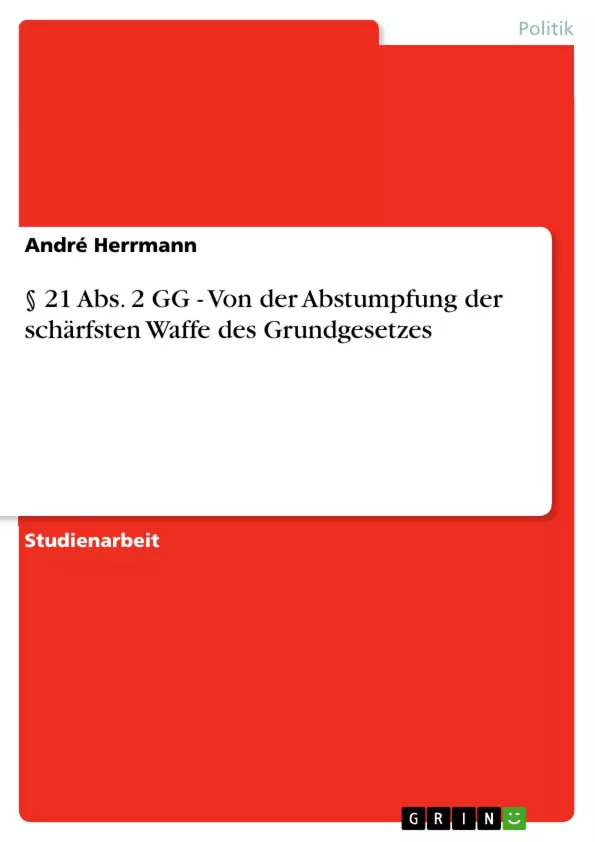Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Instrument des Parteiverbots im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sowie dem Bundesverfassungsgerichts-gesetz. Als Lehre aus der auf legalem Wege erreichten Aushebelung der Weimarer Verfassung durch die Nationalsozialisten und die darauf folgende Schreckensherrschaft installierten die so genannten Väter des Grundgesetzes im Verfassungstext Instrumente, die den durch das Grundgesetz errichteten demokratischen Status quo vor zukünftigen Umwürfen schützen sollten. Mit dem Parteiverbotsartikel 21 Abs. 2 GG bietet sich demnach die Möglichkeit, Parteien, die gegen die freiheitliche demokratische Ordnung operieren, durch ein weit reichendes Verbot aus dem politischen Prozess auszuschließen. Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland fand das Instrument des Parteiverbots erst fünfmal Anwendung, wobei nur die ersten beiden Verfahren in den Jahren 1952 und 1956 zu einem tatsächlichen Parteiverbot führten. Aus diesem Grund gilt es in dieser Hausarbeit zu fragen, wie aktuell und zukunftsträchtig ein Parteiverbot in heutiger Zeit noch ist.
Dazu soll zuerst das Konzept der streitbaren Demokratie, in das sich das Parteiverbotsinstrument einordnen lässt, erläutert werden. Weiterhin sollen im zweiten Schritt die Bestimmungen zum Parteiverbot dargestellt und die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Parteiverbot erklärt werden. Anhand der Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) von 1952, der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) von 1956, sowie dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren von 2003, soll der Wandel des Verbotsinstruments von der symbolträchtigen schärfsten Waffe der Demokratie hin zu einem durch die Konkretisierung der Verbotsprinzipien durch das Bundesverfassungsgericht schwerer handhabbaren Instrument beschrieben werden, dessen aktuelle Einsatzfähigkeit, sowie vor allem Notwendigkeit, heute vielfach bezweifelt wird. Eben diese Frage nach der Zukunftsperspektive des Parteiverbots soll zum Abschluss der Arbeit thematisiert und anhand mehrerer Autorenmeinungen und mit hauptsächlichem Bezug zum NPD-Verbotsverfahren problematisiert werden, sodass sich am Ende ein zusammenhängendes Bild aus geschichtlicher Entwicklung und aktuellen Sichtweisen ergibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Konzeption der streitbaren Demokratie
- Das Instrument des Parteiverbots nach Art. 21 Abs. 2 GG
- Begriffsbestimmung
- weiterführende Erläuterung
- Konkretisierung des Parteiverbotsverfahrens durch das Bundesverfassungsgericht
- SRP-Verbot 1952: Abgrenzung von der eigenen Vergangenheit
- KPD-Verbot 1956: Abkehr vom Legalitätsprinzip
- Gescheitertes NPD-Verbot 2003: Staatsfreiheit & V-Mann-Problem
- Welche Zukunft hat das Instrument des Parteiverbots?
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Instrument des Parteiverbots im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Kontext des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Sie untersucht die Entwicklung des Parteiverbots als Schutzmechanismus gegen den Missbrauch der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung dieses Instruments in der heutigen Zeit ergeben.
- Die Konzeption der streitbaren Demokratie als theoretischer Rahmen für das Parteiverbot
- Die rechtlichen Bestimmungen des Parteiverbots nach Art. 21 Abs. 2 GG und die Kriterien für seine Anwendung
- Die historische Entwicklung des Parteiverbots anhand der Verfahren gegen die SRP, die KPD und die NPD
- Die aktuelle Debatte um die Zukunft des Parteiverbots und die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung dieses Instruments in der heutigen Zeit ergeben
- Die Bedeutung des Parteiverbots für den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und die politische Stabilität der Bundesrepublik Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Hausarbeit führt in die Thematik des Parteiverbots ein und erläutert die Bedeutung dieses Instruments für den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Aktualität und Zukunftsperspektive des Parteiverbots in der heutigen Zeit.
Im zweiten Kapitel wird das Konzept der streitbaren Demokratie als theoretischer Rahmen für das Parteiverbot vorgestellt. Es werden die Merkmale der streitbaren Demokratie wie Wertgebundenheit, Abwehrbereitschaft und Vorverlagerung erläutert und ihre Bedeutung für den Schutz der Demokratie vor extremistischen Bestrebungen herausgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Instrument des Parteiverbots nach Art. 21 Abs. 2 GG. Es werden die rechtlichen Bestimmungen des Parteiverbots und die Kriterien für seine Anwendung erläutert. Der Begriff des Anhängers, der Bedeutung der Ziele und des Verhaltens der Partei sowie die Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland werden näher beleuchtet.
Das vierte Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Parteiverbots anhand der Verfahren gegen die SRP, die KPD und die NPD. Es wird gezeigt, wie sich die Anwendung des Parteiverbots im Laufe der Zeit gewandelt hat und welche neuen Hürden für zukünftige Verbotsverfahren durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entstanden sind.
Das fünfte Kapitel diskutiert die aktuelle Debatte um die Zukunft des Parteiverbots und die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung dieses Instruments in der heutigen Zeit ergeben. Es werden verschiedene Argumente für und gegen die Anwendung des Parteiverbots diskutiert und die Bedeutung des Instruments für den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und die politische Stabilität der Bundesrepublik Deutschland bewertet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Parteiverbot, die streitbare Demokratie, das Bundesverfassungsgericht, die freiheitliche demokratische Grundordnung, das Legalitätsprinzip, das Opportunitätsprinzip, die SRP, die KPD, die NPD, Rechtsextremismus, Verfassungsschutz, Staatsfreiheit und die Zukunft des Parteiverbots.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die rechtliche Grundlage für ein Parteiverbot in Deutschland?
Die rechtliche Grundlage ist Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) in Verbindung mit dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
Warum wurde das Instrument des Parteiverbots geschaffen?
Es wurde als Lehre aus der Weimarer Republik installiert, um die demokratische Ordnung vor Parteien zu schützen, die diese auf legalem Wege untergraben wollen (Konzept der streitbaren Demokratie).
Welche Parteien wurden in der Geschichte der BRD bereits verboten?
Bisher wurden nur zwei Parteien verboten: die Sozialistische Reichspartei (SRP) im Jahr 1952 und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) im Jahr 1956.
Warum scheiterte das NPD-Verbotsverfahren im Jahr 2003?
Das Verfahren scheiterte primär an der mangelnden Staatsfreiheit aufgrund der Präsenz von V-Leuten des Verfassungsschutzes in der Führungsebene der Partei.
Was bedeutet „streitbare Demokratie“?
Das Konzept beschreibt eine Demokratie, die nicht wertneutral gegenüber ihren Feinden ist, sondern sich aktiv und mit rechtlichen Mitteln gegen Bestrebungen zur Abschaffung der freiheitlichen Grundordnung wehrt.
Wird das Parteiverbot heute als effektiv angesehen?
Die Arbeit problematisiert, dass das Instrument durch die Konkretisierung der Hürden durch das Bundesverfassungsgericht schwer handhabbar geworden ist und seine aktuelle Notwendigkeit oft bezweifelt wird.
- Quote paper
- André Herrmann (Author), 2011, § 21 Abs. 2 GG - Von der Abstumpfung der schärfsten Waffe des Grundgesetzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203232