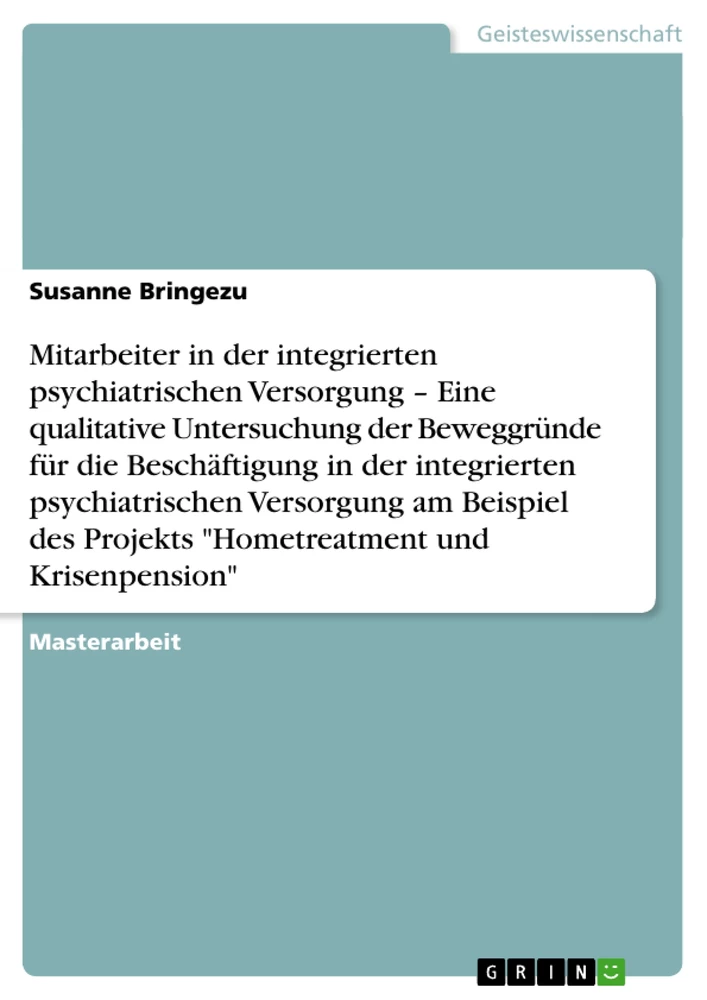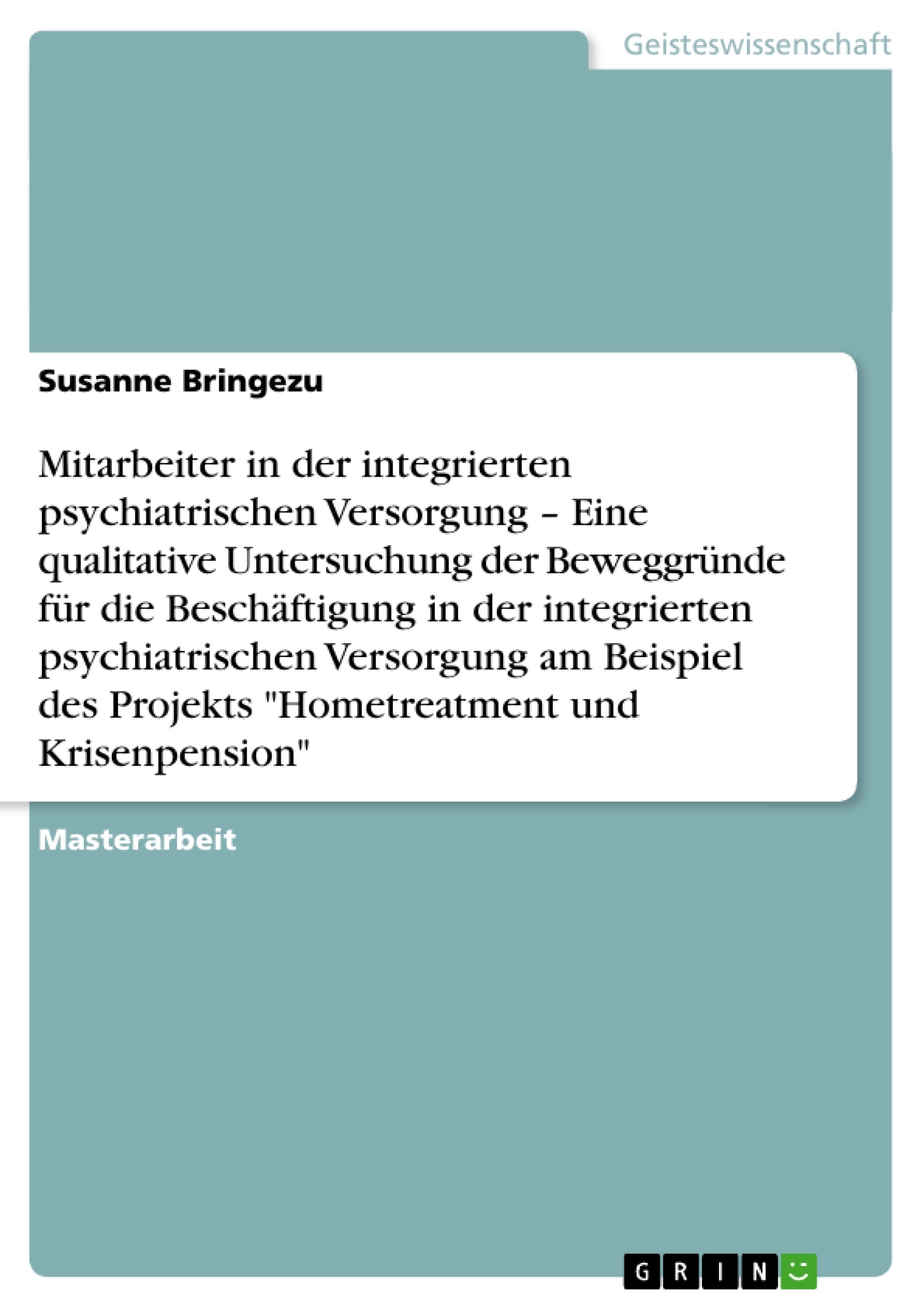Diese Masterthesis ist eine qualitative Studie, die untersucht hat, welche Beweggründe Personen haben, in der integrierten psychiatrsichen Versorgung tätig zu werden.Der vorangehende theoretische Teil beschäftigt sich ausführlich mit der integrierten psychiatrischen Versorgung. Dann wird auf die Bedeutung der Mitarbeiter eingegangen, ohne die integrierte psychiatrische Versorgung nicht stattfinden könnte.
Für die Hauptfragestellung wurden 3 Interviews mit Mitarbeitern geführt, die in einem Projekt der integrierten psychiatrischen Versorgung tätig sind. Diese Interviews wurden anhand der qualitativen Inhaltsanaylse ausgewertet und interpretiert.Ziel dabei war es, herauszufiltern, welche Beweggründe entscheidend sind, als Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung tätig zu werden, und wie diese Beweggründe aus der Sicht der Mitarbeiter aufrechterhalten werden können.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Theoretische Grundlagen der integrierten Versorgung
1.1 Integrierte V ersorgung in der Gemeindepsychiatrie - Chancen und Möglichkeiten
1.2. Theoretische Grundlagen psychosoziale Therapien
2. Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung
2.1 Aufgaben der Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung
2.1.1 Bedeutung der Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen V ersorgung
2.1.2 Belastungen der Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung
3. Hinleitung zur empirischen Fragestellung
3.1 Integrierte psychiatrische Versorgung am Beispiel des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ der Pinel gGmbH
3.1.1 Entwicklung des „Netzwerks psychische Gesundheit“ (NwpG)
3.1.2 Theoretische Darstellung des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“
3.1.3 Aufgaben der Mitarbeiter im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“
3.1.4 Motive der Arbeitsplatzwahl
3.1.5 Das Handlungsphasenmodell von Heckhausen und Gollwitzer
3.1.6 Empirische Hauptfragestellung
4. Methodisches Vorgehen
4.1 Darstellung und Begründung der qualitativ methodischen Vorgehensweise
4.1.1. Darstellung der Erhebungsmethode
4.1.2 Konstruktion des Leitfadens
4.2. Datenerhebung
4.2.1 Auswahl der Interviewpartner
4.2.2 Durchführung der Interviews
4.3 Aufbereitung der Daten
4.3.1 Transkription
4.3.2 Auswahl der Interviews für die Transkription
4.4 Darstellung der Auswertungsmethode
5. Darstellung der Untersuchungsergebnisse
5.1 Einzelfalldarstellung
5.1.1 Interview mit Frau A
5.1.2 Interview mit Frau B
5.1.3. Interview mit Herrn C
5.1.4 Ergebnisdarstellung
6. Diskussion
6.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
6.2. Ausblick
7. Schlussbemerkung
8. Literaturverzeichnis
9. Eidesstattliche Erklärung
10. Anhang
Danksagung
Mit dem Schreiben dieser Masterthesis geht ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben zu Ende. Obwohl auf dem Zeugnis allein mein Name stehen wird, haben wichtige Menschen dazu beigetragen, dass ich diesen bedeutenden Schritt gehen konnte
Allen voran natürlich meine Eltern. Den Grundstein für alles was ich bin und für alles was noch kommen wird, habt ihr gelegt. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Weiterer Dank gilt auch meiner lieben Schwester und ihrem Freund Sven und natürlich meinem kleinen Prinzen Paul. Das Lächeln von Paul und euer Stolz haben mich so manchen Stress vergessen lassen
Und dann gibt es noch den wichtigsten Menschen in meinem Leben, meinen Freund Marco. Du hast nicht nur die Erfolge des Studiums mit mir gefeiert, sondern auch die Schattenseiten des Studiums mit mir durchgestanden. Das werde ich dir nie vergessen!
Ein ganz herzlicher Dank gilt auch dem Betreuer dieser Masterthesis Professor Mark Helle. Sie haben für uns den Kontakt zum Projekt hergestellt, und somit den Grundstein für diese Masterthesis gelegt
Ein ganz besonderer Dank richtet sich natürlich an meine Interviewpartner. Ich danke euch für euer Vertrauen und für eure Offenheit, und für die Bereitschaft, sich Zeit für ein Interview zu nehmen. Ihr habt einen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Untersuchung möglich geworden ist!
Abstract
Theoretischer Hintergrund: Beispielhaft für integrierte psychiatrische Versorgung steht das Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ in Berlin. In diesem Projekt werden Klienten mit psychiatrischen Störungen durch Mitarbeiter des Projekts entweder zu Hause und bei Bedarf auch in einer Krisenpension betreut. Die Erreichbarkeit für die Klienten ist verschieden gestaffelt: die Nutzer des Netzwerks haben die Diensthandynummer ihres Bezugsbegleiters, der entweder direkt erreichbar ist, oder werktags innerhalb von 24h zurückruft. Des Weiteren gibt es an sieben Tagen rund um die Uhr eine Klienten-Hotline für den Notfall, und einen Hintergrunddienst für Bezugsbegleiter. Auch die Krisenpension ist 24 h an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Insgesamt besteht der Ansatz darin, in einer Krise sofort zur Verfügung zu stehen. Damit unterscheidet sich die Tätigkeit im Projekt deutlich von der Tätigkeit im stationären psychiatrischen Bereich. Aufgrund dieser Aspekte, wurde die nachfolgende Fragestellung entwickelt
Fragestellung: Welche Beweggründe haben dazu geführt, als Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung tätig zu werden, und wie können diese erhalten bleiben. Methode: Zur Beantwortung dieser Frage wurde anhand ausgewählter Literatur ein Interviewleitfaden erstellt und verwendet. Dieser diente als Grundlage für drei problemzentrierte Interviews mit Mitarbeitern des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“. Zur Auswertung dieser Interviews wurde die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring verwendet
Ergebnisse: Ein Ergebnis dieser Thesis ist eine ausführliche Darstellung der gebildeten Kategorien in Bezug auf die Fragestellung. Es hat sich gezeigt, dass die drei Interviewpartner übereinstimmende als auch individuelle Beweggründe genannt haben. Auch bei der Aufrechterhaltung der Beweggründe wurden von jedem Interviewpartner individuelle Aspekte erläutert
Schlussfolgerungen: Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung lassen sich Tendenzen ableiten. So wurde übereinstimmend berichtet, dass ein Beweggrund im Projekt tätig werden zu wollen, der Ansatz der Gemeindepsychiatrie ist. Dadurch sei es den Mitarbeitern möglich, Menschen mit psychischen Störungen direkt in ihrem Lebensumfeld zu begleiten. Die Interviewten berichteten aber auch, dass die unregelmäßigen Arbeitszeiten ein möglicher Grund für einen Ausstieg aus dem Projekt wären
Einleitung
Der Gesetzgeber verfolgt mit der integrierten Versorgung das Ziel der Qualitätsverbesserung und der Kostenreduzierung durch eine Förderung des Wettbewerbs unterschiedlicher Versorgungsstrukturen (Amelung, Meyer-Lutterloh, Schmid, Seiler, Lägel & Weatherly, 2008). Die integrierte Versorgung soll die Wirtschaftlichkeit erhöhen, d.h. die Ausgaben der Krankenkassen senken oder zumindest künftige
Ausgabensteigerungen mindern (Fritze, 2003). Dies ist auch im psychiatrischen Bereich sehr wichtig, da der andauernde Abstimmungsbedarf zwischen ambulanten Behandlern, psychosozialen Helfern sowie den Kliniken und Abteilungen bei „Problempatienten“ unbestreitbar ist. Dabei sind die ökonomischen Verluste aufgrund fehlender Koordination und Systemintegration eklatant. Einzelne örtliche Krankenkassen haben diese Entwicklung erkannt, und nehmen deshalb die ambulante Gemeindepsychiatrie als innovativen Verhandlungs- und Vertragspartner für komplexe Leistungen nach SGB V ernst. (Faulbaum - Decke & Zechert, 2010). In B. wird diese Idee in dem Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ umgesetzt. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden gemeindenah zu Hause betreut, oder können rund um die Uhr eine Krisenpension als vorläufigen Aufenthaltsort nutzen.
Es ist ersichtlich, dass den Mitarbeitern in der integrierten psychiatrischen Versorgung eine entscheidende Rolle für das Gelingen von integrierter psychiatrischer Versorgung zukommt. Durch die ständige Erreichbarkeit der Mitarbeiter als auch die Betreuung zu Hause können stationäre Aufenthalte verhindert werden. Diese Möglichkeit haben Mitarbeiter in der stationären Versorgung nicht.
Aufgrund dieser Tatsache, wurde die Fragestellung entwickelt, welche Beweggründe dazu geführt haben, als Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung tätig zu werden, und wie diese aufrechterhalten werden können.
Beispielhaft dafür stehen drei Mitarbeiter des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“, die sich zu einem Interview bereit erklärt haben.
Der aktuelle Forschungsstand bezüglich Arbeitsmotivation bezieht sich ausschließlich auf die Untersuchung von Arbeitszufriedenheit im Arbeitsprozess oder auf die Motivationssteigerung von Arbeitnehmern. Jedoch gibt es keine Literatur oder Studien, die die Beweggründe untersuchen, als Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung tätig geworden zu sein. Vor diesem Hintergrund entstand das Anliegen, die nachfolgende Untersuchung diesem Thema zu widmen, damit ein Einblick in die Beweggründe der Mitarbeiter gegeben werden kann. Somit wird es möglich, für zukünftige Arbeitnehmer Anreize zu schaffen, um neue Mitarbeiter für die integrierte Versorgung zu gewinnen. Des Weiteren widmet sich diese Untersuchung der Frage, wie die genannten Beweggründe aufrechterhalten werden können. Dieser Punkt ist von besonderer Bedeutung, da daraus Ideen abgeleitet werden, wie Mitarbeiter „gehalten“ werden können.
1. Theoretische Grundlagen der integrierten Versorgung
Integrierte Versorgung kann in ihrer einfachsten Form als Schnittstellen - und Fachdisziplinen übergreifende Versorgung verstanden werden, wobei diese Definition nur unzureichend das komplexe Themenfeld der integrierten Versorgung abbildet.
Grundsätzlich kann die integrierte Versorgung in drei Ebenen dargestellt werden: die Produktintegration umfasst die klassische indikationsspezifische Versorgung, dabei stehen auf der einen Seite Disease Management- Programme z.B. für Diabetes, deren Ziel darin besteht, die Optimierung der Kommunikations- und Koordinationsprozesse auf verschiedenen Leistungsebenen zu erreichen. Auf der anderen Seite stehen die Komplexfallpauschalen, die ein primär wirtschaftlich optimiertes Leistungsbündel für eine bestimmte Indikation repräsentieren (vgl. Amelung, Meyer-Lutterloh, Schmid, Seiler, Lägel & Weatherly, 2008).
Bei der Institutionen - Integration gibt es wiederrum zwei Ebenen: die horizontale Integration bezeichnet die Zusammenführung mehrerer ähnlicher Organisationen in einem System. Intention ist dabei, Effizienzgewinne zu realisieren und Marktanteile zu gewinnen. Als Folge daraus entstehen z.B. Ärztenetze oder Krankenhausketten. Die vertikale Integration hingegen beschreibt die Einbeziehung von vor- oder nachgelagerten Versorgungsstufen oder Dienstleistungen, wodurch das angebotene Leistungsprogramm ausgedehnt wird. Ziel ist es, die Wertschöpfungskette zu komplettieren und einen kontinuierlichen Patientenfluss sicherzustellen (Amelung, Meyer-Lutterloh, Schmid, Seiler, Lägel & Weatherly, 2008).
Die integrierte Versorgung wurde mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 eingeführt, angestrebt wurde dabei die Abschottung zwischen den ambulanten, stationären und rehabilitativen Versorgungssektoren zu überwinden. Das ist immer dann wünschenswert, wenn im Krankheitsverlauf Leistungen aus allen drei Sektoren medizinisch notwendig sind, und je mehr der Krankheitsverlauf zu Chronifizierung und Rezidiven neigt. Darüber hinaus erhofft man sich durch bessere Koordination der Behandlungskomponenten auch bessere Behandlungsqualität und somit ebenfalls bessere Behandlungsergebnisse (Fritze, 2003).
Von dieser gesetzlichen Möglichkeit ist in der Vergangenheit kaum Gebrauch gemacht worden, die Gründe dafür liegen in der Komplexität der gesetzlichen Vorgaben als auch darin, dass z.B. Krankenhäuser in solchen Verträgen Erweiterungen ihrer ambulanten Behandlungsmöglichkeiten erreichen wollen, dies jedoch mit den Interessen der ambulant tätigen Berufsgruppen kollidiert. Vermutlich bestehen zusätzliche grundlegende Bedenken potenzieller Vertragspartner darin, ökonomische Verantwortung an integrierte Versorgungsnetze abzugeben, da solche Netzwerke im Rahmen von Modellvorhaben oder Strukturverträgen ökonomisch bisher wenig erfolgreich waren (Fritze, 2003).
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach Maßgabe der Gesundheitsreform 2000 (§140 a - h SGB V) die geschlossenen Rahmenbedingungen zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung dazu führten, dass entsprechende Anreize zur Teilnahme der Leistungserbringer kaum absehbar waren, zudem konnten die Einzelverträge durch die Kassenärztliche Vereinigung blockiert werden (Mühlbacher & Ackerschott , 2007).
Mit dem zum 01.01. 2004 in Kraft getretenen GKV-Modernisierungsgesetz hat die Politik einen neuen Anlauf genommen, um das Konzept der integrierten Versorgung zu vitalisieren (Fritze, 2003). Mit diesem Gesetz entwickelte sich eine Neufassung der §140 a- d SGB V, diese ermöglicht eine erheblich flexiblere vertragliche Ausgestaltung der integrierten Versorgung, insbesondere wird die Initiative allein der einzelnen Krankenkasse übertragen, wobei die bisherige Zulassung oder Ermächtigung zur vertragsärztlichen Versorgung nicht vorausgesetzt wird. Gemäß § 140a SGB V können die Krankenkassen Verträge mit Vertragspartner abschließen, so dass eine interdisziplinär - fachübergreifende Versorgung möglich wird (Mühlbacher & Ackerschott, 2007; Fritze, 2003; Simon, 2008).
Die Neuregelungen beziehen sich auch auf das gesetzlich vorgeschriebene Finanzierungssystem der integrierten Versorgung, so wurde für die Jahre 2004 bis 2006 eine Anschubfinanzierung im Volumen von bis zu 1% der vertragsärztlichen Gesamtvergütung und der Krankenhausbudgets geschaffen, diese Anschubfinanzierung wurde bis 2008 verlängert.
So sieht das Finanzierungssystem der integrierten Versorgung vor, dass die Krankenkassen die Gesamtvergütung Kassenärztlicher Vereinigungen und die Budgets der Krankenhäuser um bis zu 1% kürzen dürfen, um zusätzliche Leistungen im Rahmen einer vertraglich vereinbarten integrierten Versorgung zu schaffen, bundesweit handelt es sich dabei um ein Volumen von ca. 700 Mio. Euro (Simon, 2008; Fritze, 2003). Wichtig ist dabei festzuhalten, dass die Krankenkassen nicht pauschal und im Voraus kürzen dürfen, sondern nur, wenn sie Verträge abgeschlossen haben und auch nur in dem Umfang, wie dies zur Finanzierung der abgeschlossenen Verträge notwendig ist (Simon, 2008).
Der Gesetzgeber verfolgt mit der integrierten Versorgung das Ziel der Qualitätsverbesserung und der Kostenreduzierung durch eine Förderung des Wettbewerbs unterschiedlicher Versorgungsstrukturen (Amelung, Meyer-Lutterloh, Schmid, Seiler, Lägel & Weatherly, 2008). Die integrierte Versorgung soll die Wirtschaftlichkeit erhöhen, d.h. die Ausgaben der Krankenkassen senken oder zumindest künftige Ausgabensteigerungen mindern. Das wesentliche Interesse der Krankenkasse an der integrierten Versorgung liegt also primär darin, Ausgaben zu senken (Fritze, 2003). Es sollte den Krankenkassen aber nicht abgesprochen werden, dass auch eine Verbesserung der Ergebnisqualität zugunsten der Versicherten angestrebt wird (Fritze, 2003).
Fakt ist auch, dass der stationäre Leistungssektor mit rund 35% der Leistungsausgaben der Krankenkassen den größten Block darstellt. Von daher biete sich hier das größte Einsparpotenzial. Ziel der Krankenkassen ist demzufolge, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden und zu verkürzen, ein weiteres Ziel besteht in der Senkung der Arzneimittelausgaben sowie die Reduzierung der Ausgaben für ärztliche Behandlungen (Fritze, 2003).
Wie können diese Ziele nun erreicht werden? Diese Ziele lassen sich erreichen, indem grundsätzlich einzelvertraglich Entgelte vereinbart werden, die unter den derzeitigen Entgelten liegen. Dies lässt sich am ehesten erreichen, indem Entgelte für Leistungskomplexe vereinbart werden, die ambulante und stationäre Leistungen umfassen (Fritze, 2003).
Dabei sei kritisch angemerkt, dass durch den Erfolg der integrierten Versorgung der Regelversorgung mehr Geld entzogen wird. Zu den Verlierern gehören die, die am Ende aus dem Kreis der Leistungserbringer ausscheiden (Fritze, 2003).
Mühlbacher und Ackerschott (2007) bezeichnen die integrierte Versorgung sogar als ein Novum und als einen tiefgreifenden Umbruch im deutschen Kollektivvertragssystem.
1.1 Integrierte Versorgung in der Gemeindepsychiatrie - Chancen und Möglichkeiten
Welche Chancen und Möglichkeiten die integrierte Versorgung für die Gemeindepsychiatrie bietet, ist in der Literatur auf unterschiedliche Arten beschrieben.
Als erstes stellt sich folgende Frage: Warum integrierte Versorgung in der Gemeindepsychiatrie, wo es doch eine Versorgungsform ist, bei der Kostenersparnisse vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht sind? (FaulbaumDecke & Zechert, 2010).
Die Durchsetzung der integrierten Versorgung ist wichtig, da die Quote der Wiederaufnahmen im stationären Bereich mit bis zu 80% extrem hoch ist. Die ständig ansteigende Zahl der klinischen Aufnahmen bei gleichzeitiger Budgetierung führt die Kliniken zudem an ihre personellen und fachlichen Grenzen. Der andauernde Abstimmungsbedarf zwischen ambulanten Behandlern, psychosozialen Helfern sowie den Kliniken und Abteilungen bei „Problempatienten“ ist unbestreitbar, dabei sind die ökonomischen Verluste aufgrund fehlender Koordination und Systemintegration eklatant. Einzelne örtliche Krankenkassen haben diese Entwicklung erkannt, und nehmen deshalb die ambulante Gemeindepsychiatrie als innovativen Verhandlungs- und Vertragspartner für komplexe Leistungen nach SGB V ernst. Die gemeindepsychiatrischen Träger beteiligen sich aktiv an der Behandlung von Menschen mit psychischen Störungen, und realisieren so, was der Gesetzgeber mit den § § 140 a -d als integrierte Versorgung beabsichtigte, beispielsweise die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen im medizinischen Bereich zu verbessern, das Gesundheitssystem durch Überwindung der versäulten Strukturen effizienter zu gestalten sowie qualitative Gewinne durch innovative Behandlungsformen für Patienten und Angehörige zu gewährleisten (Faulbaum - Decke & Zechert, 2010).
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die klassische Behandlungskette (Akutstation, Rehabilitationsstation, ambulante Therapie) als gescheitert angesehen werden muss, da besonders die Übergänge immer wieder zu Problemen führen. Es müssten Behandlungsmodelle favorisiert werden, wo die Behandlungskontinuität gewahrt bleibt und die therapeutischen Beziehungen weniger stark vom Setting bestimmt werden (Damman, 2007).
Beispielhaft steht dafür das Modell „Integrative Psychiatrische Behandlung“ des Krefelder Alexianer Krankenhauses ein. Ziel dieses Modells war eine möglichst umfassende, ortsgebundene Krankenhaus - Akutbehandlung ohne Klinikbett, dabei orientierte sich dieses Modell an der gemeindeintegrierten Akutversorgung, die seit den 70er Jahren im englischen Sprachraum erprobt wurde (Damman, 2007).
Anhand dieses Modells können weitere Möglichkeiten und Chancen der integrierten psychiatrischen Versorgung abgeleitet werden: durch die Vernetzung von klinischen und ambulanten/komplementären Ressourcen werden Synergien freigesetzt, die unter der strikten Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung verloren gehen würden. Das eingesetzte Hometreatment in diesem Modell trägt zusätzlich zur Umfeldbeobachtung bei, was wiederrum zu einer Erweiterung diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten führt (Damman, 2007).
Dabei ist zu erwähnen, dass die wichtigsten gemeindeintegrierten Ansätze zur Behandlung akuter Krankheitsverläufe in Studien bezüglich der Symptomreduktion keine Vorteile aufwiesen, sie führten jedoch im Vergleich zu einer Reduktion stationärer Aufnahmen, höherer Zufriedenheit und zu einer besseren sozialen und versorgungsmäßigen Integration der Patienten (Damman, 2007).
Bei dem Modellprojekt „Regionales Psychiatrie-Budget Itzehoe“ erhielten die psychiatrischen Kliniken einer Region über 5 Jahre ein festes jährliches Budget und verpflichteten sich, die psychiatrische und psychotherapeutische Betreuung der Patienten einer Region sicherzustellen, die durch einen Vertragsarzt in die Klinik eingewiesen wurden oder die die Kriterien für die Behandlung durch die Institutsambulanz einer Klinik erfüllten. Ziel war neben der integrierten Versorgung vor allem der Einbezug nichtstationärer Ansätze der Akutbehandlung, um den Kostenanstieg zu begrenzen und den Drehtüreneffekt zu reduzieren (Weinmann, Puschner & Becker, 2009)
Die wissenschaftliche Begleitung dieses Projekts im Rahmen von kontrollierten Vorher - Nachher- Designs zeigte nach 1,5 Jahren, dass die Kosten stationärpsychiatrischer Versorgung insbesondere für Menschen mit einer schizophrenen Störung im Vergleich zu einer Kontrollregion mit Routineversorgung reduziert werden konnten. Gemessen an der Psychopathologie, der Lebensqualität und dem sozialen Funktionsniveau war die Versorgungsqualität dabei nicht eingeschränkt (Weinmann, Puschner & Becker, 2009; Deister, Zeichner & Roick; 2004).
Wie können nun die Chancen und Möglichkeiten der integrierten Versorgung in der Gemeindepsychiatrie erhalten bleiben?
Hier lohnt es sich u.a. einen Blick nach England zu werfen. Dort sind ambulante multiprofessionelle gemeindepsychiatrische Teams das Zentrum des National Health Service. Diese Teams steuern den Zugang zur Primärversorgung, zur sekundären psychiatrischen einschließlich der (teil-) stationären Behandlung sowie zum tertiären Bereich mit spezialisierten Diensten z.B. in Form von Krisenintervention (Kunze & Priebe, 2006).
Um eine langfristige Optimierung und Funktionalität der intergerierten Versorgung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Praxiserfahrungen aufmerksam reflektiert werden, um zu vergleichen, inwieweit Umsetzungsprozesse erfolgreich sind bzw. Weiterentwicklungen notwendig werden. Eine langfristig erfolgreiche Implementierung und Erweiterung integrierter Versorgungssysteme kann nur dann erreicht werden, wenn strukturgebende und auf die Praxis abgestimmte Leitlinien und Maßnahmen zur Seite gestellt werden. Ein so gefestigtes Versorgungssystem wird folglich in der Lage sein, auf neue Bedürfnisse und Erweiterungen schnell und anpassungsfähig zu reagieren, ohne dass es an Flexibilität verliert. Nicht zuletzt ist dafür ein stetiger Informationsfluss zwischen Theorie und Praxis sowie zwischen Praktikern und Interessenten notwendig (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), 2007).
1.2.Theoretische Grundlagen psychosoziale Therapien
Die Therapie psychischer Störungen umfasst unterschiedliche Methoden, dabei lassen sich vereinfacht drei Ansätze beschreiben: die somatotherapeutischen Verfahren (z.B. Pharmakotherapie), die psychotherapeutischen Verfahren und die psychosozialen Therapien. In der Praxis werden diese Methoden sehr häufig in Kombination angewandt, sie schließen sich also gegenseitig nicht aus (Gaebel & Falkai, 2005).
Der Begriff „Psychosoziale Therapien“ orientiert sich an der aktuellen angloamerikanischen Bezeichnung „psychosocial therapy“, darunter werden unter anderem Interventionen wie social skills training, Familieninterventionen, multiprofessionelle gemeindepsychiatrische Teams (Community Mental Health Teams), aufsuchende gemeindepsychiatrische Teambehandlung (Assertive Community Treatment), mobile Kriseninterventionsteams (Hometreatment) oder auch case management Programme zusammengefasst (Gaebel & Falkai, 2005).
Im deutschsprachigen Raum wird mehrheitlich der Begriff Soziotherapie gebraucht, der weitestgehend synonym ist. Eine allgemein akzeptierte Definition und Abgrenzung existiert weder für Psychosoziale Therapie noch für Soziotherapie (Gaebel & Falkai, 2005).
Das Vorliegen krankheitsbedingter Einschränkungen im praktischen und sozialen Handeln ist ein allgemeines Indikations-Kriterium psychosozialer Therapieverfahren. Die Differentialindikation richtet sich vorzugsweise nach den Kriterien der Einschränkungen und Behinderungen, die selbst primär Gegenstand der Behandlung werden (Gaebel & Falkai, 2005).
Die psychosozialen Therapien zielen dabei auf die therapeutische Beeinflussung psychischer Störungen ab, indem Interventionen im sozialen Umfeld des Patienten stattfinden. Zudem haben diese Interventionen die Absicht, eine Veränderung der Interaktion zwischen dem Patienten und seiner Umgebung zu erreichen (Gaebel & Falkai, 2005).
Seit Januar 2002 ist der Begriff Soziotherapie im SGB V der sozialen Gesetzgebung SGB V, § 37a verankert. Damit ist Soziotherapie als Bestandteil des Sicherstellungsauftrags der KV für niedergelassene Fachärzte (z.T. auch Hausärzte) festgelegt. Die Soziotherapie gilt für schwer chronisch psychisch
Kranke mit den Diagnosen aus der ICD F20-22, 24-25, 31.5, 32.3 und 33.3. Sie stellt eine nervenärztlich verordnete Unterstützung und Handlungsanleitung zur Überwindung krankheitsspezifischer Defizite dar, und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen im sozialen Umfeld.
Soziotherapie ist vor allem ein wichtiger Bestandteil der ambulanten psychiatrischen Rehabilitation. Dabei ist die Anwendung auf 120 Stunden innerhalb von drei Jahren begrenzt (Gaebel & Falkai, 2005).
Durch soziotherapeutische Maßnahmen sollen Krankenhausbehandlungen vermieden oder verkürzt werden. Leistungserbringer müssen dabei eigene Verträge gemäß den Empfehlungen der Spitzenverbände der Krankenkasse mit den einzelnen Krankenkassen schließen (Gaebel & Falkai, 2005).
Bereits im Jahr 2005 erfolgte die Veröffentlichung der S1-Leitlinien1 Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Seit März 2009 werden diese S1-Leitlinien auf dem S3-Niveau überarbeitet. Auftraggeber ist dabei die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN).
Ziel dieser überarbeiteten Leitlinien ist das systematische Zusammentragen der wissenschaftlichen Evidenz zu psychosozialen Therapien sowie die Ableitung entsprechender evidenzbasierter Empfehlungen (http://www.baygsp.de/download/fachvortragS3leitlinien.pdf).
Des Weiteren sollen diese auf dem S3-Niveau überarbeiteten Leitlinien den Leistungserbringern Orientierungspunkte zur Verhandlung mit Kostenträgern als auch zur Gestaltung ihres Angebots bieten (http://www.baygsp.de/download/fachvortragS3leitlinien.pdf ).[1] [2]
2. Mitarbeiter in der integrierten Versorgung
2.1. Aufgaben der Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung
In den meisten europäischen Ländern, in den USA und Australien gibt es bei der Behandlung psychisch kranker Menschen seit Jahrzehnten folgende Entwicklung: weg von großen Zentralkrankenhäusern hin zu kleinen Behandlungseinheiten, die für überschaubare Regionen zuständig sind. Die ambulante psychiatrische Tätigkeit soll den Erkrankten dabei helfen, ihren Alltag in den Gemeinden zu bewältigen. Der Hauptunterschied zwischen ambulanter und stationärer Arbeit liegt darin, dass die Betreuung in den Wohnungen der KlientenInnen stattfindet (Wolff, 2011).
Die Mitarbeiter arbeiten in der Regel aufsuchend, dadurch wird die Zuständigkeit der Mitarbeiter und ihre Angehörigen transparent. Da die Betreuung in der Lebenswelt des Klienten stattfindet und sich an den gewohnten Alltag des Klienten orientiert, müssen keine künstlichen Übungsfelder geschaffen werden. Durch das formulierte Ziel „Vermeidung von stationären Aufenthalten“ und aufgrund der persönlichen Zuständigkeit, werden die Mitarbeiter gedrängt, gemeinsam mit den Klienten Strategien zu entwickeln (Wolff, 2011).
Während des Hausbesuchs begibt sich der Mitarbeiter in die Rolle des Gastes, somit haben die KlientenInnen im ambulanten Bereich mehr Macht, im stationären Setting ist es genau umgekehrt. Der stationäre Bereich bietet den Mitarbeitern häufig klare Strukturen, in der ambulanten Arbeit ist es genau entgegengesetzt: jedes Zuhause, dass der Mitarbeiter aufsucht, ist ein neues Setting (Wolff, 2011).
Durch die direkte 1:1 Begegnung zwischen den Mitarbeitern und dem Klienten ergibt sich eine direkte Verantwortung für die erbrachte Tätigkeit, das macht eine lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation unerlässlich. Mitarbeiter dokumentieren jeden Kontakt, der mit den KlientenInnen stattgefunden hat, aus dieser Dokumentation muss ersichtlich werden, an welchen gemeinsamen Zielen Mitarbeiter und Klienten arbeiten. Von besonderer Wichtigkeit ist die Einschätzung des psychischen Status der KlientenInnen. Des Weiteren muss unbedingt belegt werden, dass die Intervention der Mitarbeiter im Umgang mit psychischen Symptomen und Suizidalität angemessen ist. Interventionen, die möglicherweise auf Fehleinschätzungen beruhen, fallen sofort auf die Mitarbeiter zurück, die u.U. für die Folgen haftbar gemacht werden (Wolff, 2011).
Die Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen bzw. Zwangsmedikation kann nur im Rahmen einer stationären Unterbringung durchgeführt werden. Für die ambulante Betreuung hat die Zusammenfassung mehrerer Gerichtsurteile ergeben, dass ambulante Zwangsbehandlungen und Zwangsmedikationen durch das Betreuungsrecht nicht begründet werden können. Für Mitarbeiter in der ambulanten psychiatrischen Behandlung bedeutet dies, psychisch kranke Menschen durch Krisen zu begleiten und ihnen dabei immer wieder lindernde Behandlungsmaßnahmen anzubieten, bis eine Bereitschaft entsteht, dass die KlientenInnen diese Maßnahmen annehmen. Möglicherweise bedeutet das aber auch, einen ungünstigen Krankheitsverlauf weitgehend tatenlos mit ansehen zu müssen (Wolff, 2011).
Neben diesen „pflegerischen“ Aufgaben kommen in der ambulanten psychiatrischen Arbeit besondere organisatorische Erfordernisse hinzu. So erfordert der aufsuchende Charakter dieser Tätigkeit, dass die Mitarbeiter ein Kraftfahrzeug zur Verfügung haben, dies ist besonders wichtig, wenn die Klientinnen z.B. transportiert werden müssen. Die Teamarbeit steht ebenfalls im Vordergrund, da durch den eigenständigen Charakter der Arbeit kollegiale Beratung innerhalb des Teams einen hohen Stellenwert besitzt. Mitarbeiter, die nicht in der Lage sind, Probleme in ihrer Arbeit wahrzunehmen und kritisch mit KollegenInnen zu reflektieren, können nicht ambulant tätig sein, da sie an ihre Grenzen geraten, und somit eventuell falsche Entscheidungen und Einschätzungen treffen.
Nicht zuletzt muss die Erreichbarkeit durch Mobiltelefone sichergestellt werden, damit die KlientInnen wissen, wen sie in Notfällen außerhalb der Sprechzeiten erreichen können (Wolff, 2011).
Zeemann, Chapman, Wynaden, McGowan, Luis und Finn (2002) fassen in ihrer Studie fünf charakteristische Aufgaben der ambulanten Arbeit zusammen: die erste Aufgabe besteht im Management des Alltags des Klienten, anderen Pflegeerbringern und der Angehörigen, so liegt der Schwerpunkt z.B. darauf, den Familien zu helfen oder die Funktion des Alltags aufrecht zu erhalten. Weiterhin führen die Mitarbeiter Kriseninterventionen bei ihren Klienten aber auch bei unbekannten Klienten durch z.B. wenn diese krankheitsbedingt keine anderen Behandler aufsuchen können. Somit verschaffen sie sich einen aktuellen Überblick über die Situation, unternehmen weitere Interventionen und vermitteln Kontakte zu anderen Gesundheitsfachpersonen. Die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsdiensten ist ebenfalls eine Aufgabe, so müssen die Mitarbeiter mit unterschiedlichen Dienstleistungserbringern zusammenarbeiten, damit die Integration der KlientInnen in die Gemeinde gelingt. Weil die Mitarbeiter in einem Team zusammenarbeiten, gehören zu ihren Aufgaben auch formelle und informelle Treffen, um ihre Arbeit zu planen und sich gegenseitig zu beraten. In Gruppenarbeiten werden z.B. in unterschiedlichen Gruppensettings Kompetenzen erarbeitet oder es werden gemeinsame Interessen von psychisch kranken Menschen zusammengeführt. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass ambulant tätige Mitarbeiter ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Eigenständigkeit erleben, sie werden vor Ort mit Befindlichkeitsverschlechterungen, Konflikten und Krisen konfrontiert, die sie handhaben müssen. Die Herausforderungen bestehen darin, dass sie KlientInnen zu Hause begegnen, denen es nicht gut geht und dass sie häufig mit Klienten an der Bewältigung psychotischer Symptome arbeiten (Zeemann, Chapman, Wynaden, McGowan, Luis & Finn, 2002).
Nicht zuletzt muss deutlich gemacht werden, dass es schwierig ist, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, da die Arbeit neben den Belastungen finanziell nicht attraktiv bezahlt wird (Kauder, 1997, zitiert nach Wolff, 2011, S. 1135).
2.1.1 Die Bedeutung der Mitarbeiter für die intergierte psychiatrische Versorgung
Im Kapitel 1.1 wurden bereits die theoretischen Hintergründe zur integrierten Versorgung dargestellt. Dabei beschreibt die Literatur vorrangig Akteure wie die Kassenärztliche Vereinigung oder Krankenkassen, selten werden die nichtärztlichen (Hilfs-)berufe genannt (Först, 2009).
Den Mitarbeitern in den Gesundheitseinrichtungen kommt eine besondere Bedeutung zu, da Gesundheitsleistungen auch größtenteils personale Dienstleistungen sind. Leistungserstellung, -Vermittlung und -abgabe erfolgen gleichzeitig, dies erfordert von den Mitarbeitern neben guten Fachkompetenzen auch ausgeprägte kommunikative und soziale Kompetenzen. Im Zusammenhang mit der integrierten Versorgung werden zusätzlich Kooperationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft notwendig, da die ziel- und patientenorientierte Zusammenarbeit mit verschiedenen Leistungsanbietern über die Grenzen der eigenen Einrichtung hinausgeht. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit integrierte Versorgung gut funktioniert (Güntert, 2006).
In dem System der integrierten Versorgung ergibt sich eine Fülle von Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten, diese müssen nicht nur erkannt, sondern auch genutzt werden (BGW, 2007). Dabei ist festzuhalten, dass es der Eingliederung weiterer Versorgungsbereiche und Dienstleistungen (v.a. die stationäre und ambulante Pflege als gleichwertige Leistungserbringer) bedarf. Zur Förderung und zur Sicherung der Ergebnisqualität der integrierten Versorgung ist es somit erforderlich, bestehende ganzheitliche Pflegekonzepte mit einzubeziehen (BGW, 2007).
Beispielhaft stehen dafür US-amerikanische Kliniken, in denen interdisziplinäre Teams eine zentrale Rolle spielen. Die Einführung von interdisziplinären Teams und Behandlungsstandards sowie die Aufwertung der Pflege sind verantwortlich für eine gute Prozesskoordination, die wiederrum zu einem effektiven und reibungslosen Ablauf der Versorgungskette beiträgt. Betont wird dabei die Bedeutung der Pflegekräfte als zentrale Akteure innerhalb der integrierten Versorgung. Es lässt sich erkennen, dass sie eine wesentliche Rolle innerhalb einer patientenorientierten Vernetzung der Versorgung haben, und ihnen eine Schnittstellenfunktion zukommt (BGW, 2007).
Insbesondere bei chronischen Erkrankungen ist ein reibungsloses Übergreifen von palliativen, präventiven, kurativen und rehabilitativen Versorgungsangeboten notwendig. So darf nicht einzig allein auf „cure“ fokussiert werden, sondern „care“ sollte gleichermaßen Beachtung finden (Schaefer & Ewers, 2006).
Hervorzuheben ist zudem das integrative Potenzial der Pflege[3] für die integrierte Versorgung: Pflege ist intersektorial, also in fast allen Versorgungsbereichen tätig, somit hat sie die Möglichkeit chronisch kranke Menschen durch das Auf und Ab der Krankheit als auch auf dem Weg durch das Versorgungssystem zu begleiten. Über weite Strecken des Versorgungsverlaufs ist die Pflege dem Patienten am nächsten und hat somit einen direkten Einblick in das Alltagsgeschehen als auch in das Versorgungsgeschehen. Veränderungen im Krankheitsverlauf und im Versorgungsbedarf, Folgen von unkoordinierter Versorgung und ergebnislose Suchbewegungen des Patienten durch das System werden sichtbar.
Die Pflege besitzt ein flexibles Rollenprofil, um Vernetzungs- und Integrationsaufgaben anzugehen. Auf diese Weise sichert sie das Ineinandergreifen von Versorgungsleistungen. Diese Erkenntnis hat in vielen Ländern ihren Niederschlag darin gefunden, dass der Pflege (nicht der Medizin), zentrale Integrations-, Steuerungs- und Koordinationsfunktionen zugeschrieben werden (Schaefer & Ewers, 2006).
Dieses Potenzial kann nur ausgeschöpft werden, wenn die bislang beteiligten Akteure umdenken, indem sie die Pflege nicht mehr als Restversorgungsinstanz betrachten, der lediglich dann eine Funktion eingeräumt wird, wenn die Möglichkeiten der Prävention, der Kuration und der Rehabilitation ausgeschöpft sind (Schaefers & Ewers, 2006).
Integrierte Versorgung greift nur dann, wenn die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Berufsgruppen in den Einrichtungen des Gesundheitswesens gesucht wird. Ärzte und Ärztinnen, Sozialarbeit, Management und der Zugang zu den Berufsgruppen angrenzender Gesundheitsbereiche sind notwendig, damit Versorgungsnetze entwickelt und aufgebaut werden können. Grundvoraussetzung für eine solche Vernetzung ist die Fähigkeit über die eigenen Interessen hinauszugehen und persönlich wie im Betrieb integrative Strategien zu entwickeln (InCareNet, 2007). 1 umsonst heißt ein Kapitel in ihrem Buch „Mehr Macht den Menschen: Die Mitarbeiter“ (Mosher & Burti, 1994, S. 248).
2.1.2 Belastungen der Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung
Anhand des Kapitels 2.1.2 wurde verdeutlicht, dass den Mitarbeitern in der integrierten psychiatrischen Versorgung eine entscheidende Rolle für das Gelingen von integrierter psychiatrischer Versorgung zukommt.
Jedoch darf nicht nur die Bedeutung der Mitarbeiter als zentrale Akteure innerhalb der integrierten Versorgung betont werden, sondern auch die Belastungen und die Gesundheitsgefährdungen ihrer Arbeitssituation müssen Beachtung finden (BGW, 2007).
Burnout ist eine Funktionsstörung der Seele und tritt offensichtlich sehr oft dort auf, wo Menschen an Arbeitsplätzen mit hoher sozialer Interaktion arbeiten, und das unter den Bedingungen von chronischer Belastung und Anspannung (Mosher & Burti, 1997).
Mosher und Burti (1997) beschreiben aus ihrer Erfahrung heraus das Symptom des Ausgebranntseins mit depressionsähnlichen Symptomen wie geringem Antrieb, Desinteresse, Reizbarkeit, Missstimmung sowie körperliche Erkrankungen. Dadurch ist die Sicht des Mitarbeiters auf den Patienten beeinflusst, Mitarbeiter sprechen über den Klienten dann eher in Form von Hoffnungslosigkeit, Chronizität und der Unfähigkeit zur Zusammenarbeit.
Des Weiteren weichen die Autoren von der herkömmlichen Sicht ab, Ausgebranntsein entstehe überwiegend aus der Arbeit mit dieser schwierigen Patientengruppe, aus der alltäglichen Frustration sowie dem Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit.
Mosher und Burti (1994) sehen dies zwar als wichtige Faktoren an, vielmehr sind sie jedoch der Meinung, dass Ausgebranntsein ein Produkt der Einrichtung, der Persönlichkeit der Mitarbeiter und der Klienten ist. Nach ihrer Auffassung liegt der Ursprung des Ausgebranntseins in der Entscheidungs- und Beziehungsstruktur der Einrichtung, so können Gründe für das Ausgebranntsein der Mitarbeiter z.B. darin bestehen, dass eine Einrichtung zu hierarchisch aufgebaut ist, den Mitarbeitern also keine Macht zukommt. Weitere Gründe sind nach Auffassung der Autoren zu viele von außen auferlegte Regeln als auch keine Autorität und Verantwortlichkeit vor Ort, unzusammenhängende und zu große Arbeitsgruppen, die ein „Team-Gefühl“ verhindern, zu viele Klienten und ein damit verbundenes Gefühl der Überflutung, und nicht zuletzt zu wenig Anregung und zu viel Routine, so dass letztendlich Entmutigung herrscht.
Die entscheidende Frage besteht laut den Autoren darin, ob sich die Mitarbeiter ermächtigt sehen und verantwortlich fühlen, augenblicksrelevante Entscheidungen zu treffen oder nicht. In welchem Maß diese Ermächtigung erfahren wird, und somit Ausgebranntsein verhindert, hängt von der Größe der Institution, der Anzahl der Stufen in der organisatorischen Leiter und der Organisation der Arbeitsgruppe ab. Nach Mosher und Burti (1994) sind es diese Variablen, die Ausgebranntsein abbauen oder aufbauen, und zwar auf allen Einkommensstufen.
Abschließend erfolgt von den Autoren die Bemerkung, dass eine angemessene Bezahlung Ausgebranntsein zwar mildert, es jedoch keinesfalls verhindert. Gerade in gemeindepsychiatrischen Zentren, die in das Zusammenspiel von Mit-Tätigen eingebettet sind, wird die Arbeitsorganisation darüber entscheiden ob ausgebrannte Mitarbeiter häufig oder selten vorkommen. Wie auch immer Einrichtungen in der Gemeindepsychiatrie organisiert sein sollten, sie müssen immer ein wachsames Auge auf die subtile, aber auch auf die gefährliche Gegenwart des Ausgebranntseins haben, das Verständnis für den Ursprung hilft dabei, es zu vermeiden oder aktiv zu behandeln, dabei sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter genauso wichtig wie die der Klienten (Mosher & Burti, 1994).
Die Erarbeitung des Unterkapitels 2.1.3 zeigt, wie wichtig die Mitarbeiter für die integrierte psychiatrische Versorgung sind, und das neben dieser enormen Bedeutung der Mitarbeiter auch vielfältige Belastungen für diese existieren.
Deshalb soll sich eine Unterfragestellung dieser Arbeit darauf beziehen, wie die Beweggründe in der integrierten psychiatrischen Versorgung tätig zu sein, aus der Sicht der Mitarbeiter aufrecht erhalten werden können.
3. Hinleitung zur empirischen Fragestellung
Bevor zur empirischen Fragestellung übergegangen wird, soll zunächst der Beginn des Netzwerks psychische Gesundheit dargestellt werden. Anschließend erfolgt die Beschreibung des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ sowie die Darstellung der Aufgaben der Mitarbeiter in diesem Projekt.
3.1 Integrierte psychiatrische Versorgung am Beispiel „Hometreatment und Krisenpension“ der Pinel gGmbH
3.1.1 Entwicklung des „Netzwerks psychische Gesundheit“ (NwpG)
Durch die in Deutschland vorherrschenden getrennten Verständnis- und Finanzierungstränge ist die Versorgung von Klienten eingeengt. Seit Beginn ihrer Geschichte war ein zentrales Ziel der „Pinel-Gesellschaft“ die Versorgung der Patienten aus dieser Einengung zu befreien, ausschlaggebend dafür waren auch die Erfahrungen mit ambulanten Basisdiensten in Italien.
Mal ging es um den beruflichen Wiedereinstieg, ein anderes Mal um Sozialhilfeleistungen, dann wiederrum um Rentenansprüche, aber selten ging es um den Menschen jenseits dieser Unterteilungen. Die erste Möglichkeit eine Brücke zu schlagen, ergab sich im Rahmen der Deinstitutionalisierung von Menschen aus Langzeitstationen in Berlin. Hier konnte erreicht werden, dass sich die Krankenkassen zumindest für eine kurze Zeit, an der Versorgung chronisch kranker Menschen jenseits der gesetzlich notwendigen Krankenversicherungsleistungen beteiligten. Während es damals um eher geringfügige Unterstützung ging, ermöglichen die Verträge zur integrierten Versorgung heute eine weit umfassendere Integration von Leistungen aus unterschiedlichen Sektoren. Beispielhaft steht dafür der aktuell von der Techniker Krankenkasse in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Gemeindepsychiatrie entwickelten IV-Vertrag, der in seiner Umsetzung ein Netzwerk psychische Gesundheit (NWpG) in Deutschland aufspannen will.
Von Seiten der Techniker Krankenkasse ist dieser Vertrag für alle interessierten Kassen offen, sie können demzufolge ohne großen Aufwand beitreten (Böckheler, 2010).
Mit diesem im Januar 2010 in Berlin in Kraft getretenen IV-Vertrag werden sich künftig gemeindepsychiatrische Träger in Berlin, Kiel, München, Lübeck, Preetz, Plön, Neumünster, Pinneberg, Itzehoe, Herzogtum Lauenberg, Hamburg, Bremen, Rostock, Stuttgart, Augsburg, Göttingen, Minden, Paderborn, Münster, Detmold, Solingen, Langenfeld, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Dresden sowie in weiteren Städten an der ambulanten Behandlung nach SGB V von Menschen mit psychischen Erkrankungen beteiligen (Faulbaum-Decke & Zechert, 2010).
Der offizielle Startschuss für das „Netzwerk psychische Gesundheit“ fiel in Berlin am 1. September 2009, wobei sich der Rahmen dieses Netzwerks, wie schon beschrieben, in einem Vertag zur IV entwickelt hat, der von der Techniker Krankenkasse in enger Zusammenarbeit mit anderen psychosozialen Trägern unter dem Dach des Dachverbands Gemeindepsychiatrie entwickelt wurde.
Als erster Vertragspartner der Techniker Krankenkasse hat die Berliner „Pinel- Gesellschaft“ mit ihrer Tochtergesellschaft der „MVZ-Pinel gGmbH“ begonnen, den Vertrag für Berlin und Brandenburg umzusetzen. „Pinel“ wurde nun durch die Techniker Krankenkasse mit dem Aufbau eines umfassenden Versorgungsnetzwerks für den ambulanten Sektor beauftragt, und übernimmt dabei die Funktionen einer Managementgesellschaft und organisiert eigenverantwortlich die Versorgungsinfrastruktur mit den entsprechenden Netzwerkpartnern. Als Vertragspartner übernimmt „Pinel“ zudem die Gesamtverantwortung für die Steuerung akuter Behandlungen und der kontinuierlichen Betreuung für alle in diesem Vertrag eingeschriebenen Versicherten (Kleinschmidt, 2010).
3.1.2 Theoretische Darstellung des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“
„Pinel“ bietet als Versorgungsanbieter Wohnbegleitung, Arbeit, Beschäftigung sowie Kontaktmöglichkeiten für mehr als 700 psychisch kranke Menschen in vier der zwölf Großbezirke Berlins an.
Als neuartige Form der nicht-klinischen Krisenversorgung wurde seit 2003 in einer Arbeitsgruppe des PSAG des Berliner Bezirks Tempelhof - Schöneberg die Idee einer Krisenpension entwickelt, mit Unterstützung des Bezirksamtes wurde die Krisenpension 2005 realisiert. (Kleinschmidt, 2010).
Die Krisenpension, existiert als außerstationäre Einrichtung wie bereits erwähnt, seit 2005. Sie wurde fast ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern entwickelt. Nach 2 Jahren unbezahlter Arbeit besteht seit 2007 ein Vertrag mit der City BKK zur integrierten Versorgung, der hauptsächlich auf die Versorgung in der Krisenpension abzielt, aber auch die Möglichkeit des Hometreatments einschloss (Vogelsang, 2010).
Die Krisenpension kann von Menschen in akuten psychischen Krisen stundenweise wie auch ganztags genutzt werden, wobei die Begleitung durch ein ärztlich geleitetes multiprofessionelles Team in trialogischer Besetzung (Erfahrungsexperte, Angehörige, professionelle Mitarbeiter unterschiedlicher Ausbildungen) erfolgt (Vogelsang, 2010).
In der Regel erfolgt die Nutzung für einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen als alleiniger Aufenthaltsort. Die Krisenpension dient aber auch als flexible Alternative zur eigenen Wohnung. Die Krisenpension orientiert sich an den Grundgedanken der Milieutherapie: durch Lage, Bezirk und Atmosphäre einen alltagsnahen Raum anbieten, der Ruhe und Geborgenheit ermöglicht. In der Krisenpension, die 4 bis 5 BewohnerInnen Platz bietet, sind neben den Gesprächen und therapeutischen Angeboten sowohl Gemeinschaft als auch Rückzug oder alltägliche Beschäftigung möglich. Neben den Zimmern für jeweils ein bis zwei Personen stehen Küche und Gemeinschaftsraum als auch das „weiche Zimmer“ für die intensive Begleitung in reizreduzierter Umgebung zur Verfügung.
Grundsätzlich sollten jedoch die Verbindung zum bekannten Umfeld, die eigene Wohnung oder die sozialen Bezüge erhalten bleiben, damit sie stabilisierend genutzt werden können. Auf der anderen Seite kann aber auch eine ungünstige oder beeinträchtigende Wohnsituation von der Krisenpension aus verändert werden (http://www.krisenpension.de/doku/material/projektbeschreibung.pdf). Auf Basis der intensiven Erfahrungen sollte mit der Umsetzung des „Netzwerks psychische Gesundheit“ ab September 2009 die Möglichkeit geschaffen werden, das Hometreatment als zentrales Angebot zu entwickeln (Vogelsang, 2010).
Bei der Begleitung zu Hause sollen alle möglichen Umfeldressourcen mit einbezogen werden, die Mitarbeiter begleiten die Klientenlnnen in einem vertrauten Rahmen oder unterstützen Bezugspersonen bei der Begleitung, je nach Bedarf manchmal auch bis zu 24h am Tag (http://www.krisenpension.de/doku/material/projektbeschreibung.pdf).
Somit bietet dieses System aus Fallmanager und Bezugsbegleiter einen Lotsen durch das zu aktivierende Netzwerk, welches den Klienten umgibt, als auch einen kontinuierlichen Ansprechpartner. Ärztliche Kompetenz wird durch den Einbezug der vorhandenen niedergelassenen Psychiater gewährleistet, und kann durch ärztliche Begleitung innerhalb des Systems ggf. ergänzt werden (Vogelsang, 2010).
Alle Beteiligten werden somit in die Planung als auch in die Betreuung mit einbezogen, die Mitarbeiter können so auf bekannte Strategien der Betroffenen und deren Umfeld aufbauen und Bewährtes mit einbeziehen. Ferner können Betroffene als auch Angehörige im Kontakt und im Austausch mit dem Team neue Strategien aus der akuten Situation entwickeln und unerprobte Bewältigungsmethoden lernen, um sie für die Zukunft zu nutzen. Die dauernde Erreichbarkeit und die gemeinschaftliche Planung können Zeit und Intensität der Begleitung im Verlauf der Krise am aktuellen Bedarf anpassen, so dass entwicklungsbehindernde Überbetreuung als auch verunsichernde Brüche und Lücken beim Abklingen einer Krise vermieden werden (http://www.krisenpension.de/doku/material/projektbeschreibung.pdf).
Die Zielgruppe des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ sind, wie bereits ersichtlich, Menschen in schweren psychischen Krisen oder akuten Phasen psychotischen Erlebens, die die stationäre Behandlung nicht wünschen, oder bei denen andere Gründe vorliegen, die einen stationären Aufenthalt als unangemessen erscheinen lassen. Ein stationärer Aufenthalt ist z.B. bei Menschen unpassend, die ihr wiederkehrendes psychotisches Erleben gut selbst einschätzen können und einen klar definierten Unterstützungsbedarf realisieren können, Menschen, die in traumatisch bedingten Krisen einen erhöhten Bedarf an eine ruhige und überschaubare Umgebung benötigen oder auch Menschen, die in akuten Lebenskrisen ohne pathologische Relevanz stecken.
Ein stationärer Aufenthalt ist ebenfalls inadäquat bei jungen Menschen mit einem ersten psychotischen Erleben, für die eine Hospitalisierung ein erhöhtes Chronifizierung- und Stigmatisierungsrisiko darstellt, bei Menschen, die durch stationäre Behandlungen insgesamt keine Besserung erfahren haben, als auch bei Menschen, die in Krisen unterstützende soziale Bezüge, eine Wohnung und eine Alltagsstruktur als unterstützende Faktoren zur Bewältigung dieser Krise einschätzen, und wo ein Bruch mit diesen Faktoren die Situation verschlechtern würde. Trägt ein Umfeld zur Verschlechterung der Situation bei, ist aber ein stationärer Aufenthalt nicht zwingend notwendig, wäre die Nutzung des Hometreatment als auch der Krisenpension empfehlenswert (http://www.krisenpension.de/doku/material/projektbeschreibung.pdf).
Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass Krisenpension und Hometreatment gemischt oder auch im Wechsel genutzt werden können, und nicht abgegrenzt voneinander betrachtet werden, denn die Krisenpension selbst versteht sich als ein Hometreatment, nur an einem anderen Ort (Vogelsang, 2010). Ausgeschlossen von dieser Nutzung werden Personen, bei denen eine Suchterkrankung oder eine organische Ursache für die Krise im Vordergrund steht (http://www.krisenpension.de/doku/material/projektbeschreibung.pdf).
3.1.3 Aufgaben der Mitarbeiter im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“
Bevor auf die spezifischen Aufgaben der Mitarbeiter in diesem Projekt eingegangen wird, soll es zunächst um die Zusammensetzung der Teams in diesem Projekt gehen.
Das trialogisch und multiprofessionelle Team weist vielfältige und relevante Kompetenzen auf, da in diesem Team verschiedene Gruppen vertreten sind. Die professionellen Helferinnen wie Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Ärztinnen und andere vergleichbare Qualifizierte bringen das professionelle Wissen aus ihrer Berufsgruppe mit und haben zudem Erfahrung in der Krisenarbeit aus verschiedenen außerstationären Arbeitsmodellen. Der theoretisch und methodisch integrative Ansatz bietet Raum für die Vielfalt an therapeutischen Angeboten, was wiederrum die individuelle Bearbeitung einer Krise ermöglicht, denn nicht jeder Klient braucht in einer Krise das Gleiche. Betroffene und Angehörige bringen ihre Erfahrungen und ihr spezifisches Wissen aus ihrem persönlichen Erleben mit ein. Auf Grundlage ihrer Auseinandersetzung mit eigenen Psychose- und Krisenerfahrungen und der Arbeit in Gruppen und Verbänden haben sie eine eigene Position und Anforderung an die Krisenarbeit formuliert. Dementsprechend beanspruchen sie die konsequente Beteiligung und Selbstbestimmung der Klientinnen. Aufgrund von selbstbewältigten Krisen haben Betroffene und Angehörige eine eigene Perspektive auf überstandene Krisen, diese Perspektive hilft ihnen bei der konkreten Begleitung von Klientinnen, und sie können mit unterschiedlichen Hilfsangeboten auf die Bedürfnisse der Klientinnen eingehen. Laienhelfer bringen vor allem ihre Lebenserfahrung und ihre menschliche Fähigkeit mit, anderen Menschen in schwierigen Situationen zuzuhören, ihnen Sicherheit zu vermitteln und für sie da zu sein.
Die Bereitschaft, sich auf den individuellen Prozess einer jeden Krise einzulassen und mit den Betroffenen immer wieder neue Wege der Krisenbewältigung zu finden, ist dabei allen gemeinsam, die Reflektion der eigenen Arbeit, das Einnehmen anderer Perspektiven sowie das Interesse, von anderen lernen zu wollen, sind dabei wesentliche Bestandteile der Teamarbeit (http://www.krisenpension.de/doku/material/projektbeschreibung.pdf). im Folgenden sollen nun die konkreten Aufgaben der Mitarbeiter in diesem Projekt vorgestellt werden.
Die Umsetzung des Hometreatments geschieht mit der Hilfe eines Systems aus Fallmanager und Bezugsbegleiter, dieses System bietet wie bereits erwähnt, einen kontinuierlichen Ansprechpartner als auch einen Lotsen durch das zu aktivierende Netzwerk, welches den Klienten umgibt.
Die Struktur des Großteams wurde so verändert, dass es nun vier kleine Teams mit jeweils vier bis fünf Bezugsbegleitern und einem Fallmanager als Leitung gibt. Eines dieser Teams ist das Krisenpensionsteam, welches die Öffnung der Krisenpension für 24h an sieben Tagen sicherstellt (Vogelsang, 2010).
Nimmt ein Klient am Projekt teil, vereinbart der zuständige Fallmanager, manchmal auch der Bezugsbegleiter, telefonisch oder schriftlich ein Erstgespräch, diesem Erstgespräch wird relativ blind entgegen gesteuert, da außer Name und Geburtsdatum keinerlei Daten vorliegen. Nach dem Erstkontakt mit dem Klienten können je nach Problematik weitere Folgetermine entstehen, sollte keine weitere Klärung nötig oder sinnvoll sein, wird ein kurzer Anruf nach spätestens drei Monaten vereinbart (Vogelsang, 2010).
Die Dokumentation ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe der MitarbeiterInnen dieses Projekts, so wird das Begrüßungsgespräch in einer Art elektronischer Akte dokumentiert. Dies ist ein Dokumentationssystem, welches für das Netzwerk psychische Gesundheit speziell umprogrammiert wurde. Diese elektronische Akte enthält neben der vertraglich geforderten Basisdokumentation ein Stammdatenblatt, eine Erstgesprächsdokumentation, die Medikamentenanamnese sowie einen Krisenplan. Der Krisenplan ist ein zentrales Dokument bei fast jedem Klienten. Er dokumentiert, wer im Krisenfall wie helfen soll, was hilfreich ist, und was schädlich ist, wie eine Krise beginnt und wie sie abgefangen werden kann. Dies ist im Netzwerk sehr hilfreich und schafft zudem Sicherheit (Vogelsang, 2010).
Jeder Klient im Netzwerk hat einen zuständigen Fallmanager und mindestens einen Bezugsbegleiter, ob der Bezugsbegleiter ein professioneller Mitarbeiter oder ein Erfahrungsexperte/Angehöriger ist, kann variieren. Je nach Problematik kann es sinnvoll sein, Mitarbeiter fest zuzuordnen, oder je nach Thema einen Mitarbeiter partiell dazuzuholen. Eine Aufgabe die sich daraus für die Mitarbeiter ergibt, ist die Fähigkeit zu Flexibilität (Vogelsang, 2010).
Eine weitere wichtige Aufgabe von Bezugsbetreuern und Fallmanagern des Netzwerks psychische Gesundheit ist die Teilnahme an Netzwerkgesprächen. Je mehr Personen aus dem Umfeld des Klienten an diesem Netzwerkgespräch teilnehmen, desto nachhaltiger und effektiver kann es sein. Dies ist nachvollziehbar, da alle relevanten Personen dabei sind. In der Regel kommt zur Sprache, was gesagt werden muss, ferner können Pläne unmittelbar aufeinander abgestimmt werden, und auch die Sorgen der Angehörigen werden sichtbar.
Häufig erfolgt von den Klienten die Äußerung, dass kein Netzwerk vorhanden ist, bei näherer Betrachtung lässt es sich dann doch finden. Mit der Methode der Netzwerkkarte kann aufgeschlüsselt werden, welche Funktion z.B. Freunde für den Klienten haben (Vogelsang, 2010).
Aus den Schilderungen wird deutlich, dass die Mitarbeiter des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ krisenvermeidend arbeiten, und eine Sicherheit für den Klienten und sein Netzwerk in der Krise darstellen. Sollte trotz dessen eine kontinuierliche Begleitung nötig sein, vermitteln die Mitarbeiter in bestehende Systeme und begleiten den Klienten dabei (Vogelsang, 2010).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass generell in Krisensituationen die Erreichbarkeit ein wichtiges Kriterium ist. Diese wird im Netzwerk verschieden gestaffelt, so haben die Nutzer des Netzwerks die Diensthandynummer ihres Bezugsbegleiters, der entweder direkt erreichbar ist, oder werktags innerhalb von 24h zurückruft. Des Weiteren gibt es an sieben Tagen rund um die Uhr eine Klienten-Hotline für den Notfall, einen Hintergrunddienst für Bezugsbegleiter zur Beratung und zur personellen Ergänzung sowie Hintergrunddienst für Fallmanager, daneben besteht ein ärztlicher Hintergrunddienst und eine Vernetzung mit dem Hintergrunddienst der psychiatrischen Pflege (Vogelsang, 2010).
Abschließend zu diesem Kapitel sollen die Aufgaben der Mitarbeiter des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ noch einmal verkürzt aufgelistet werden:
- Erstgespräche führen У Dokumentation У Erstellung eines Krisenplans У Flexibilität
- Die Bezugsbetreuer arbeiteten im Einzelkontakt У Der Fallmanager fungiert eher als Coach für die Bezugsbetreuer und übernimmt Supervisionsfunktion У Teilnahme an Netzwerkgesprächen У Die Mitarbeiter arbeiten krisenvermeidend У Vermittlung in bestehende Systeme У Erreichbarkeit durch Mobiltelefone > Klienten-Hotline für Notfälle, daraus ergibt sich Hintergrunddienst für Bezugsbegleiter und Fallmanager Obwohl im Kapitel 2.1. die Aufgaben der Mitarbeiter in der integrierten psychiatrischen Versorgung und jetzt im Kapitel 3.1.4 die Aufgaben der Mitarbeiter im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ dargestellt wurden, soll es nicht so wirken, als ob sich die Aufgaben voneinander abgrenzen. Aufgrund der vorliegenden Fakten können die Aufgaben, die im Kapitel 2.1 dargestellt wurden, auch direkt auf die Mitarbeiter des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ übertragen werden.
Das Kapitel 3.1.4 soll dem Leser letztendlich dazu dienen, einen Einblick über die „speziellen“ Aufgaben der Mitarbeiter im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ zu erhalten. Zusätzlich wird deutlich, dass sich die Aufgaben in der integrierten psychiatrischen Versorgung bzw. im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ sich deutlich von den Aufgaben der Mitarbeiter in der stationären Versorgung unterscheiden. Dies ist auch so gewollt, da somit langsam zur empirischen Fragestellung übergegangen werden kann.
3.1.4 Motive der Arbeitsplatzwahl
Die Befassung mit Motivation im arbeits- und organisationspsychologischen Kontext verfolgt in erster Linie die Frage, unter welchen Bedingungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich für die Erreichung der Organisationsziele einsetzen, und sich gleichzeitig an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Der angewandten Motivationsforschung stehen dafür verschiedene Theorien zur Verfügung. Das Bedürfnis der Praxis besteht darin, aus diesen Theorien Interventionsstrategien abzuleiten, um Mitarbeiter zur Leistung zu motivieren (Brandstätter & Frey, 2004).
Eine Unterfragestellung dieser Masterthesis bezieht sich durchaus auf die Erhaltung der Beweggründe, als Mitarbeiter im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ tätig zu sein, jedoch besteht die Hauptfragestellung darin, welche Beweggründe dazu geführt haben, in diesem Projekt aktiv zu werden.
Um sich dieser Fragestellung zu nähern, wird im nächsten Kapitel eine volitionale Theorie von Heckhausen und Gollwitzer erläutert werden.
Im Mittelpunkt volitionaler Theorien steht die Frage, welche Bedingungen, Strategien und Mechanismen die Realisierung von gewählten Handlungszielen fördern (Brandstätter & Frey, 2004).
3.1.5 Das Handlungsphasenmodell von Heckhausen und Gollwitzer
Das Handlungsphasenmodell von Heckhausen und Gollwitzer nimmt eine besondere Position ein, da es motivationale und volitionale Fragestellungen in einem theoretischen Rahmen integriert. Das Modell gliedert den Handlungsstrom vom ersten Entstehen eines noch unverbindlichen Wunsches bis hin zur abschließenden Bewertung eines erreichten Handlungsziels idealtypisch in vier Phasen: Abwägen, Planen, Handeln und Bewerten. Motivation steht dabei für das Abwägen und Bewerten.
Die Intentionsbildung, die Handlungsinitiierung sowie die Desaktivierung der in Frage stehenden Intention werden dabei als zentrale Übergänge betrachtet. Wird die Intention durch eine Handlungsphase realisiert, spricht man von Volition (Kehr, 2004; Brandstätter & Frey, 2004).
Die erste Phase ist die prädezisionale Handlungsphase oder auch Motivationsphase. In dieser Phase muss sich ein Handelnder bewusst machen, welche Wünsche und Anliegen er überhaupt in die Tat umsetzen möchte. Um Wünsche und Anliegen in verbindliche Ziele umzusetzen, wägt der Handelnde die Realisierbarkeit der verschiedenen Wünsche und Anliegen gegeneinander ab. In dieser Phase sind Personen also hoch realitätsorientiert, sie sind offen für alle entscheidungsrelevanten Informationen, bedenken Möglichkeiten unerwünschter Nebenfolgen und fragen sich, ob bestimmte Personen oder Situationsentwicklungen helfen oder behindern. Dies ist typisch für die motivationale Bewusstseinslage, und fördert das Treffen einer begründeten und tragfähigen Entscheidung. Die Dauer des Abwägens variiert dabei von Fall zu Fall und selten lassen sich alle Fragen klären (Achtziger & Gollwitzer, 2006; Brandstätter & Frey, 2004; Rheinberg, 2000).
Kommt es zu dem Entschluss, einen Wunsch zu realisieren, ist aus einer Absicht eine Intention geworden. Damit ist der Rubikon überschritten, und zugleich ändert sich die Bewusstseinslage. In der Motivationsphase war der Handelnde noch realitätsorientiert, so ist er in der Volitionsphase (oder auch postdezisionalen Handlungsphase) realisierungsorientiert. Die Realisierung verbindlich gewordener Ziele kann mit Hilfe zielfördernder Handlungen vorangetrieben werden. Dabei kann es sich um eingeübte Verhaltensweisen handeln, als auch um neue, noch nicht etablierte Verhaltensweisen. Am günstigsten erweisen sich in dieser Phase Pläne, die bestimmen, auf welche Art und Weise zielfördernde Handlungen durchgeführt werden. Diese Pläne werden auch als Durchführungsintention bezeichnet (Achtziger & Gollwitzer, 2006; Rheinberg, 2000).
Mit den in dieser Handlungsphase gefassten Pläne ist der Übergang in die aktionale Handlungsphase vollzogen. Der Handelnde versucht die geplanten zielfördernden Handlungen auch wirklich durchzuführen und sie zu einem erfolgreichen Ende zu bringen (Achtziger & Gollwitzer, 2006).
Nach Beendigung der Handlung geht der Handelnde wieder in die Motivationsphase über, und bewertet, ob das intendierte Ziel erreicht wurde, und woran es gelegen haben könnte, falls es verfehlt wurde. Dieses Abwägen basiert auf der einen Seite auf das vorliegende Handlungsergebnis, ist aber andererseits auch gleichzeitig auf zukünftiges Handeln gerichtet.
Entspricht das erzielte Handlungsergebnis dem gewünschten Ziel, findet eine Deaktivierung des zugrunde liegenden Ziels statt.
Wird das Ziel trotz nicht zufrieden stellender Handlungsergebnisse beibehalten, müssen neue Handlungen erarbeitet werden, um das Ziel doch noch zu erreichen (Achtziger & Gollwitzer, 2006; Rheinberg, 2000).
Wird dieses Modell als Ganzes betrachtet, so ist keineswegs davon auszugehen, dass vor jeder Handlung alle Stationen bis zum Handlungsstart durchlaufen werden. Im fortschreitenden Lebensalter sind sie motivationalen Beurteilungsprozesse für die meisten Situationen im Leben abgeschlossen. Handelnde haben dann bereits eine fertige Intention, die bei passender Gelegenheit nur noch abgerufen wird (Heckhausen, 1987, zitiert nach Rheinberg, 2004, S. 184).
Der theoretische Inhalt des Modells kann aufgrund der dargestellten Sachverhalte auf die Mitarbeiter des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ übertragen werden (der Wunsch, im Projekt tätig zu sein bis hin zur Erreichung dieses Ziels).
Aufgrund der dünnen Forschungslage war es nicht möglich, Studien zu finden, die die persönlichen Beweggründe einer Person einen bestimmten Arbeitsplatz zu wählen, erforschen. Die gesichteten Studien zielen vor allem auf die Analyse von Arbeitszufriedenheit im Arbeitsprozess und unter welchen Bedingungen die Arbeitsmotivation der Mitarbeiter gefördert wird.
Ziel dieser Masterthesis ist es jedoch die Beweggründe heraus zu filtern, die dazu geführt haben, als Mitarbeiter im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ tätig werden zu wollen. Aufgrund dessen finden die oben genannten Studien keine Berücksichtigung.
3.1.6 Empirische Hauptfragestellung
Im vorgegangen Teil dieser Arbeit wurde mit Hilfe von theoretischem Material gezeigt, dass den Mitarbeitern in der integrierten psychiatrischen Versorgung als auch den Mitarbeitern des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ eine zentrale Rolle in der patientenorientierten Vernetzung zukommt, und sie somit eine Schnittstellenfunktion ausüben. Die Mitarbeiter des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ tragen einen entscheidenden Teil dazu bei, dass integrierte psychiatrische Versorgung funktioniert.
Unter Berücksichtigung des Modells von Heckhausen und Gollwitz wird bei den Mitarbeitern des Projekts „Hometreatment und Krisenpension“ der Blickpunkt auf die Motivationsphase gelegt werden, um sich der empirischen Hauptfragestellung zu nähern.
Dem nun folgenden empirischen Teil liegt folgende Hauptfragestellung zugrunde:
Welche persönlichen Beweggründe, haben dazu geführt, im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ als Mitarbeiter tätig zu werden?
Die Hauptfragestellung impliziert die Beantwortung von folgenden Unterfragestellungen:
- Wie sind Sie auf das Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ aufmerksam geworden?
- Welche Beweggründe gab es, in diesem Projekt als Mitarbeiter tätig werden zu wollen?
- Wie können die persönlichen Beweggründe, die dazu geführt haben, im Projekt „Hometreatment und Krisenpension“ tätig zu sein, aufrechterhalten werden?
- Wie nehmen Sie sich als Mitarbeiter in diesem Projekt wahr?
- Gibt es Gründe, die dazu führen könnten, dass Sie als Mitarbeiter aus dem Projekt aussteigen?
- Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft im Projekt vor?
4. Methodisches Vorgehen
In den nächsten Kapiteln werde ich einen Überblick darüber geben, mit welchem methodischen Vorgehen die Forschungsfrage beantwortet werden soll. Dafür erfolgt zunächst ein Überblick über wichtige Merkmale des qualitativen Forschens, anschließend erfolgt eine Darstellung zur Erhebungsmethode des problemzentrierten Interviews, zur Auswahl der Interviewpartner, zur Durchführung der Interviews, zur Aufbereitung der Daten und zur Auswertungsmethode der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse.
4.1. Darstellung und Begründung der qualitativen Vorgehensweise
Die wissenschaftliche Psychologie besitzt seit ihren institutionellen Anfängen im späten 19. Jahrhundert eine charakteristische Doppel- bzw. Mehrdeutigkeit, sie gilt sowohl als Naturwissenschaft als auch als Geisteswissenschaft. Von diesem Standpunkt aus haben sich mehrere gegenstandstheoretische und methodologische Stränge entwickelt, die zu unterschiedlichen Zeiten koexistierten und kooperierten oder sich auch wechselseitig bekämpften.
In der deutschen akademischen Psychologie ist die Situation bis in die 1960er Jahre hinein noch stark „interpretativ“ ausgerichtet, später dominierte in Anlehnung an US-amerikanische Vorbilder eine naturwissenschaftlichexperimentelle Ausrichtung. In der heutigen Landschaft der Psychologie sind interpretative bzw. qualitative Methodologien eher an den Rand gedrängt, und in Deutschland weitgehend ausgemerzt, in den USA randständig, aber zunehmend hörbar, in Großbritannien sind sie schon stärker etabliert.
Vertreter und Vertreterinnen mit einer qualitativ-sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsauffassung haben sich in der Psychologie von heute mit einem Mainstream von Gesetzeserkenntnissen nach dem naturwissenschaftlichen Modell auseinanderzusetzen, und müssen sich diesen gegenüber rechtfertigen. Deutschsprachige Universitäten zeichnen sich durch eine nomothetisch- naturwissenschftliche Grundausrichtung sowie durch Ignoranz und Verdrängung hermeneutisch-qualitativer Denkweisen und Methoden aus. Die verbreitete Ansicht besteht immer noch darin, dass sich der Erkenntnisanspruch von wissenschaftlichem Wissen dadurch heraus hebt, weil er an profanen Wissensorten entstanden ist.
Für die Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts bestand die wesentliche Frage darin, wie wissenschaftliche Forschung aufgebaut sein muss, um Erkenntnisgewissheit zu gewährleisten. Dieser Gedankengang läuft auf eine präskriptive Methodologie hinaus, und auf eine Systematik von Aussagegefügen aus theoretischen und empirischen Sätzen ohne logische Schwachstellen und Widersprüche. Seit den 1970er Jahren ist diese Sichtweise angezweifelt, durch diesen anderen Blickwinkel kamen wissenschaftssoziologische Untersuchungen realer Forschungsabläufe ins Spiel, es kam zu einer Reihe von Neuentwürfen des Theorie-Empirie- Verhältnisses, bei denen versucht wurde, realistischer mit der Frage ihres Abgleichens umzugehen (Breuer, 2010).
Die qualitative Forschung erlebt somit seit den 1970er Jahren in der deutschsprachigen Diskussion eine Renaissance und findet seitdem immer stärkere Verbreitung (Flick, Kardorff & Steinke, 2008).
Die sozialwissenschaftlich-qualitative Methode ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl methodologischer Denkformen, Forschungsstile und Instrumentarien, die durch verschiedene Disziplinen hervorgebracht wurden.
Bei der Ausdifferenzierung spielen dann unterschiedliche theoretische Traditionen sowie nationale Besonderheiten eine Rolle. Wenn also im Folgenden von qualitativen Methoden die Rede ist, handelt es sich dabei um eine Verallgemeinerung (Breuer, 2010).
Das qualitative Forschen zeichnet sich nach Mayring (2002) durch bestimmte Grundsätze aus, die nachfolgend beschrieben werden.
Die qualitative Forschung fordert mehr Subjektbezogenheit in der Forschung, d.h. die Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein.
Die Betonung der Deskription und der Interpretation der Forschungssubjekte steht ebenfalls im Mittelpunkt, so muss am Anfang einer Analyse eine genaue und umfassende Deskription des Gegenstandsbereich erfolgen, wichtig ist dabei, dass der Untersuchungsgegenstand nie völlig offen ist, er muss immer durch Interpretation erschlossen werden. Nicht zuletzt besteht der Anspruch des qualitativen Forschens darin, die Subjekte in ihrem natürlichen und alltäglichen Umfeld zu untersuchen, da an natürlichen Lebenssituationen angeknüpft werden soll. Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse stellt sich nicht über bestimmte Verfahren her, sondern sie muss schrittweise im Einzelfall begründet werden (Mayring, 2007).
Die qualitative Forschung hat also den Anspruch, Lebenswelten von innen heraus aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben, damit sie ein besseres Verständnis zu sozialer Wirklichkeit beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen kann (Flick, Kardoff & Steinke, 2008).
[...]
[1] Leitlinie wird von Experten im informellen Konsens erarbeitet
[2] Leitlinie mit allen Elementen (Logik-, Entscheidungs- und Outcome-Analyse, Bewertung der klinischen Relevanz wissenschaftlicher Studien und regelmäßige Überprüfung, methodische Qualität dementsprechend höher ( http://www.bildungswerk- irsee.de/stat/content/pdf/PIA%202010/S3PsychosozThermitTitelfolieBecker.pdf)
[3] Anmerkung der Autorin: „Pflege“ dar hier nicht im Sinne von körperlicher Pflege verstanden werden, vielmehr bezieht sich das Wort „Pflege“ auf das integrative Potenzial der verschiedenen Mitarbeiter Mosher und Burti (1994) haben schon vor über 15 Jahren erkannt, dass, unter Voraussetzung einer vernünftigen Verwaltung, die Qualität von Mitarbeitern der bedeutsamste Einzelfaktor ist, um eine gute Einrichtung zu schaffen. Nicht
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Masterthesis zum Thema „Hometreatment“?
Die qualitative Studie untersucht die Beweggründe von Mitarbeitern, in Projekten der integrierten psychiatrischen Versorgung tätig zu werden und wie diese Motivation erhalten werden kann.
Was ist das Besondere am Projekt „Hometreatment und Krisenpension“?
Klienten werden direkt in ihrem Lebensumfeld zu Hause betreut oder können rund um die Uhr eine Krisenpension nutzen, was stationäre Klinikaufenthalte oft überflüssig macht.
Was motiviert Menschen, in diesem Bereich zu arbeiten?
Ein Hauptgrund ist der Ansatz der Gemeindepsychiatrie, der es ermöglicht, Menschen direkt in ihrem Alltag zu begleiten, statt in einem klinisch-stationären Rahmen.
Welche Belastungen werden von den Mitarbeitern genannt?
Herausforderungen sind insbesondere die ständige Erreichbarkeit und unregelmäßige Arbeitszeiten, die ein potenzieller Grund für einen Ausstieg sein könnten.
Welche Methodik wurde für die Untersuchung gewählt?
Es wurden drei problemzentrierte Interviews geführt, die mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet und interpretiert wurden.
- Citation du texte
- Susanne Bringezu (Auteur), 2012, Die Motivation hinter der Arbeit in Projekten der integrierten psychiatrischen Versorgung am Beispiel "Hometreatment und Krisenpension", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203258