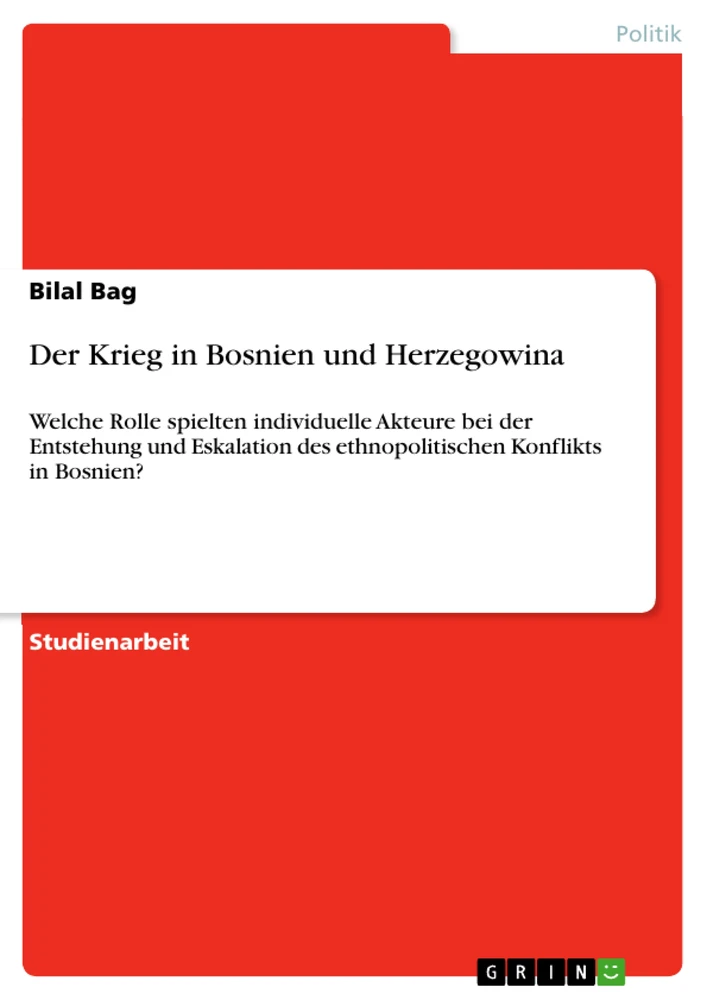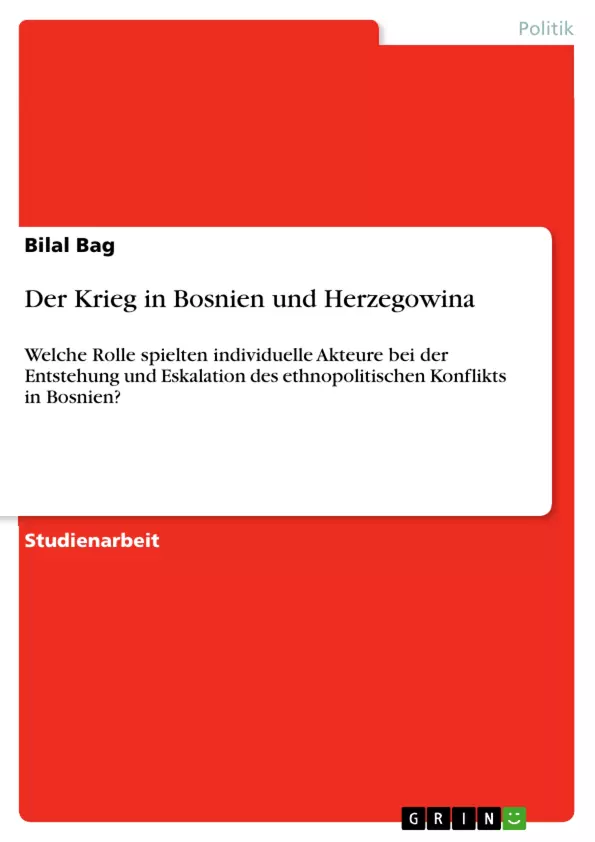Das Ende des Kalten Krieges sollte der Beginn einer neuen Ära sein. Einer Ära des
Frieden und der Zusammenarbeit, anstelle von Krieg und Konflikt. Von einer „zweiten
Chance“ war die Rede (Toth 2010: 15). Doch der Kalte Krieg machte Platz für eine
andere Art der Auseinandersetzung auf dem Globus.
In der Zeit rund um den Fall des Eisernen Vorhangs konnte ein starker Anstieg an
innerstaatlichen Konflikten verzeichnet werden (Toth 2010: 16). Bei einem Großteil
dieser Konflikte liefen die Konfliktlinien entlang der Ethnien und Streitpunkt waren
politische Uneinigkeiten. Daher wurden sie als ethnische bzw. ethnopolitische
Konflikte bezeichnet. Ruanda, Burundi, Sudan, Irak, Burma und Bosnien und
Herzegowina sind Staaten, die im allgemeinen Vernehmen mit blutigen
Auseinandersetzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit brutalster Art
während innerstaatlichen Konflikten in Verbindung gebracht werden.
Viele Politiker und Journalisten glaubten die Ursache der Konflikte in den ethnischen
Unterschieden gefunden zu haben. Es sei nicht möglich, dass Menschen mit
unterschiedlichen Kulturen friedlich zusammenleben (Huntington 1996). Daher sei
auch die Ursache ethnischer / ethnopolitischer Konflikte unkompliziert und
offensichtlich. Verantwortlich für diese gewaltsamen Konflikte sei der sich entladende
„uralte Hass“, welcher zwischen den beteiligten ethnischen Gruppen seit geraumer
Zeit existiere, bisher jedoch aus verschiedensten Gründen zurückgedrängt worden
wäre (Kaplan 1994b).
Doch die Wissenschaft war nicht zufrieden mit diesem Erklärungsversuch, denn sie
konnte nicht erklären, warum ethnisch motivierte Gewalt in einigen multikulturellen
Staaten ausbrachen und in anderen wiederum nicht. Trotz vieler Unzulänglichkeiten
war diese These in den 90ern bis in die höchsten Politischen Kreise weit verbreitet
(Toth 2010: 71), die Wissenschaft war jedoch auf der Suche nach signifikanteren
Erklärungsmodellen. Mit der Zeit häuften sich Thesen, die ethnische / ethnopolitische
Konflikte als Folge komplexer Entwicklungen zu erklären versuchten.
In der folgenden Hausarbeit möchte ich am Fallbeispiel des Bosnienkrieges von
1992 bis 1995 die Ursachen eines ethnopolitischen Konfliktes ausarbeiten und mein
besonderes Augenmerk darauf legen, welche Rolle individuelle Akteure bei der
Entstehung und Eskalation des Konfliktes in Bosnien und Herzegowina gespielt
haben.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Definition zentraler Begriffe
- 2.1.1. Ethnien
- 2.1.2. Ethnischer Konflikt
- 2.1.3. Ethnopolitischer Konflikt
- 2.1.4. Individuelle Akteure
- 2.2. Die Konfliktparteien und ihre Kriegsziele
- 2.3. Erklärungsversuche
- 2.3.1. Erklärungsversuch 1: Die These des „uralten Hasses“
- 2.3.2. Erklärungsversuch 2: Ethnopolitische Konflikte als Folge komplexer Entwicklungen
- 2.3.2.1. Underlying Causes
- 2.3.2.2. Proximate Causes
- 2.1. Definition zentraler Begriffe
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht am Beispiel des Bosnienkriegs (1992-1995) die Ursachen ethnopolitischer Konflikte und die Rolle individueller Akteure bei deren Entstehung und Eskalation. Die Arbeit analysiert bestehende Erklärungsmodelle und hinterfragt vereinfachte Thesen.
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe wie Ethnie, ethnischer und ethnopolitischer Konflikt.
- Analyse der Konfliktparteien im Bosnienkrieg und deren Kriegsziele.
- Bewertung des Erklärungsversuchs des „uralten Hasses“.
- Untersuchung komplexerer Erklärungsmodelle für ethnopolitische Konflikte.
- Analyse der Rolle individueller Akteure im Konfliktgeschehen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der innerstaatlichen Konflikte nach dem Ende des Kalten Krieges ein und stellt den Anstieg ethnischer und ethnopolitischer Konflikte fest. Sie problematisiert vereinfachte Erklärungsansätze wie die These des „uralten Hasses“ und kündigt die Analyse des Bosnienkriegs als Fallbeispiel an, wobei der Fokus auf der Rolle individueller Akteure liegt. Die Bedeutung der präzisen Ursachenanalyse für effektive Friedensarbeit und präventive Maßnahmen wird hervorgehoben. Die Methodik der Arbeit wird kurz skizziert.
2. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit der Definition zentraler Begriffe, wobei die Schwierigkeit der Definition von „Ethnie“ betont und ein Bezug zum Bosnienkonflikt hergestellt wird. Anschließend werden die Konfliktparteien im Bosnienkrieg (bosnische Serben, bosnische Kroaten, Bosniaken) und ihre Kriegsziele kurz dargestellt. Der Hauptteil analysiert zwei gegensätzliche Erklärungsansätze für den Bosnienkrieg: die These des „uralten Hasses“ und die These komplexerer Ursachen. Die Arbeit wird sich auf diese beiden Erklärungsmodelle konzentrieren, um ein differenziertes Bild der Ursachen zu entwickeln und die Komplexität des Konflikts zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Bosnienkrieg, Ethnopolitischer Konflikt, Individuelle Akteure, „Uralter Hass“, Komplexe Entwicklungen, Friedensarbeit, Konfliktprävention, Ethnien, Kriegsziele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse ethnopolitischer Konflikte am Beispiel des Bosnienkrieges
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen ethnopolitischer Konflikte und die Rolle individueller Akteure bei deren Entstehung und Eskalation am Beispiel des Bosnienkrieges (1992-1995). Sie analysiert bestehende Erklärungsmodelle und hinterfragt vereinfachte Thesen wie die These vom "uralten Hass".
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe (Ethnie, ethnischer und ethnopolitischer Konflikt), die Analyse der Konfliktparteien im Bosnienkrieg und ihrer Kriegsziele, die Bewertung der These vom "uralten Hass", die Untersuchung komplexerer Erklärungsmodelle für ethnopolitische Konflikte und die Analyse der Rolle individueller Akteure im Konfliktgeschehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Hauptteil beinhaltet die Definition zentraler Begriffe, die Darstellung der Konfliktparteien und ihrer Ziele, sowie die Analyse zweier gegensätzlicher Erklärungsansätze für den Bosnienkrieg: die These des "uralten Hasses" und die These komplexerer Ursachen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Methodik. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Erklärungsansätze für den Bosnienkrieg werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert zwei gegensätzliche Erklärungsansätze: die vereinfachte These des "uralten Hasses" und ein komplexeres Modell, das die tieferliegenden (Underlying Causes) und unmittelbaren Ursachen (Proximate Causes) des Konflikts berücksichtigt.
Welche Rolle spielen individuelle Akteure in der Analyse?
Die Rolle individueller Akteure bei der Entstehung und Eskalation des Konflikts ist ein zentraler Fokus der Arbeit. Die Arbeit untersucht, wie das Handeln einzelner Personen den Konfliktverlauf beeinflusst hat.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bosnienkrieg, Ethnopolitischer Konflikt, Individuelle Akteure, „Uralter Hass“, Komplexe Entwicklungen, Friedensarbeit, Konfliktprävention, Ethnien, Kriegsziele.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass eine umfassende Analyse ethnopolitischer Konflikte über vereinfachte Erklärungsansätze hinausgehen muss und die Berücksichtigung komplexer Ursachen und die Rolle individueller Akteure unerlässlich ist. Die präzise Ursachenanalyse ist essentiell für effektive Friedensarbeit und präventive Maßnahmen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit den Ursachen und Dynamiken ethnopolitischer Konflikte auseinandersetzt. Die Ergebnisse sind relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle, die sich mit Friedensforschung und Konfliktprävention befassen.
- Quote paper
- Bilal Bag (Author), 2011, Der Krieg in Bosnien und Herzegowina, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203309