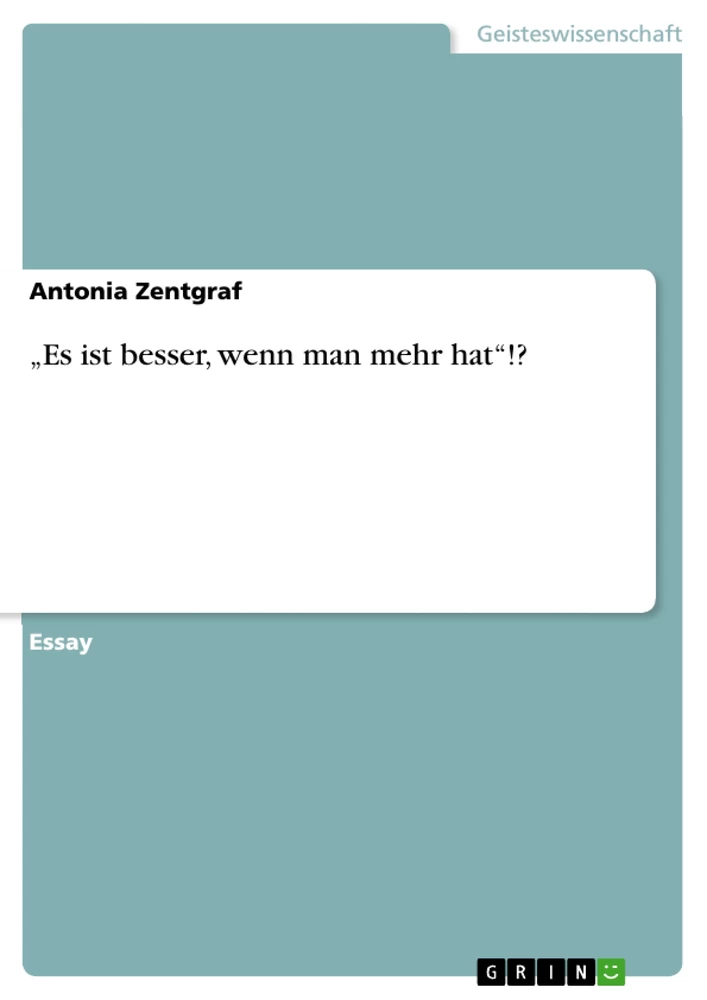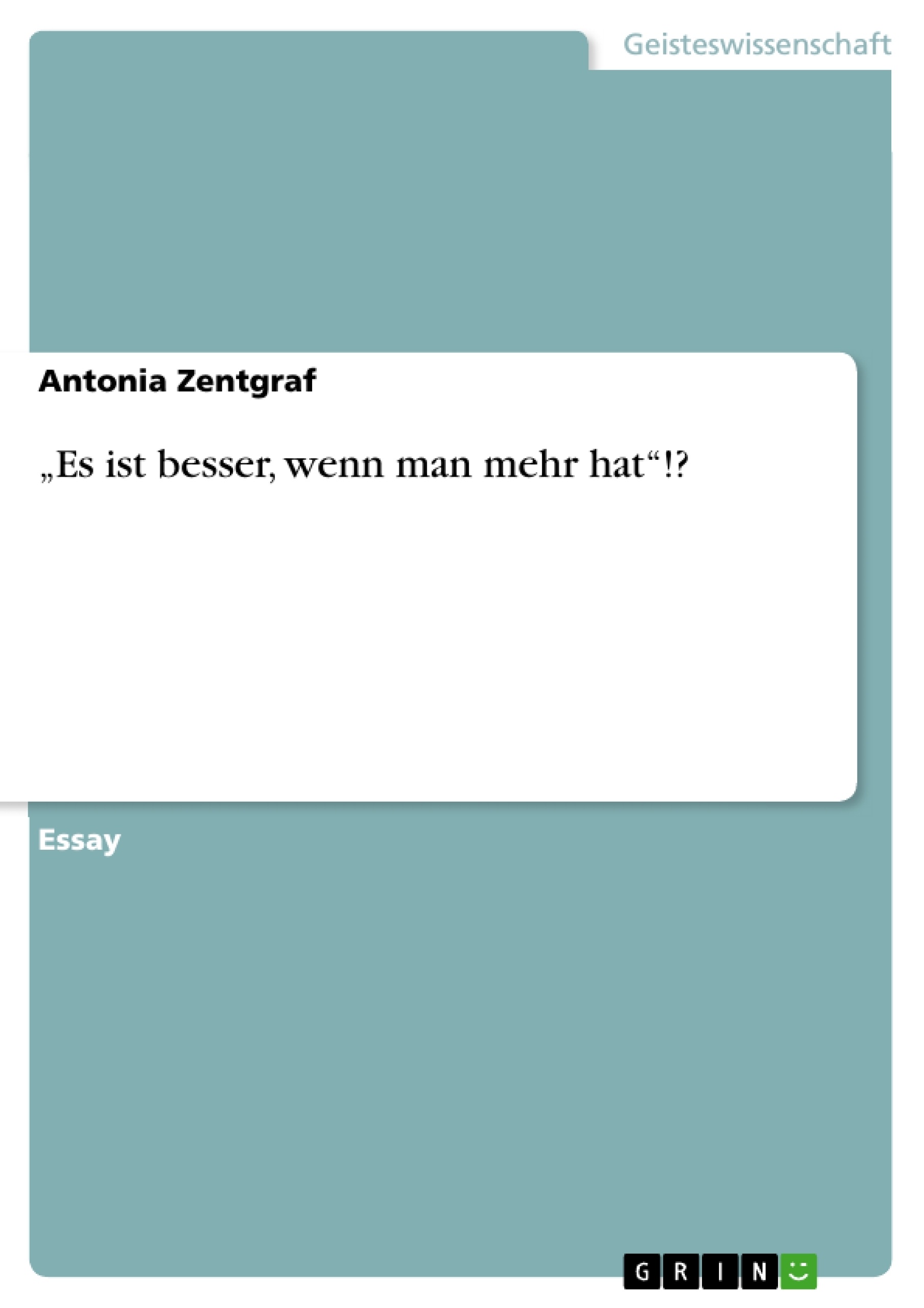„Ich brauche vieles und viel davon. / Und nur für mich, nur für mich. / Von allem, was man haben will, / brauche ich zehnmal so viel. / Ich werde nie satt, ich werde nie satt. / Es ist besser, wenn man mehr hat. / Mehr!“ – so heißt es in dem Lied Mehr von der Band Rammstein. Im Rahmen der Vorlesung Konsumismus soll hier im Folgenden zuerst der Liedtext und der darin beschriebene Konsument auf Basis des 16. Paragraphen des Vorlesungsskriptes - „Der Mensch als Konsument“ - besprochen werden. Zudem soll im Sinne des Konsumismus untersucht werden, warum der im Lied beschriebene Mensch mehr will. Welche Begründungen finden sich diesbezüglich in der Konsumkultur und -psychologie? Gibt es einen Auslöser für sein Lustempfinden? Abschließend wird im Fazit versucht, folgende Frage im Kontext der radikalen Endlichkeit eines Menschen zu beantworten: Ist es wirklich besser, wenn man mehr hat?
Ich brauche vieles und viel davon. / Und nur für mich, nur für mich. / Von allem, was man haben will, / brauche ich zehnmal so viel. / Ich werde nie satt, ich werde nie satt. / Es ist besser, wenn man mehr hat. / Mehr!“[1] – so heißt es in dem Lied Mehr von der Band Rammstein. Im Rahmen der Vorlesung Konsumismus soll hier im Folgenden zuerst der Liedtext und der darin beschriebene Konsument auf Basis des 16. Paragraphen des Vorlesungsskriptes - „Der Mensch als Konsument“ - besprochen werden.[2] Zudem soll im Sinne des Konsumismus untersucht werden, warum der im Lied beschriebene Mensch mehr will. Welche Begründungen finden sich diesbezüglich in der Konsumkultur und -psychologie? Gibt es einen Auslöser für sein Lustempfinden? Abschließend wird im Fazit versucht, folgende Frage im Kontext der radikalen Endlichkeit eines Menschen zu beantworten: Ist es wirklich besser, wenn man mehr hat?
Im Lied Mehr geht es um ein Subjekt, welches über seine Persönlichkeit hauptsächlich hinsichtlich seiner Bedürfnisse spricht bzw. singt. In der ersten Strophe singt das Ich darüber, was es braucht. Es beschreibt sich in der ersten Strophe als jemanden, der vieles nur für sich benötigt und davon gleich zehnmal so viel wie andere. Dieser Mensch ist ein Nimmersatt und behauptet, dass es besser sei, von allem mehr zu haben - was in einem sehr knappen Refrain mit dem Wort „Mehr!“ viermal bekräftigt wird. In der zweiten Strophe singt das Ich darüber, dass es bereits im Besitz von etwas ist.[3] Was das ist, wird aber nicht konkret genannt. Stattdessen heißt es: „Was ich habe, ist mir zu wenig.“[4] Und deshalb braucht es viel und zwar ganz viel ! Dieser Mensch hat nichts zu verschenken und fragt, wozu er auf irgendetwas verzichten sollte, was sich in Form einer rhetorischen Frage äußert. Schenken an sich könnte hier als Verzicht des Ichs verstanden werden, was für ihn aber nicht infrage kommt. Es bezeichnet sich des Weiteren als wohlhabend, was ihm dennoch nicht ausreicht.[5] Die Frage „Bescheidenheit?“[6] im fünften Vers der zweiten Strophe ist ebenfalls als eine rhetorische Frage zu verstehen, die keiner Antwort bedarf und beim Lesen (sowie beim Hören des Liedes) der Antwort „Alles, was recht ist!“[7] einen sarkastischen Unterton verspüren lässt. Denn es ist unverkennbar, dass das Subjekt nicht bescheiden ist und es auch nicht sein will. Die Antwort erweitert das Ich, indem es sagt, es nehme alles – ob mit guten oder schlechten Eigenschaften. Dem schließt sich wieder die Begründung aus der ersten Strophe an: Dieser Mensch wird nie satt, denn er denkt, dass es besser wäre, mehr zu haben. Im Gegensatz zum ersten Refrain liegt im zweiten eine Klimax vor – denn „Mehr!“ wird nun nicht nur viermal wiederholt, sondern siebenmal. Das anschließende achte Mehr wird noch einmal speziell gesteigert – nämlich nicht wie gewöhnlich mit viel - mehr - am meisten. Durch die Verbindung des Positivs viel und des Komparativs mehr wird ein neuer Superlativ geschaffen, welcher damit eine spezielle Akzentuierung erzeugt und sich explizit vom Komparativ hervorhebt: „Viel mehr!“[8] Dem schließt sich in der dritten Strophe nun noch eine Reihe von Begründungen an: Dieser Mensch ist nie zufrieden, für ihn gibt es nie genug – kein Ziel. Er will natürlich immer mehr und will nicht, dass er irgendwann einmal nichts mehr möchte und bekommt. Denn unabhängig davon, wie viel er mal haben wird, wird ihm das nie zu viel und auch nie ausreichend sein. Das Subjekt stellt fest, dass alle anderen weniger als es selbst haben. Doch statt mit Nächstenliebe diesen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen, möchte es das Wenige, was diese haben und laut ihm sowieso nicht benötigen, zusätzlich noch besitzen. Dazu fordert es die Hörer bzw. Leser sogar auf: „Gebt mir auch das noch, / sie brauchen's eh nicht!“[9] Diese letzte Strophe wird durch ihre viermalige Wiederholung besonders betont und von den anderen hervorgehoben. Den Schluss weist eine Ergänzung zu dem bisherigen Refrain und eine weitere Steigerung zu dem neu geschaffenen Superlativ durch die bekräftigende Abtönungspartikel noch auf. Denn dort heißt es jetzt: „Ich brauche mehr! / Mehr! / Mehr! / Viel mehr! / Noch mehr [Hervorhebung, A. Z.]!“[10] Das, was es will, kann nach diesen Ausführungen bspw. kein Wissen, keine Leistung sein oder andere nicht-greifbare oder gar fiktive Dinge, sondern nur reale Gegenstände, (käufliche) Waren. Im Folgenden wird nun versucht, die Frage zu beantworten, warum das Subjekt mehr will .
Eine erste Erklärung für den überschwänglichen Lebensstil der oben beschriebenen Person könnte der Hang zum Hedonismus sein. Unter diesem versteht das Allensbach-Institut das „Streben nach möglichst viel Glückserfahrungen und nach Lebensgenuß“, was in der Gesellschaft wohl auch immer mehr in den Vordergrund trete.[11] Die Begründung mit Hedonismus könnte bis dahin weitergeführt werden, dass das Ich den Sinn des Lebens im Lebensgenuss selbst sieht und deshalb mehr braucht. Da es kein Ziel und nie genug für das Subjekt gibt, scheint es keine zeitliche Beschränkung zu wollen - Johann Baptist Metz spricht in diesem Zusammenhang von einem Großmythos der Moderne: dem Zeitmythos. Er beschreibt diesen als „die Imagination von Welt im Horizont unbefristeter, evolutionistisch entfristeter Zeit“.[12] Die Person aus dem Lied scheint sich daher auch seiner radikalen Endlichkeit nicht bewusst zu sein, da sie vom Konsum, vom Mehr-Wollen, stark vereinnahmt ist. Es ist durchaus denkbar, dass sie sich aufgrund dieser Besessenheit nach mehr die Option bald oder überhaupt sterben zu können, noch nicht vor Augen gehalten hat. Dieser sogenannte Zustand der beruhigten Endlichkeit besitzt ein Moment, welches von der Erfahrung geprägt ist, dass eine Resignation vorherrscht, welche von leerer bzw. zeitloser Zeit überwältigt wurde und deren Hülle die Konsum- und Leistungskultur bildet.[13] „Diese Kultur ist prädestiniert, Allmachtsfantasien der zeitlos-punktuellen Empfindungen durch Konsumakte zu entwickeln“, in welcher die utopische Vorstellung aufkommt, dass Glück käuflich sei.[14]
[...]
[1] Rammstein (2009), Mehr. Auf dem Album: Liebe ist für alle da. Für vollständigen Text siehe http://www.elyricsworld.com/mehr_lyrics_rammstein.html (13.06.2012)
[2] Entnommen dem Skript: Hauser, L., Konsumismus, SoSe 2012, 24
[3] Vgl. Rammstein (2009), Mehr
[4] Ebd.
[5] Vgl. ebd.
[6] Ebd.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Rammstein (2009), Mehr
[10] Ebd.
[11] Hauser (SoSe 2012), 24
[12] Metz (1990), 170
[13] Vgl. Hauser (SoSe 2012), 27
[14] Ebd.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Rammstein-Lied „Mehr“?
Das Lied beschreibt ein Subjekt, das von einer unersättlichen Gier nach materiellem Besitz und Konsum getrieben ist und niemals zufrieden gestellt werden kann.
Was ist der „Zeitmythos“ nach Johann Baptist Metz?
Es ist die Vorstellung einer unbefristeten Zeit in der Moderne, die dazu führt, dass Menschen ihre eigene Endlichkeit ausblenden und stattdessen im Konsumrausch leben.
Was bedeutet „beruhigte Endlichkeit“ im Konsumismus?
Dieser Zustand beschreibt Menschen, die durch ständige Konsumakte und Allmachtsfantasien ihre Sterblichkeit verdrängen und glauben, Glück sei käuflich.
Welche Rolle spielt der Hedonismus in diesem Kontext?
Hedonismus wird hier als das exzessive Streben nach Glückserfahrungen und Lebensgenuss verstanden, das im Lied durch das ständige Verlangen nach „mehr“ symbolisiert wird.
Warum fordert das Ich im Lied „Gebt mir auch das noch“?
Es verdeutlicht die radikale Rücksichtslosigkeit des Konsumenten, der sogar das Wenige besitzen will, was anderen gehört, ohne jede Nächstenliebe.
- Quote paper
- Antonia Zentgraf (Author), 2012, „Es ist besser, wenn man mehr hat“!?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203387