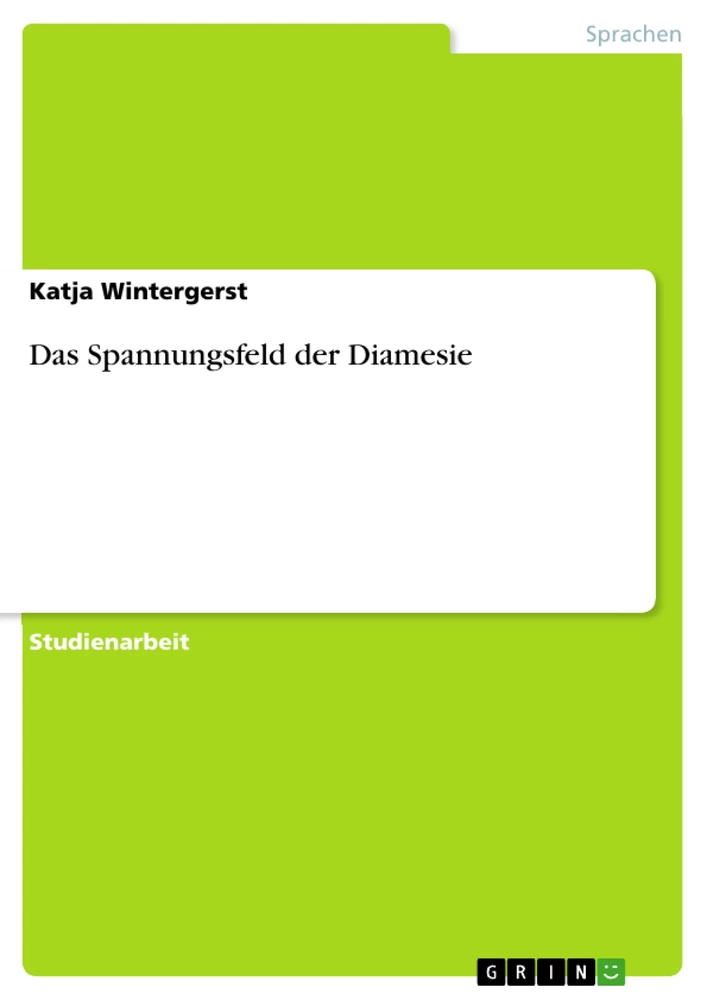Die Varietätenlinguistik ist ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft und hat ihren Ursprung in der Dialektologie, die im 19. Jhd. in Italien u.a. von Graziadio Isaia Ascoli begründet wurde. Innerhalb der strukturellen Dialektologie entwickelte Uriel Weinreich 1954 die Konzeption eines Diasystems, einem ››System von Systemen‹‹: Zwei (oder mehr) Sprachsysteme mit partiellen Ähnlichkeiten werden zu einem D[iasystem] zusammengefasst, das damit strukturelle Gleichheiten/Überschneidungen und Unterschiede widerspiegelt. (Bußmann 2002: 166)
Im Allgemeinen entstehen beim Sprechen Varianten, die entweder vereinzelt zufällig entstehen oder gebräuchlich werden. Eine Vielzahl von einzelnen Varianten, die gebräuchlich geworden sind, wie z.B. eine besondere Aussprache oder Grammatik, bilden eine Varietät. Man unterscheidet allgemein drei Dimensionen von Sprachvariationen in der Sprachwissenschaft. (...)
In der italienischen Sprachwissenschaft führte Alberto Mioni noch den Begriff der diamesischen Variation ein, die das Medium betrifft, in dem eine Äußerung vorliegt, also ‚gesprochen‘ oder ‚geschrieben‘. Ludwig Söll orientierte sich an Mionis Terminologie und dient dadurch als Grundlage für die ausführlichen Untersuchungen der deutschen Sprachwissenschaftler Peter Koch und Wulf Oesterreicher. Und auch die italienische Linguistin Monica Berretta erkannte, dass die diamesische Variation in sprachlinguistische Untersuchungen miteinbezogen werden muss. (...)
Diese Einwände werfen die Frage auf, was wirklich vom Kommunikati-onsmedium abhängt. Was ist prototypisch für gesprochene Sprache, was ist im Geschriebenen nicht denkbar?
Diese Arbeit soll zu Beginn einen knappen Überblick über die Auffas-sungen von Koch/Oesterreicher einerseits und Berretta andererseits hinsichtlich der Unterscheidung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit als einer Variation von Sprache geben. Im Anschluss wird dann ein kurzer Überblick zur Terminologie der Merkmale von Sprache gegeben und daraufhin die universellen Merkmale und die einzelsprachlichen Merkmale von geschriebenem und gesprochenem Italienisch dargestellt. Abschließend soll anhand von konkreten Textbeispielen diskutiert werden, inwieweit eine Unterscheidung nach Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Sinne eines Kommunikationsmediums problematisch sein kann und kritisch hinterfragt werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Varietätenlinguistik und Sprachvariation
- Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Varietätenlinguistik
- Das Modell von Koch und Oesterreicher
- Terminologische Grundlagen
- Die konzeptionelle Dimension
- Die mediale Dimension
- Die Position von Monica Berretta
- Merkmale geschriebener und gesprochener Sprache
- Universelle und einzelsprachliche Kriterien
- Merkmale geschriebener Sprache
- Merkmale gesprochener Sprache
- Textbeispiele zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Italienische Kriegsgefangenenbriefe von Leo Spitzer
- Testi di italiano popolare von Giovanni Rovere
- Auswertung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die diamesische Variation im Italienischen, also die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache. Sie beleuchtet die Kontroverse um den Stellenwert der diamesischen Variation in der Varietätenlinguistik und analysiert verschiedene Modelle zur Beschreibung dieser Unterschiede. Die Arbeit zielt darauf ab, die Problematik der Unterscheidung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit anhand konkreter Textbeispiele zu diskutieren.
- Das Modell von Koch und Oesterreicher zur Unterscheidung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
- Die Position von Monica Berretta zur diamesischen Variation.
- Merkmale mündlicher und schriftlicher Sprache im Italienischen.
- Analyse von Textbeispielen (Kriegsgefangenenbriefe und Testi di italiano popolare).
- Diskussion der Problematik einer eindeutigen Unterscheidung zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache.
Zusammenfassung der Kapitel
Varietätenlinguistik und Sprachvariation: Dieses Kapitel führt in die Varietätenlinguistik ein, ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft, das sich mit Sprachvariation beschäftigt. Es erläutert den Ursprung der Varietätenlinguistik in der Dialektologie und beschreibt verschiedene Dimensionen der Sprachvariation: diatopisch (geographisch), diastratisch (sozial) und diaphasisch (stilistisch). Besonders hervorgehoben wird die diamesische Variation, die sich auf das Medium (gesprochen oder geschrieben) bezieht. Das Kapitel diskutiert die kontroverse Debatte über den Stellenwert der diamesischen Variation im Vergleich zu anderen Varietätsdimensionen und führt in die Problematik ein, die in der Unterscheidung zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache liegt.
Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Varietätenlinguistik: Dieses Kapitel präsentiert zwei gegensätzliche Ansätze zur Beschreibung der Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache: das Modell von Koch und Oesterreicher und die Position von Monica Berretta. Koch und Oesterreicher unterscheiden zwischen dem Medium (phonisch/graphisch) und der Konzeption (gesprochen/geschrieben), um die Komplexität der Unterscheidung zu verdeutlichen. Berretta’s Ansatz wird ebenfalls vorgestellt, wobei auf die Einbeziehung der diamesischen Variation in sprachwissenschaftliche Untersuchungen hingewiesen wird. Die Kapitel zeigt die Spannungen und Schwierigkeiten auf, die die eindeutige Zuordnung von Texten zu einem der beiden Pole (mündlich/schriftlich) mit sich bringt.
Merkmale geschriebener und gesprochener Sprache: Dieses Kapitel befasst sich mit den Merkmalen, die geschriebene und gesprochene Sprache unterscheiden. Es werden sowohl universelle Merkmale (gelten über verschiedene Sprachen hinweg) als auch einzelsprachliche Merkmale des Italienischen betrachtet. Der Fokus liegt darauf, die charakteristischen Eigenschaften beider Kommunikationsmodi herauszuarbeiten und die Grenzen einer klaren Abgrenzung zu verdeutlichen. Es werden Beispiele für typische Merkmale beider Sprachformen genannt, um die Unterschiede zu veranschaulichen und die theoretischen Überlegungen mit empirischem Material zu untermauern.
Textbeispiele zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit: In diesem Kapitel werden konkrete Textbeispiele analysiert, um die theoretischen Überlegungen der vorhergehenden Kapitel zu illustrieren und zu überprüfen. Es werden italienische Kriegsgefangenenbriefe von Leo Spitzer und Testi di italiano popolare von Giovanni Rovere untersucht. Anhand dieser Beispiele wird die Problematik einer klaren Kategorisierung von Texten als "mündlich" oder "schriftlich" diskutiert und die Grenzen des Modells von Koch/Oesterreicher sowie die Relevanz von Berretta’s Ansatz verdeutlicht. Die Analyse der Beispiele dient dazu, die Komplexität der diamesischen Variation und die Notwendigkeit eines differenzierten Ansatzes aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Diamesie, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Varietätenlinguistik, Sprachvariation, Italienisch, Koch/Oesterreicher, Monica Berretta, Kriegsgefangenenbriefe, Testi di italiano popolare, Kommunikationsmedium.
Häufig gestellte Fragen zu: Untersuchung der diamesischen Variation im Italienischen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die diamesische Variation im Italienischen, also die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache. Sie beleuchtet die Kontroverse um den Stellenwert der diamesischen Variation in der Varietätenlinguistik und analysiert verschiedene Modelle zur Beschreibung dieser Unterschiede. Der Fokus liegt auf der Diskussion der Problematik einer eindeutigen Unterscheidung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit anhand konkreter Textbeispiele.
Welche Modelle zur Beschreibung der Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert zwei gegensätzliche Ansätze: das Modell von Koch und Oesterreicher, das zwischen Medium (phonisch/graphisch) und Konzeption (gesprochen/geschrieben) unterscheidet, und den Ansatz von Monica Berretta, der die Einbeziehung der diamesischen Variation in sprachwissenschaftliche Untersuchungen betont. Die Arbeit zeigt die Spannungen und Schwierigkeiten auf, die die eindeutige Zuordnung von Texten zu einem der beiden Pole (mündlich/schriftlich) mit sich bringt.
Welche Merkmale mündlicher und schriftlicher Sprache werden behandelt?
Die Arbeit untersucht sowohl universelle Merkmale (gelten über verschiedene Sprachen hinweg) als auch einzelsprachliche Merkmale des Italienischen, die geschriebene und gesprochene Sprache unterscheiden. Es werden typische Eigenschaften beider Kommunikationsmodi herausgearbeitet und die Grenzen einer klaren Abgrenzung verdeutlicht. Die theoretischen Überlegungen werden mit empirischem Material untermauert.
Welche Textbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert italienische Kriegsgefangenenbriefe von Leo Spitzer und Testi di italiano popolare von Giovanni Rovere. Anhand dieser Beispiele wird die Problematik einer klaren Kategorisierung von Texten als "mündlich" oder "schriftlich" diskutiert und die Grenzen des Modells von Koch/Oesterreicher sowie die Relevanz von Berretta’s Ansatz verdeutlicht. Die Analyse zeigt die Komplexität der diamesischen Variation und die Notwendigkeit eines differenzierten Ansatzes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Varietätenlinguistik und Sprachvariation; Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Varietätenlinguistik (inkl. Modell von Koch und Oesterreicher und Position von Monica Berretta); Merkmale geschriebener und gesprochener Sprache; Textbeispiele zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Analyse von Kriegsgefangenenbriefen und Testi di italiano popolare); Auswertung und Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Diamesie, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Varietätenlinguistik, Sprachvariation, Italienisch, Koch/Oesterreicher, Monica Berretta, Kriegsgefangenenbriefe, Testi di italiano popolare, Kommunikationsmedium.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Problematik der Unterscheidung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit anhand konkreter Textbeispiele zu diskutieren und verschiedene Modelle zur Beschreibung dieser Unterschiede zu analysieren. Sie beleuchtet die Kontroverse um den Stellenwert der diamesischen Variation in der Varietätenlinguistik.
- Arbeit zitieren
- B.A. Katja Wintergerst (Autor:in), 2011, Das Spannungsfeld der Diamesie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203390