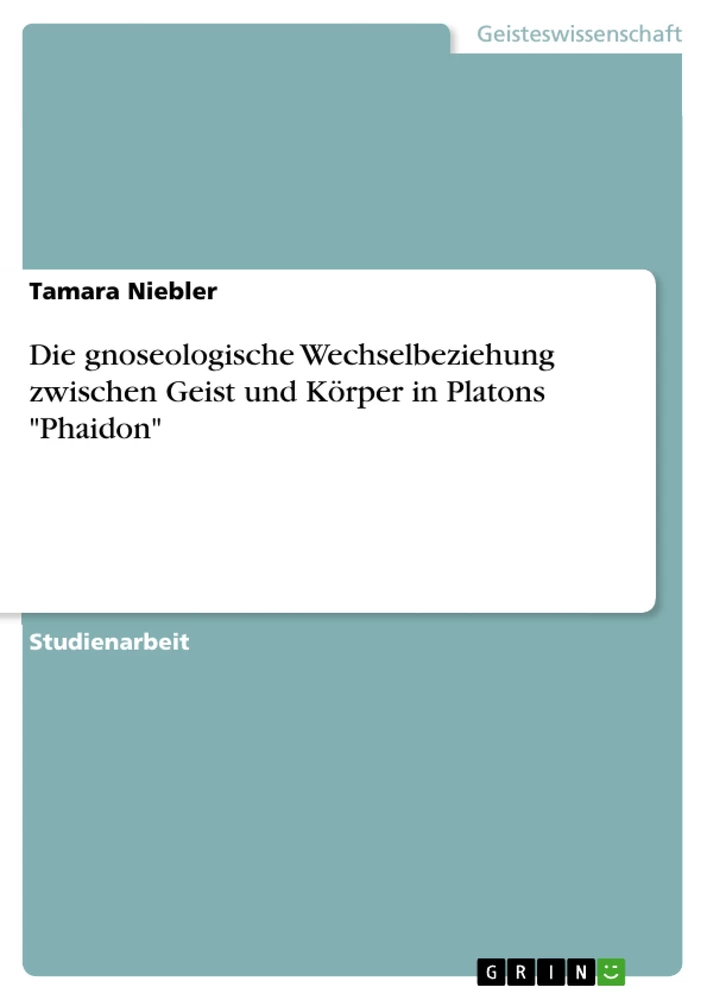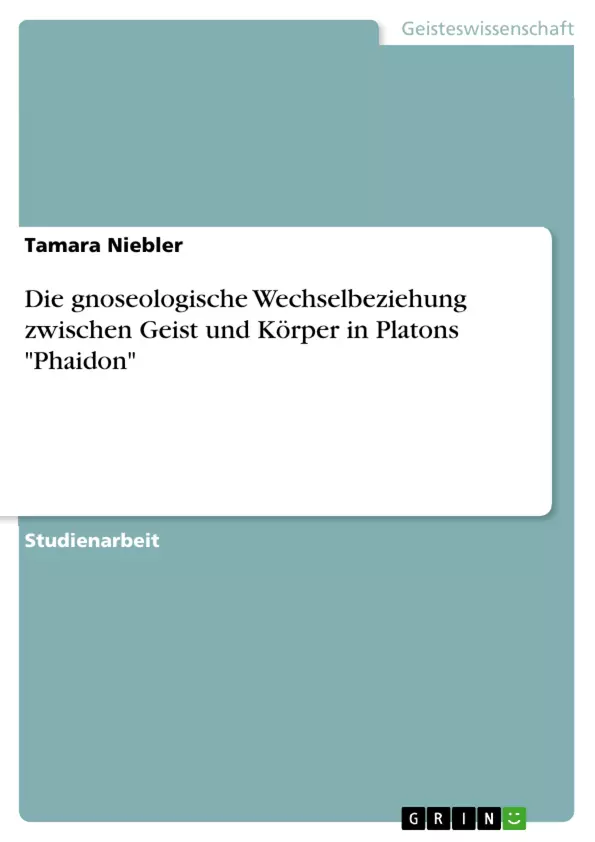Der Körper-Geist-Dualismus besitzt eine langjährige Tradition und besitzt laut der Forschung einen seiner ältesten Vertreter in Platon. Dass diese Position allerdings nicht Platon, sondern den populären Philosophieströmungen seiner Zeit entspricht, welche durche den platonischen Sokrates ironisch dargestellt werden, zeigt diese Arbeit auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1) Einleitung
- 2) Die gnoseologische Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper in Platons Phaidon
- 2.1) Volkstümlicher Dualismus
- 2.1.1) Religion und Dichtung der Archaik
- 2.1.2) Die Vorsokratiker
- 2.1.3) Die Pythagoreer als Repräsentanten eines >vulgären Materialismus<
- 2.2) Das Abbildverhältnis von Ideal und Materie
- 2.2.1) Das Original und sein Bild
- 2.2.2) Der Mikrokosmos als Entsprechung des Makrokosmos
- 2.2.3) Analogieschluss auf das Verhältnis von Geist und Körper
- 2.2.4) Die dialektische Beschaffenheit der Seele
- 2.1) Volkstümlicher Dualismus
- 3) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gnoseologische Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper im Platonschen Phaidon, wobei der Fokus auf der Widerlegung gängiger dualistischer Interpretationen liegt. Die Arbeit analysiert die Argumentationslinien des Dialogs und hinterfragt die Projektion moderner Denkschemata auf das antike Gedankengut. Der Text kontextualisiert die Aussagen des Phaidon im Hinblick auf andere platonische Werke sowie die philosophischen Strömungen der Zeit.
- Widerlegung des platonischen Körper-Geist-Dualismus
- Analyse der Argumentationsstrategien im Phaidon
- Kontextualisierung des Phaidon innerhalb des platonischen Gesamtwerks
- Untersuchung des Einflusses vorplatonischer Philosophien
- Kritik an anachronistischen Interpretationen
Zusammenfassung der Kapitel
1) Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationsansätze des Phaidon, von der früher verbreiteten Ansicht seiner Marginalität im platonischen Werk bis hin zu seiner heutigen hohen Wertschätzung. Sie kritisiert einseitige Interpretationen, die den Dialog auf einen einzigen Aspekt reduzieren und moderne Denkschemata auf antike Texte projizieren. Besonders problematisch ist die weit verbreitete Interpretation Platons als Dualisten, die zu Fehldeutungen wie der Vorstellung Platons als leibfeindlich führt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die gängige These des Körper-Geist-Dualismus im Phaidon zu hinterfragen und durch eine detaillierte Textanalyse zu widerlegen.
2) Die gnoseologische Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper in Platons Phaidon: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Beziehung zwischen Geist und Körper im Phaidon. Es beginnt mit einer Diskussion des „volkstümlichen Dualismus“, der im vorplatonischen Denken verankert ist und die Seelenwanderung betont. Der Hauptteil des Kapitels widmet sich der detaillierten Untersuchung der Argumentation im Phaidon selbst, wobei die sokratische Methode der Dialoge und die Verwendung von Rhetorik und Stilmitteln kritisch untersucht werden, um einseitig interpretierende Lesarten zu widerlegen. Der Fokus liegt auf der nuancierten Darstellung der Beziehung zwischen Geist und Körper, im Gegensatz zu einer vereinfachten dualistischen Lesart.
Schlüsselwörter
Platon, Phaidon, Geist, Körper, Dualismus, Seelenwanderung, Gnoseologie, Interpretation, Dialektik, Sokrates, Vorsokratiker, Pythagoreer, Antike Philosophie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die gnoseologische Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper in Platons Phaidon
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die gnoseologische Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper im Platonschen Phaidon. Der Fokus liegt auf der Widerlegung gängiger dualistischer Interpretationen des Dialogs. Die Analyse konzentriert sich auf die Argumentationslinien des Phaidon und hinterfragt die Projektion moderner Denkschemata auf das antike Gedankengut. Der Text kontextualisiert die Aussagen des Phaidon im Hinblick auf andere platonische Werke und die philosophischen Strömungen der damaligen Zeit.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Widerlegung des platonischen Körper-Geist-Dualismus, die Analyse der Argumentationsstrategien im Phaidon, die Kontextualisierung des Phaidon innerhalb des platonischen Gesamtwerks, die Untersuchung des Einflusses vorplatonischer Philosophien und die Kritik an anachronistischen Interpretationen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Die gnoseologische Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper in Platons Phaidon") und ein Fazit. Das Hauptkapitel unterteilt sich weiter in Abschnitte, die den "volkstümlichen Dualismus" (inkl. Religion und Dichtung der Archaik, Vorsokratiker und Pythagoreer) und das "Abbildverhältnis von Ideal und Materie" (inkl. Original und Bild, Mikro- und Makrokosmos, Analogieschluss und die dialektische Beschaffenheit der Seele) untersuchen.
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung beleuchtet unterschiedliche Interpretationsansätze des Phaidon und kritisiert einseitige Interpretationen, die den Dialog auf einen einzigen Aspekt reduzieren und moderne Denkschemata auf antike Texte projizieren. Sie thematisiert die weit verbreitete, aber problematische Interpretation Platons als Dualisten und das Ziel der Arbeit, diese gängige These zu widerlegen.
Was ist der Inhalt des Hauptkapitels?
Das Hauptkapitel analysiert die Darstellung der Beziehung zwischen Geist und Körper im Phaidon. Es beginnt mit einer Diskussion des "volkstümlichen Dualismus" im vorplatonischen Denken und widmet sich anschließend einer detaillierten Untersuchung der Argumentation im Phaidon selbst. Hierbei werden die sokratische Methode, Rhetorik und Stilmittel kritisch untersucht, um einseitig interpretierende Lesarten zu widerlegen. Der Fokus liegt auf der nuancierten Darstellung der Beziehung zwischen Geist und Körper, im Gegensatz zu einer vereinfachten dualistischen Lesart.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Platon, Phaidon, Geist, Körper, Dualismus, Seelenwanderung, Gnoseologie, Interpretation, Dialektik, Sokrates, Vorsokratiker, Pythagoreer, Antike Philosophie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die gängige These des Körper-Geist-Dualismus im Phaidon zu hinterfragen und durch eine detaillierte Textanalyse zu widerlegen. Sie möchte einseitige und anachronistische Interpretationen des Phaidon kritisch beleuchten und eine differenziertere Sicht auf die Beziehung zwischen Geist und Körper in Platons Werk bieten.
- Citation du texte
- Tamara Niebler (Auteur), 2012, Die gnoseologische Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper in Platons "Phaidon", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203417