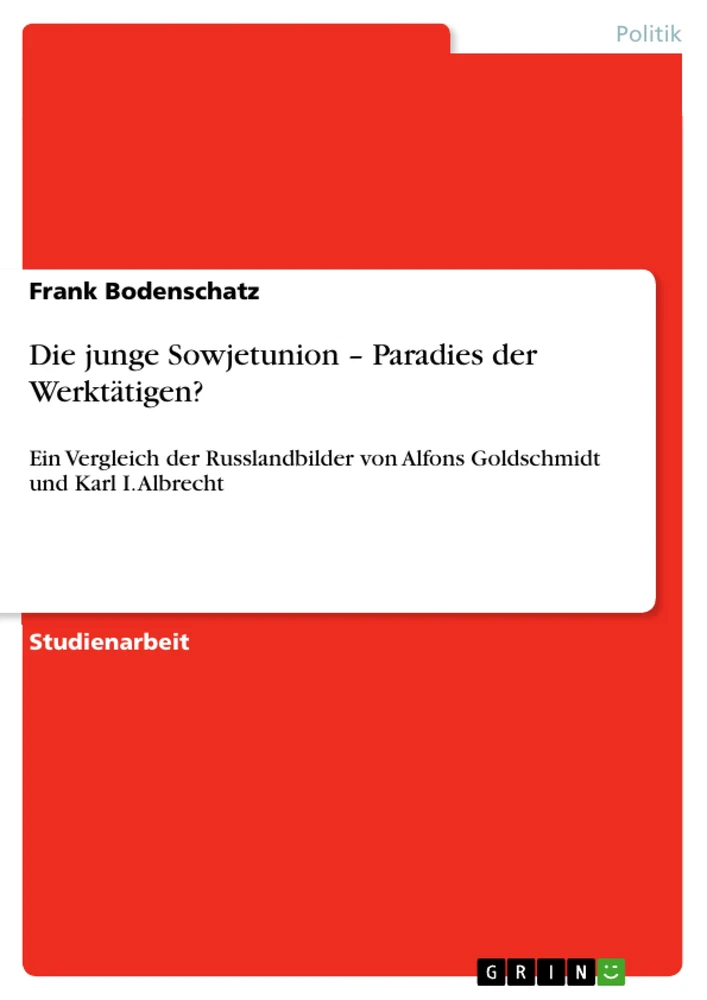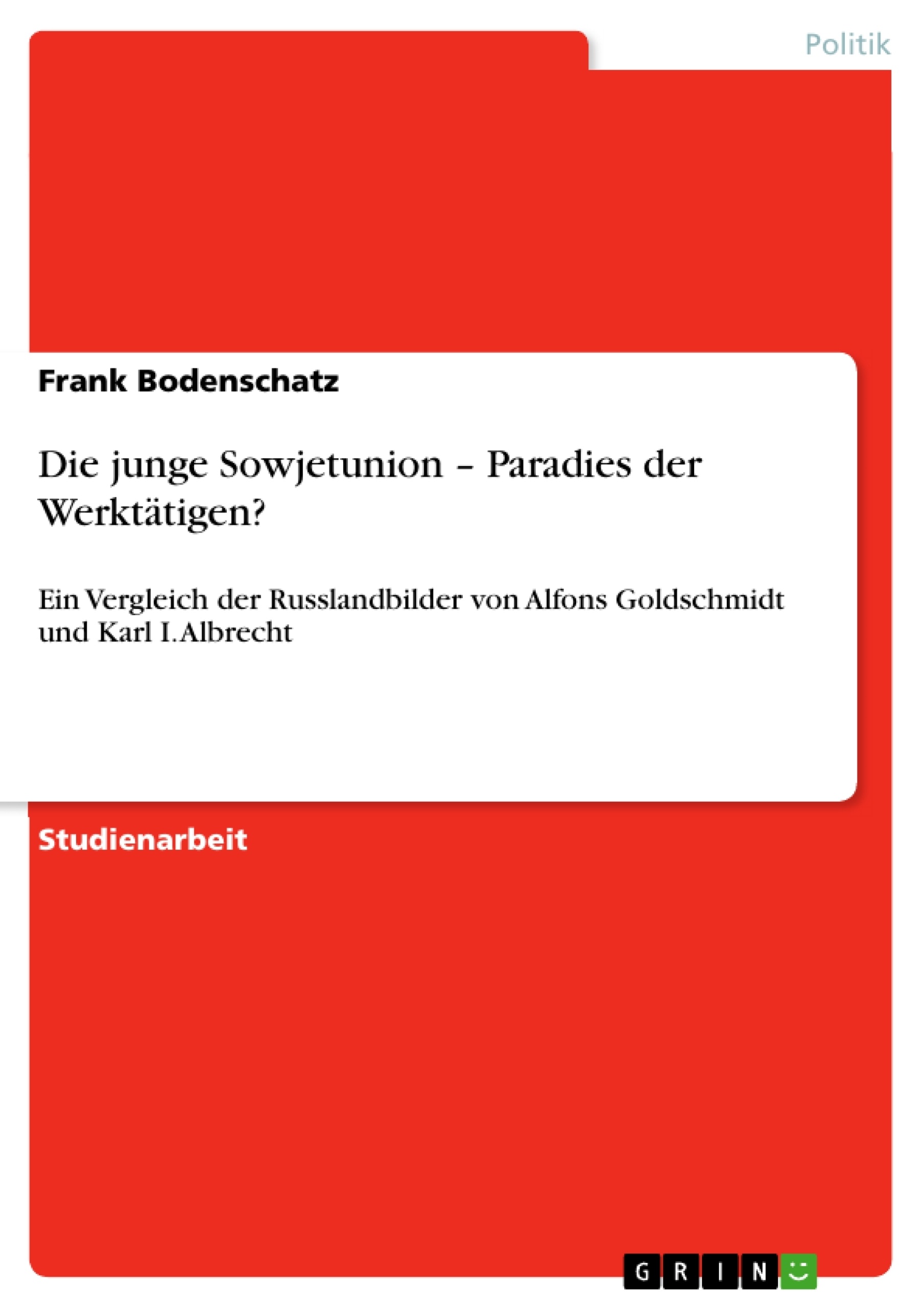Abgesehen vom Ersten Weltkrieg, der Millionen von Todesopfern forderte und ein bis dato unvorstellbares Leid über ganz Europa brachte, gab es in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wohl kein anderes Ereignis, das weltgeschichtlich so bedeutend war wie die russische Oktoberrevolution im Jahre 1917 sowie die anschließende Errichtung des kommunistischen Sowjetsystems.
Zu einer Zeit, in der es noch keine Mittel der Massenkommunikation gab, rankte sich eine Vielzahl von Halbwahrheiten, Mythen und Legenden um die neue, als „Paradies der Werktätigen“ propagierte Gesellschaftsorganisation, die wie kaum eine andere polarisierte und auch im europäischen Westen das Interesse zahlreicher Menschen auf sich zog, zumal die kommunistische Bewegung aufgrund der vorherrschenden gesell-schaftlichen Konfliktlinien international und omnipräsent war. Um sich ein Bild von den neuen Verhältnissen in Sowjetrussland machen zu können, waren Ausländer auf die möglichst wahrheitsgetreuen Erfahrungsberichte reisender oder (zeitweise) emigrierter Landsleute angewiesen. Zu den deutschsprachigen Autoren solcher meist autobiographisch geprägten Schriften zählten der linksintellektuelle Publizist und Ökonom Alfons Goldschmidt sowie Karl I. Albrecht, der sich – soviel sei an dieser Stelle schon verraten – infolge seiner Erfahrungen in Sowjetrussland vom Kommunisten zum Nationalsozialisten wandelte.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Russlandbilder von Goldschmidt und Albrecht in einer vergleichenden Betrachtung gegenüberzustellen, auf Plausibilität zu überprüfen und hinsichtlich der Fragestellung, ob bzw. inwiefern die Zustände in der jungen Sowjetunion tatsächlich als „paradiesisch“ bezeichnet werden konnten, zu bewerten. Der jeweilige persönlich-historische Kontext soll dabei besondere Berücksichtigung finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau
- Über die Autoren
- Alfons Goldschmidt
- Karl I. Albrecht
- Beobachtungen und Erfahrungen in Sowjetrussland
- Alfons Goldschmidts Reiseberichte
- Karl I. Albrechts Erlebnisse als hoher Staatsbeamter
- Vergleich und Kritik
- Schlussbetrachtung
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der vergleichenden Analyse der Russlandbilder von Alfons Goldschmidt und Karl I. Albrecht. Das Ziel ist es, die Plausibilität ihrer Darstellungen zu überprüfen und zu beurteilen, ob die Zustände in der jungen Sowjetunion tatsächlich als „paradiesisch“ bezeichnet werden konnten. Der Fokus liegt dabei auf der persönlichen und historischen Einordnung der Autoren.
- Die unterschiedlichen Russlandbilder von Goldschmidt und Albrecht
- Die Plausibilität der Darstellungen beider Autoren
- Die Frage, ob die Sowjetunion tatsächlich als „Paradies“ betrachtet werden konnte
- Der persönliche und historische Kontext der Autoren
- Der Einfluss von Ideologie und politischem Wandel auf die Wahrnehmung der Sowjetunion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung der Arbeit vor und skizziert den Aufbau. Kapitel zwei gibt eine kurze biographische Einführung in das Leben der beiden Autoren, Alfons Goldschmidt und Karl I. Albrecht.
Kapitel drei beschäftigt sich mit den Beobachtungen und Erfahrungen der beiden Autoren während ihrer Aufenthalte in Sowjetrussland. Dabei stehen Goldschmidts Reiseberichte und Albrechts Abrechnung im Mittelpunkt.
Kapitel vier vergleicht die Darstellungen der beiden Autoren und analysiert kritisch ihre Publikationen. Die realistische Einschätzung der jeweiligen Darstellungen wird dabei diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Russlandbild, Sowjetunion, Kommunismus, Nationalsozialismus, Reiseberichte, autobiografische Schriften, Ideologie, politischer Wandel, historische Einordnung, Vergleichende Analyse und Plausibilitätsprüfung.
Häufig gestellte Fragen
War die junge Sowjetunion wirklich ein "Paradies der Werktätigen"?
Die Arbeit untersucht diese propagandistische Behauptung durch den Vergleich von Berichten zeitgenössischer deutscher Autoren und prüft deren Wahrheitsgehalt.
Welche Autoren werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden der linksintellektuelle Alfons Goldschmidt und Karl I. Albrecht, der sich später vom Kommunisten zum Nationalsozialisten wandelte.
Wie unterschieden sich die Perspektiven von Goldschmidt und Albrecht?
Goldschmidt verfasste eher enthusiastische Reiseberichte, während Albrecht als hoher Staatsbeamter tiefe Einblicke in das System erhielt und später eine scharfe Abrechnung vorlegte.
Welche Rolle spielten Mythen über die Oktoberrevolution?
Da es noch keine Massenkommunikation gab, waren Ausländer auf autobiographische Berichte angewiesen, die oft von Ideologie geprägt waren und Legenden schufen.
Was ist das Ziel der vergleichenden Betrachtung?
Ziel ist es, die Russlandbilder auf Plausibilität zu prüfen und den Einfluss des persönlichen und historischen Kontexts der Autoren auf ihre Wahrnehmung aufzuzeigen.
- Citation du texte
- Frank Bodenschatz (Auteur), 2011, Die junge Sowjetunion – Paradies der Werktätigen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203483