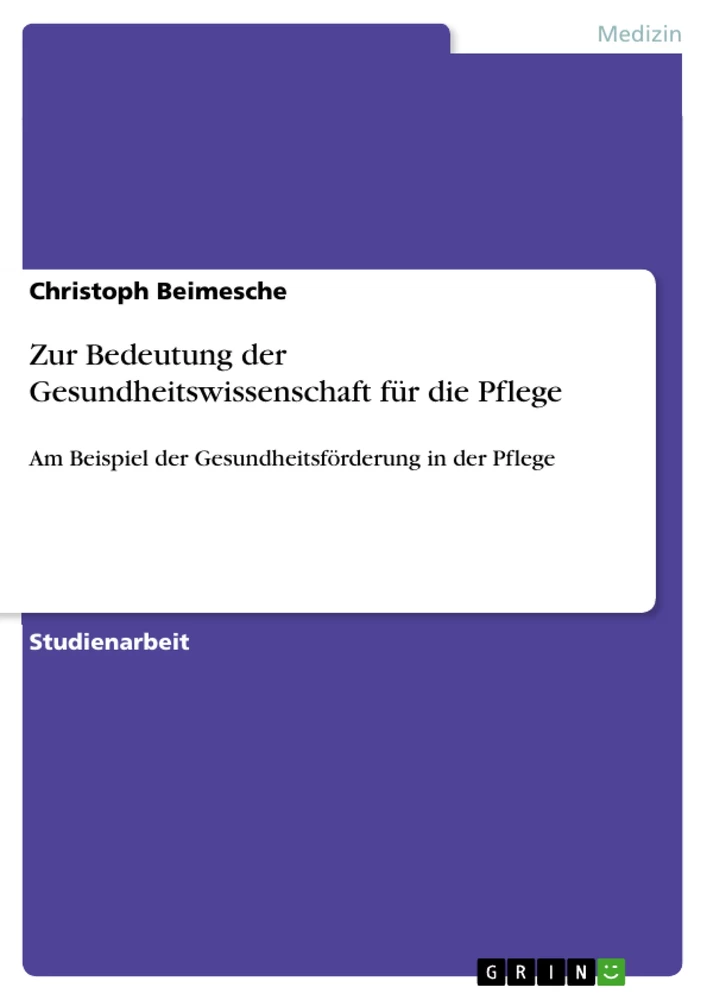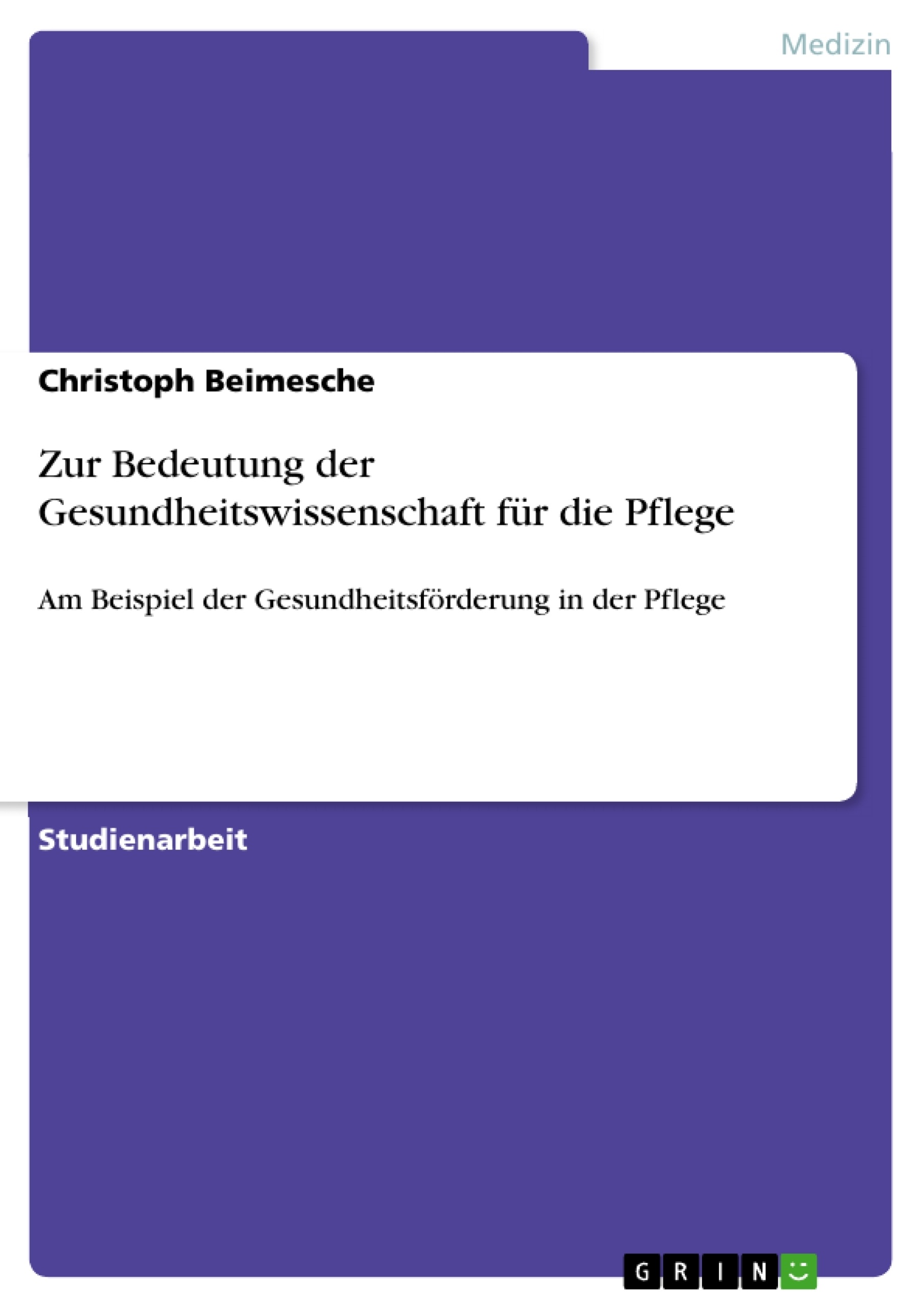Die heutige Zeit ist für die Pflege eine belastende Phase, zum einen hat sie im professionellen Sinne noch kein scharfes Profil ihrer Aufgaben, zum anderen erfährt sie im Zuge der Umstrukturierungen, besonders im Krankenhaus, eine hohe Arbeitsverdichtung.
Was macht Pflege?
Spätestens seit der Umbenennung von Krankenschwester/ Krankenpfleger in Gesundheits- und Krankenpfleger/in und den vier benannten Aufgabenbereichen der Pflege, die im ICN-Ethikkodex beschrieben sind, muss Pflege ihre Arbeit um den Aspekt der Gesundheit erweitern. Bislang, auch vermehrt im jetzigen Alltag, geschieht die Versorgung der Patienten aus Sicht der Krankheit. Der Alltag ist geprägt durch delegierte Aufgaben aus dem ärztlichen Bereich, sowie eine starke Erhöhung der administrativen Aufgaben. Der Patient gerät ins Hintertreffen, er wird förmlich durch den Betrieb Krankenhaus „durchgeschleust“ (vgl. Bartholomeycik 2006, 1032f.).
Was kann Pflege?
Pflege soll, ergänzend zur Betrachtung der Krankheit, ihren Blick auf Gesundheit legen und nicht wie in der Medizin, wie heile ich die Krankheit, sondern wie fördere ich Gesundheit.
Es soll dargelegt werden welche Bedeutung die Gesundheitswissenschaft für die Pflege hat und welche Möglichkeiten für Pflege sich in der Gesundheitsförderung ergeben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Begriffserklärungen
1.1.1 Gesundheit
1.1.2 Gesundheitswissenschaft
1.2 Gesundheitswissenschaften in der Pflege
1.2.1 Abgrenzung zur Medizin
1.2.2 Verhältnis zu Pflegewissenschaft
2. Gesundheitsförderung
2.1 Definitionen und Abgrenzungen
2.1.1 Abgrenzung zur Prävention
2.1.2 Salutogenese
2.1.3 Ottawa-Charta
2.2 Die Ebenen der Gesundheitsförderung
2.2.1 Personale Ebene
2.2.2 Verhaltensebene
2.2.3 Verhältnisebene
2.3 Methoden der Gesundheitsförderung
2.3.1 Gesundheitserziehung und Gesundheitsbildung
2.3.2 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsberatung
2.4 Der Setting-Ansatz
3. Gesundheitsförderung in der Pflege
3.1 Pflegerische Handlungsfelder
3.1.1 Gesundheitsberatung
3.1.2 Gesundheitsförderung in Settings
3.2 Probleme der Umsetzung
4. Zusammenfassung und Ausblick
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Gesundheitswissenschaft für die Pflege wichtig?
Sie ermöglicht der Pflege, den Fokus von der reinen Krankheitsbehandlung (Medizin) auf die aktive Förderung der Gesundheit zu verschieben.
Was ist Salutogenese?
Ein Konzept, das untersucht, warum Menschen gesund bleiben, anstatt nur nach den Ursachen von Krankheiten (Pathogenese) zu fragen.
Was besagt die Ottawa-Charta?
Sie ist ein Grunddokument der Gesundheitsförderung, das Strategien zur Stärkung der Eigenverantwortung und zur Gestaltung gesunder Lebenswelten definiert.
Was ist der Setting-Ansatz?
Gesundheitsförderung findet dort statt, wo Menschen leben und arbeiten (z.B. Schule, Betrieb, Krankenhaus), um die Verhältnisse direkt zu verbessern.
Wie grenzt sich Pflege von der Medizin ab?
Während die Medizin primär heilen will, konzentriert sich die pflegerische Gesundheitswissenschaft auf die Förderung von Ressourcen und Wohlbefinden.
- Citar trabajo
- cand. Dipl. Pflegewirt (FH) Christoph Beimesche (Autor), 2010, Zur Bedeutung der Gesundheitswissenschaft für die Pflege, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203512