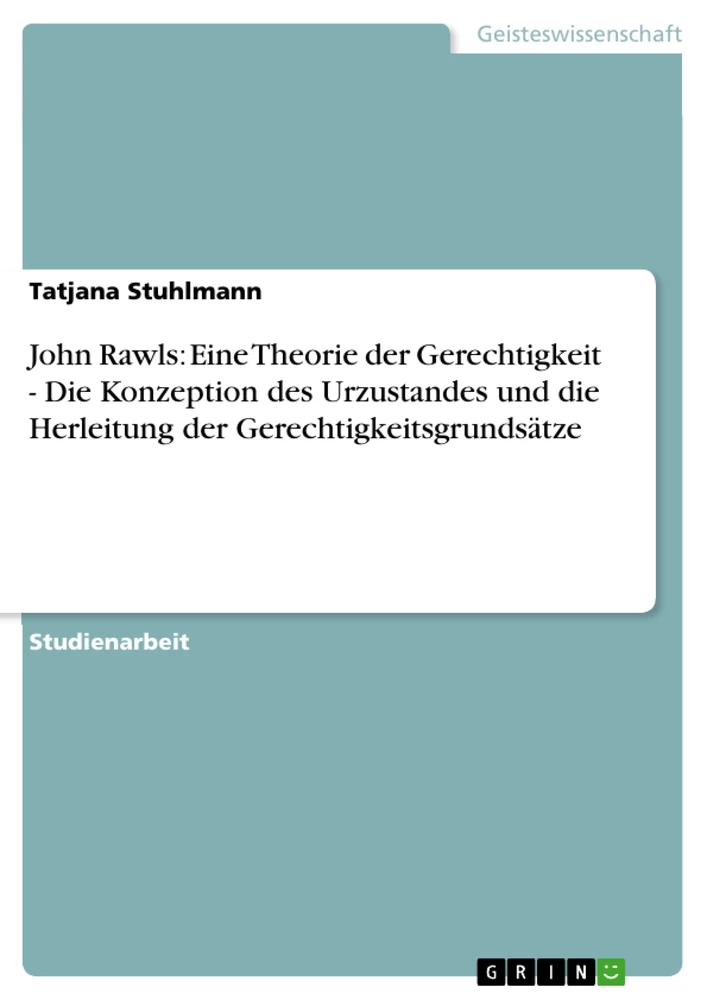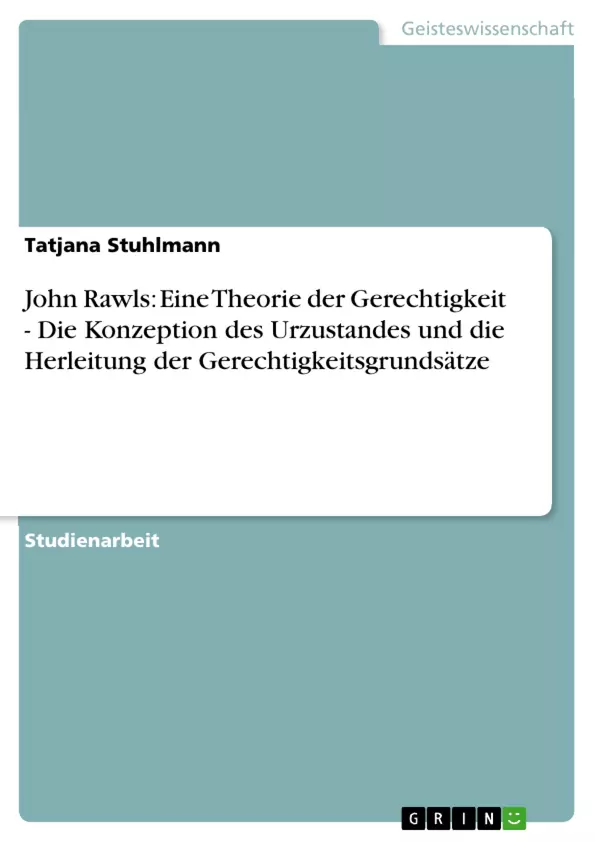Die von John Rawls in seinem 1971 erschienenen Werk „A Theory of Justice“ präsentierte Gerechtigkeitstheorie schließt an die Tradition der Vertragstheorien von Locke, Rousseau und Kant an. Sie versucht aber diese herkömmlichen Vertragstheorien zu verallgemeinern und auf eine höhere Abstraktionsstufe zu heben.
Es handelt sich bei Rawls Gerechtigkeitstheorie um ein Gedankenexperiment: Die Vertragspartner werden in einen fiktiven Urzustand versetzt, in dem sie gemeinsam über die Gerechtigkeitsgrundsätze entscheiden, die der Gesellschaftsordnung zugrunde liegen sollen.
Ich werde mich in der vorliegenden Arbeit mit der Konzeption des Urzustandes beschäftigen und herausarbeiten, welche bestimmten Bedingungen er nach Rawls erfüllen muss. Anschließend werde ich darstellen, wie aus dem Urzustand die Gerechtigkeitsgrundsätze hergeleitet werden.
Zunächst sollen aber knapp die zentralen Gedanken der Rawlschen Gerechtigkeitstheorie dargelegt werden. Hierbei scheint es vor allem wichtig, den Rawlschen Gerechtigkeitsbegriff zu definieren, da dies für eine korrekte Darlegung unentbehrlich erscheint und zudem einführenden Charakter hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die zentralen Gedanken der Rawlschen Gerechtigkeitstheorie
- Der Begriff der Gerechtigkeit
- Gerechtigkeit als Fairness
- Die Konzeption des Urzustandes
- Objektive und subjektive Umstände
- Formale Bedingungen für die Grundsätze
- Allgemeinheit
- Unbeschränkte Anwendbarkeit
- Öffentlichkeit
- Rangordnung
- Endgültigkeit
- Kenntnisse der Menschen
- Der Schleier des Nichtwissens
- Allgemeines Wissen von sozialen und wirtschaftlichen Prozessen
- Beweggründe und Vernünftigkeit der Menschen
- Schwache Theorie des Guten
- Gegenseitiges Desinteresse
- Gerechtigkeitssinn
- Die Argumentation im Urzustand
- Das Entscheidungsproblem
- Argumente für die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze
- Die Maximin Regel
- Argument der Vertragstreue
- Argument der Selbstachtung
- Kritische Würdigung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption des Urzustandes in John Rawls' Gerechtigkeitstheorie. Sie analysiert die Bedingungen, die nach Rawls für den Urzustand erfüllt sein müssen, und zeigt auf, wie aus diesem die Gerechtigkeitsgrundsätze abgeleitet werden.
- Der Begriff der Gerechtigkeit in Rawls' Theorie
- Die Konzeption des Urzustandes als Entscheidungssituation
- Die Herleitung der Gerechtigkeitsgrundsätze aus dem Urzustand
- Die Rolle des Schleiers des Nichtwissens
- Die Kritik an Rawls' Gerechtigkeitsgrundsätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Gedanken der Rawlschen Gerechtigkeitstheorie vor und führt in das Thema der Arbeit ein. Sie beleuchtet den Begriff der Gerechtigkeit in Rawls' Theorie und die Konzeption der Gerechtigkeit als Fairness.
Das dritte Kapitel untersucht die Konzeption des Urzustandes, den Rawls als eine faire Entscheidungssituation für die Wahl von Gerechtigkeitsgrundsätzen definiert. Es werden die objektiven und subjektiven Umstände des Urzustandes sowie die formalen Bedingungen für die Gerechtigkeitsgrundsätze näher erläutert. Zudem wird die Rolle des Schleiers des Nichtwissens und das allgemeine Wissen der Menschen im Urzustand analysiert.
Kapitel IV beschäftigt sich mit der Argumentation im Urzustand. Es wird dargestellt, wie Rawls die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze aus dem Urzustand ableitet und welche Argumente er dafür verwendet. Die Maximin-Regel, das Argument der Vertragstreue und das Argument der Selbstachtung werden dabei genauer betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rawlsche Gerechtigkeitstheorie, den Urzustand, den Schleier des Nichtwissens, die Gerechtigkeitsgrundsätze, die Maximin-Regel, die Vertragstreue, die Selbstachtung und die Kritik an Rawls' Theorie.
- Quote paper
- Tatjana Stuhlmann (Author), 2012, John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit - Die Konzeption des Urzustandes und die Herleitung der Gerechtigkeitsgrundsätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203528