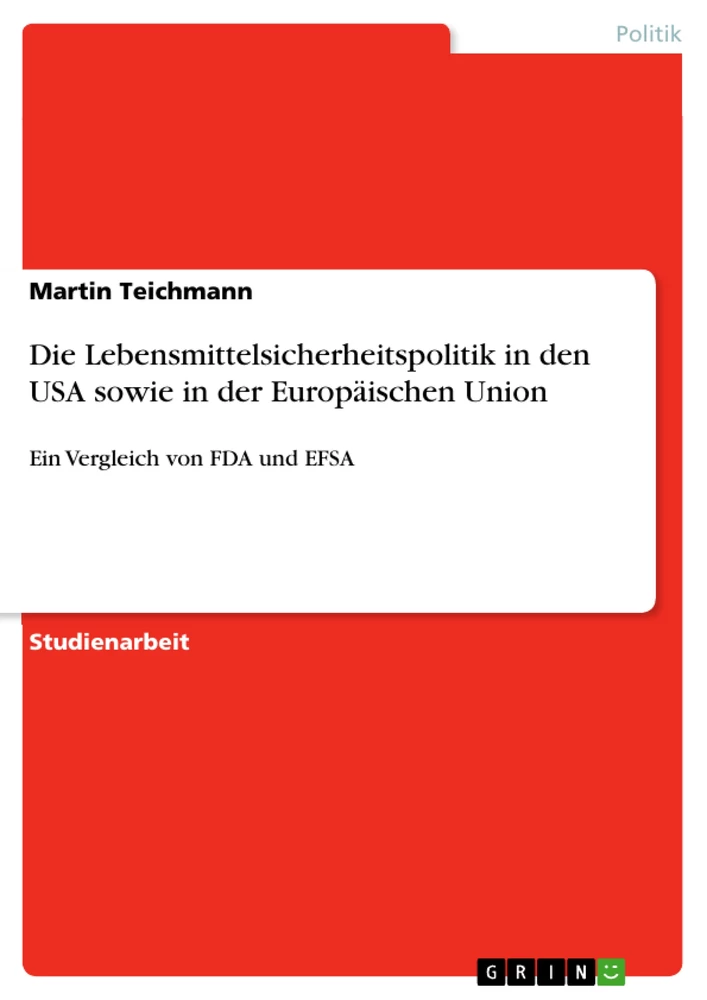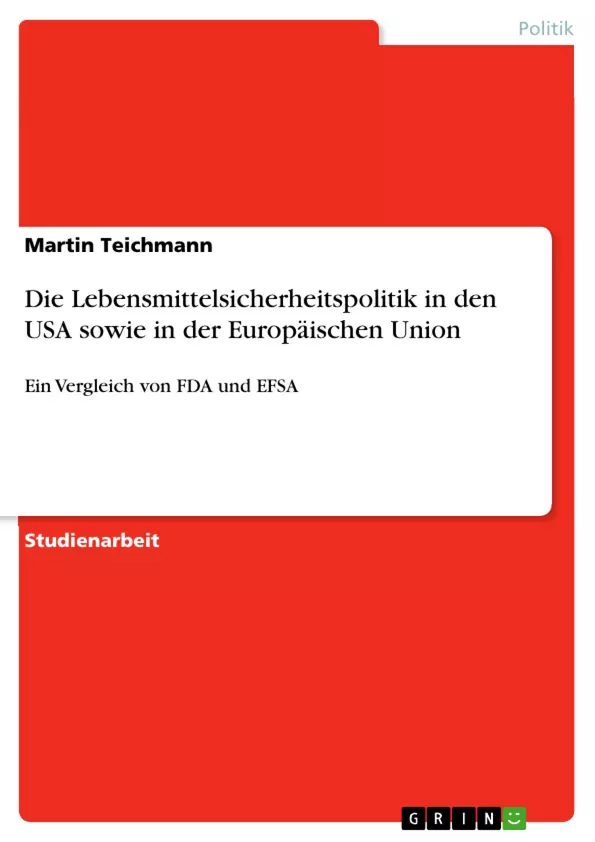Seit 1987 nach einem Urteil des europäischen Gerichtshofes das deutsche Reinheitsgebot nur für deutsche Bierhersteller, aber nicht mehr für importierte Biere galt, ging eine fast 500jährige Ära zu Ende. Anhand der Geschichte dieses Reinheitsgebotes für Biere, eines der beliebtesten Getränke weltweit, lassen sich Anfang und der weitere Weg der Lebensmittelpolitik kurz skizzieren: Bier diente den Bürgern als ein Kalorienbringer und Vitaminquelle (von den angeblich heilenden Kräften, die Bier zugeschrieben wurden, einmal abgesehen) und konnte, im Gegensatz zu dem oft verschmutzten Wasser, bedenkenlos getrunken werden. Das Gebräu war schon im frühen Mittelalter bekannt. Da aber im Zuge der Subsistenzwirtschaft lange für den Eigenbedarf gebraut wurde und erst an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert das Handelsbrauwesen aufkam, bestand für eine Reglementierung zuerst noch kein Bedarf. Als dann, zurückblickend relativ spät, der bayrische Herzog Wilhelm IV am 23.04.1516 das Reinheitsgebot für Biere erließ, ist dies sicherlich auf einen mittelalterlichen Zunft- und Gewerbedirigismus zurückzuführen. Allerdings liegt die herausragende Bedeutung dieses Reinheitsgebotes auch in dem damit erlassenen hohen Qualitätsstandard, welcher in besonderem Maße auch als eine Art Verbraucherschutz angesehen werden kann (und muss), da mit diesem Erlass erstmals die Herstellung eines Volksnahrungsmittels reglementiert wurde. Verstöße gegen dieses Reinheitsgebot wurden (zu Beginn mit sehr rudimentären Methoden, welche aber immer weiter entwickelt wurden) aufzudecken versucht. Falls dieses gelang, wurde der Verursacher des Verstoßes hart bestraft. Das bayerische Reinheitsgebot von 1516 wurde mit der Überführung als deutsches Reinheitsgebot in nationales Recht transferiert und übernommen. Im Zuge der Liberalisierung des EG-Binnenmarktes wurde das deutsche Reinheitsgebot, immer noch basierend auf den Gesetzesgrundlagen von 1516, in das EU-Recht überführt und die Reglementierungen des Produktes erfuhren damit internationale Gültigkeit. Sicherlich darf man keinen wissenschaftlichen Vergleich zwischen damals und heute ziehen, allerdings hat sich der eigentliche Ablauf von Erlass, Kontrolle und Sanktionen, über die Beibehaltung bzw. Erweiterung eines Lebensmittelgesetzes seit 1516 im Wesentlichen kaum geändert.1
Inhalt
1. Einleitung
2. Lebensmittelsicherheit in einem globalisierten Markt
3. Gegenwärtige Bestrebungen in der Lebensmittelsicherheit
4. Veränderungen in den Industrieländern
5. Maßnahmen als Grundlage zur Lebensmittelsicherheitsreform rund u.d.Globus
6. Der Einfluss des weltweiten Wandels in der Lebensmittellandschaft auf das Lebensmittelsicherheitssystem der USA
6.1 Klimawandel
6.2 Wandel des Konsumentenverhaltens und der Konsumentenwahrnehmung
6.3 Globalisierung und der damit einhergehende Anstieg der Lebensmittelimporte
7. Maßnahmen zur Erhöhung der Lebensmittelsicherheit
7.1 Die Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz
7.2 Angst vor biologisch-terroristischer Attacken
7.3 Anstieg der Umweltverschmutzung
7.4 Internationale Handelsabkommen
8. Problematik der industriell erzeugten Lebensmittel
9. Einflussnahme auf die Ernährungsweise
9.1 Einflussnahme durch Werbung und Produktplatzierung
9.2 Einflussnahme durch Spenden und Fördermittel für Forschung
9.3 Einflussnahme durchIndustrieverbände und Organisationen
9.4 Einflussnahme durch juristische Maßnahmen
10. Analysemethoden zur Lebensmittelsicherheit
11. Der Anstieg der internationalen Steuerung von Lebensmittelsicherheit
12. Der Codex Alimentarius
13. Grenzen der Lebensmittelsicherheit
14. Überblick über das Lebensmittelsicherheitssystem der USA
15. Aufbau und Verantwortlichkeit der FDA bei der Lebensmittelsicherheit
16. Mängel bei der durch die FDA überwachte Lebensmittelsicherheit
17. EU Reform und der Weg zur EFSA
18. Aufteilung der Risikoanalyse
19. EFSA
20. Aufbau der EFSA
20.1 Organisationsstruktur der EFSA
21. ECDC
22. Vergleich und Fazit
23. Abkürzungsverzeichnis
24. Literatur und Quellen .
Häufig gestellte Fragen
Was ist die historische Bedeutung des bayerischen Reinheitsgebotes von 1516?
Es gilt als eine der ersten Reglementierungen eines Volksnahrungsmittels und kann als früher Vorläufer des modernen Verbraucherschutzes angesehen werden.
Welche Aufgaben hat die EFSA in der Europäischen Union?
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist für die wissenschaftliche Risikoanalyse und Beratung im Bereich der Lebensmittelsicherheit zuständig.
Wie ist die Lebensmittelsicherheit in den USA organisiert?
In den USA ist primär die Food and Drug Administration (FDA) für die Überwachung und Steuerung der Lebensmittelsicherheit verantwortlich.
Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Lebensmittelsicherheit?
Der Klimawandel verändert Produktionsbedingungen und Handelswege, was neue Anforderungen an die Sicherheitssysteme der USA und der EU stellt.
Was ist der Codex Alimentarius?
Der Codex Alimentarius ist eine Sammlung internationaler Lebensmittelstandards, die zur Harmonisierung der weltweiten Lebensmittelsicherheit beitragen soll.
Welche Probleme bringen industriell erzeugte Lebensmittel mit sich?
Die Arbeit thematisiert Mängel in der Überwachung, die Problematik langer Lieferketten und die Einflussnahme der Industrie durch Werbung und Lobbyismus.
- Arbeit zitieren
- Martin Teichmann (Autor:in), 2012, Die Lebensmittelsicherheitspolitik in den USA sowie in der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203566