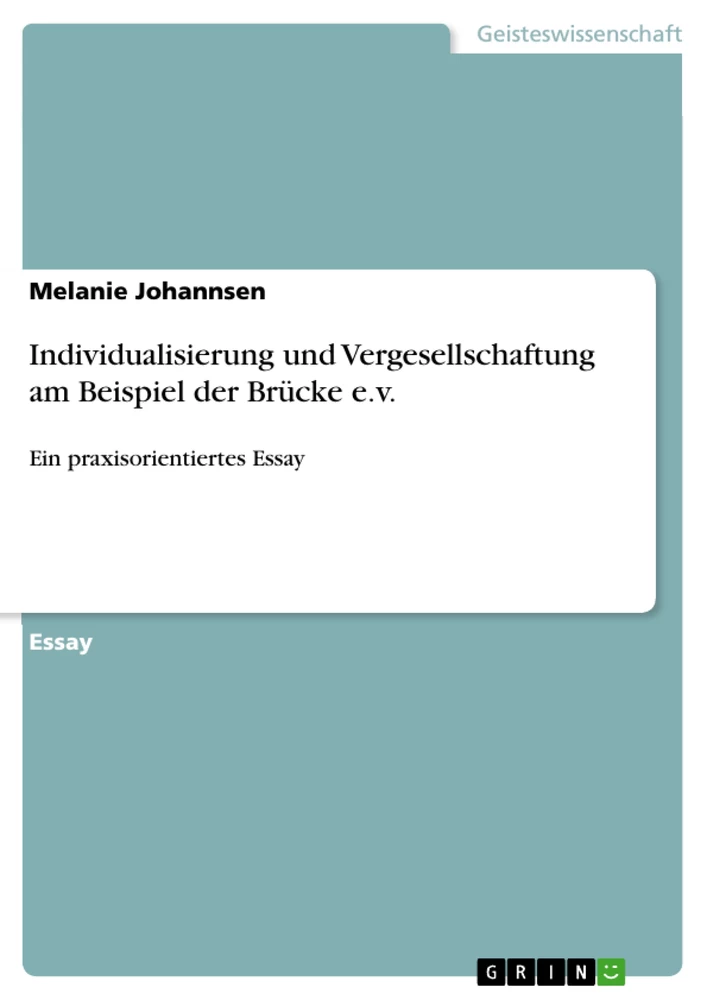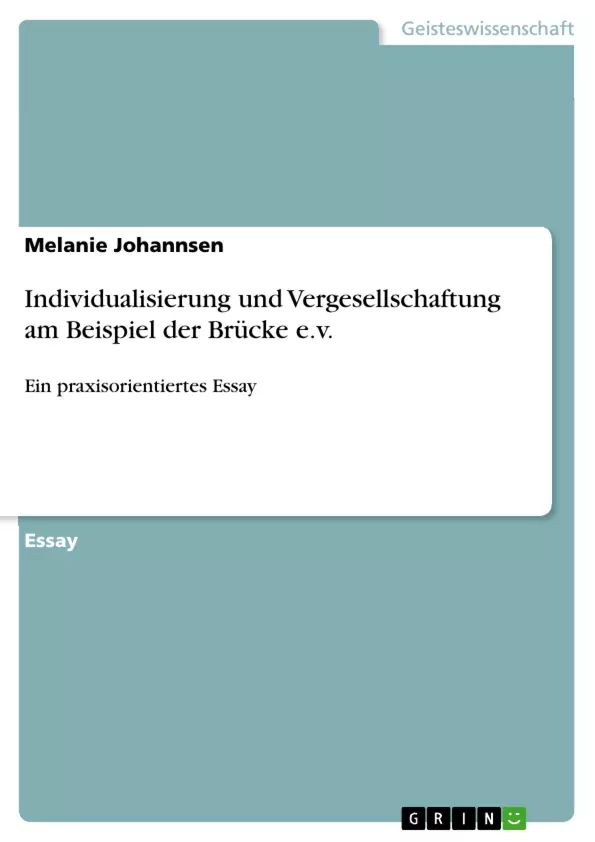Individualisierungstheorien und die Theorien der Systemtheoretiker geben insgesamt viel Raum für Erklärungsmodelle und die Interpretation gesellschaftlicher Verhältnisse. Doch entsprechen sie der Realität? Können wir sie irgendwo wiederfinden oder wiedererkennen? Ein sehr intensives Beispiel ist eine Organisation, die sich praktisch intensiv mit den Grundgedanken verschiedener Theorien auseinandersetzt, finden wir im Bereich der ambulanten Integration psychisch erkrankter Individuen in die Gesellschaft.
Individualisierungstheorien und die Theorien der Systemtheoretiker geben insgesamt viel Raum Erklärungsmodelle und die Interpretation gesellschaftlicher Verhältnisse. Doch entsprechen sie der Realität? Können wir sie irgendwo wiederfinden oder wiedererkennen?
Ein sehr intensives Beispiel für eine Organisation, die sich praktisch intensiv mit den Grundgedanken verschiedener Theorien auseinandersetzt, finden wir im Bereich der ambulanten Integration psychisch erkrankter Individuen in die Gesellschaft. Anhand dieses Bereiches soll ein praktisches Bild für den Umgang mit den gesellschaftlichen Strukturen gegeben werden, der einen kritischen Blick auf die Situation desselben zulassen will. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Aspekten des „Normalen“ und der „Freiheit“, sowie auf der Vorstellung der Gesellschaft, welche mit den verschiedenen Theorien in Verbindung gebracht werden sollen.
Das Problem des Individuums und seiner Vergesellschaftung wird innerhalb verschiedener sozialpädagogischer Einrichtungen aktiv wahrgenommen. In diesem Zusammenhang ist nicht nur der Deutsche Kinderschutzbund e.v. zu nennen, sondern auch die Brücke e.v. .[1]:
Die MitarbeiterInnen dieser Einrichtung haben den Auftrag Individuen, welche aus der Gesellschaft aufgrund psychischer Erkrankungen ausgegrenzt werden, wieder in die Lage zu versetzen, sich trotz ihrer Erkrankung innerhalb der Gesellschaft wieder als anerkannte Mitglieder zu bewegen. Jede/r, der hier zum Klientel der Einrichtung gehört, hat eine Leidensgeschichte hinter sich, die durch das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung entstanden ist und durch die gesellschaftlichen Verhältnisse gesteigert wurde.
Auslöser einer solchen Erkrankung sind meist Krisenerlebnisse wie der Verlust des Arbeitsplatzes durch z.B. Diskriminierung, den Tod nahe stehender Personen oder insgesamt Schwierigkeiten, sich aufgrund einer vorhandenen psychischen Erkrankung in ihrer Umwelt zu bewegen, die das Leben der Betroffenen nachhaltig beeinflusst haben.
Die psychischen Erkrankungen, welche dadurch zum Ausdruck kommen, sind vielfältig und heute in der Mehrzahl Persönlichkeitsstörungen, wie z.B. manisch-depressive Störungen, Borderline-Störungen, paranoide Chizophrenie, Neurosen, Paranoia und Phobien. Außerdem sind aber auch Drogen- und Suchtprobleme, welche im späteren Verlauf zu Depressionen oder Psychosen führen können, in dieser Einrichtung nicht unbekannt. Hierbei wird innerhalb der Praxis der Einrichtung tendenziell deutlich, dass Frauen mit ihren Problematiken eher in sich gekehrt und aggressiv gegen sich selbst gerichtet umgehen und eher von Depressionen betroffen sind als Männer. Die Männer dagegen sind in ihrem Erleben der Situation eher extrovertiert und nach außen hin aggressiv, so dass die Wahrscheinlichkeit von Gewalt und Ausschreitungen größer ist. Dennoch, oder gerade wegen dieser Tendenzen, werden die Mischformen beider Richtungen bei beiden Geschlechtern in der täglichen Erfahrung der MitarbeiterInnen umso deutlicher.[2]
Die Paarung psychischer Erkrankungen bzw. Beeinträchtigungen mit zunehmenden Problemen, sich gesellschaftlich zu etablieren bzw. zurechtzufinden, führen in der Regel zu einer Senkung der Arbeitsfähigkeit und zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Es entstehen Schuldgefühle gegenüber der Gesellschaft, obschon der Arbeitseinschränkung, und sich selbst gegenüber, obschon der Veränderung des Kontaktes mit der (persönlichen) Umwelt. Nicht selten geht hiermit der Verlust des Arbeitsplatzes und der schleichende Verlust der persönlichen Kontakte einher, so dass mit fortschreitender Zeit die Schuldgefühle gegenüber der eigenen Person potenziert werden und die immer wieder scheiternden Bemühungen, diesen Zustand selbstständig zu beheben, diese wiederum verstärken.
Die KlientInnen der Brücke e.v. sind aufgrund einer solchen Situation freiwillig an den Verein herangetreten und haben im Rahmen der ambulanten Betreuung nach Hilfe gefragt, nachdem sie erkannt hatten, dass sie mit dem steigenden Lebensdruck und der fortschreitenden Ausgrenzung aus der Gesellschaft nicht mehr allein umgehen konnten und ihre psychische Erkrankung als den Auslöser für ihre Situation erkannt hatten. Der Wunsch nach einem Kontakt zur Gesellschaft und dem Gefühl ein soziales Wesen zu sein, hat letztendlich zu einer freiwilligen Kontaktaufnahme mit der Einrichtung geführt.
[...]
[1] Die folgenden Informationen basieren auf einem narrativen Interview, welches in einem offenen Treffpunkt mit dem Angebot ambulanter Betreuung der Brücke e.v. mit einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter der ambulanten Betreuung durchgeführt wurde.
[2] Ein großes Problem sei hierbei das 'Schubladendenken' der Einteilung der psychischen Erkrankungen und die Entstehung zahlreicher Vorurteile gegenüber den KlientInnen durch die Öffentlichkeit, aber auch durch psychiatrisches Fachpersonal, welche durch die KlientInnen nicht oder nur schwer widerlegbar seien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Vereins "Die Brücke e.v."?
Der Verein hat den Auftrag, Individuen, die aufgrund psychischer Erkrankungen ausgegrenzt wurden, ambulant zu integrieren und sie wieder als anerkannte Mitglieder der Gesellschaft zu etablieren.
Welche psychischen Erkrankungen treten bei den Klienten häufig auf?
Häufige Diagnosen sind Persönlichkeitsstörungen wie Borderline, manisch-depressive Störungen, paranoide Schizophrenie, Neurosen sowie Drogen- und Suchtprobleme.
Gibt es Unterschiede im Erleben der Krankheit zwischen Männern und Frauen?
Tendenziell gehen Frauen eher in sich gekehrt und aggressiv gegen sich selbst mit Problemen um (Depressionen), während Männer eher extrovertiert und nach außen hin aggressiv reagieren.
Was sind häufige Auslöser für die psychischen Krisen der Betroffenen?
Krisenerlebnisse wie der Verlust des Arbeitsplatzes durch Diskriminierung, der Tod nahestehender Personen oder generelle Schwierigkeiten, sich in der Umwelt zu bewegen, sind oft Auslöser.
Welche sozialen Folgen hat die Erkrankung für die Individuen?
Es kommt meist zu einer Senkung der Arbeitsfähigkeit, Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse, Verlust persönlicher Kontakte und starken Schuldgefühlen gegenüber sich selbst und der Gesellschaft.
Wie erfolgt der Kontakt zum Verein?
Die Klienten treten in der Regel freiwillig an den Verein heran, wenn sie erkennen, dass sie mit dem Lebensdruck und der Ausgrenzung nicht mehr allein umgehen können.
- Citation du texte
- Melanie Johannsen (Auteur), 2007, Individualisierung und Vergesellschaftung am Beispiel der Brücke e.v., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203571