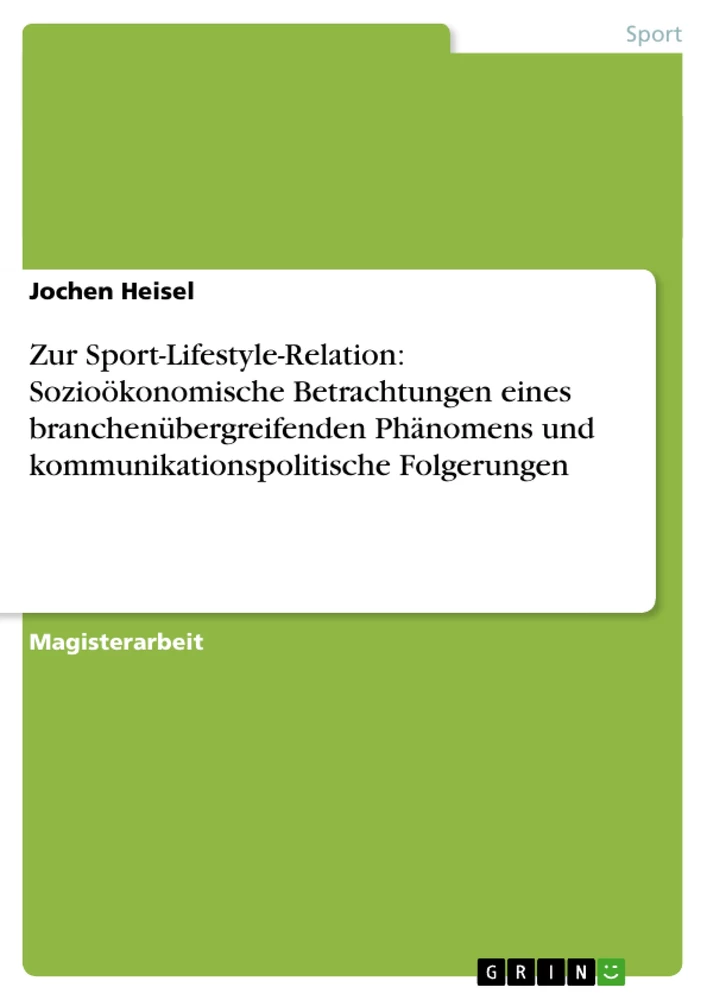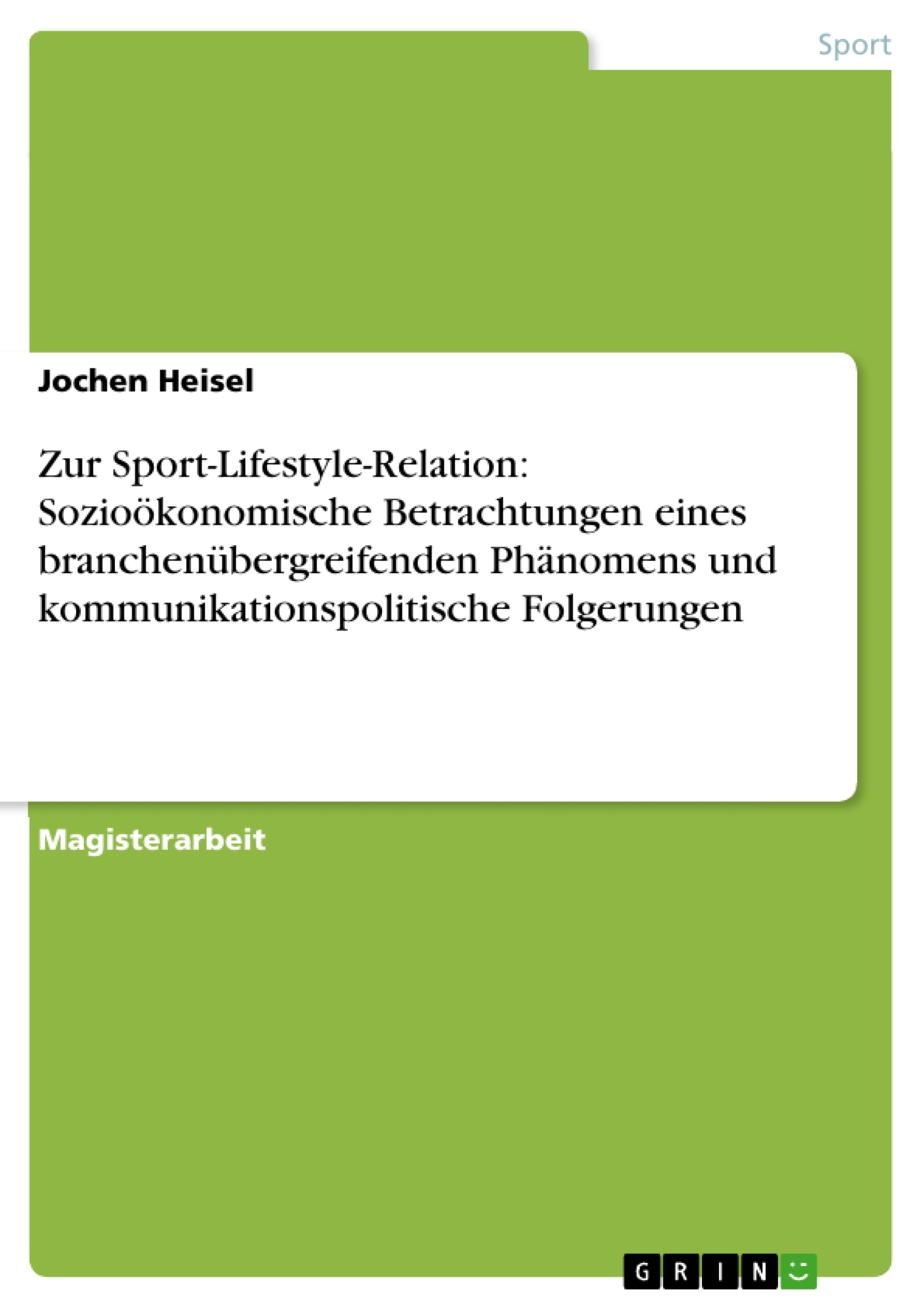Lifestyle boomt. Sobald man die Internetsuchmaschine Google mit dem populären englischen Schlagwort füttert, kommen unzählige Websites zum Vorschein, die sich um die verschiedenartigsten Themenkomplexe ranken. Angefangen bei Autozubehör, Computer oder Fitnessthemen, über Handyklingeltöne, Literatur und Mode bis hin zu Reisetipps, Wellness und Zen-Buddhismus etc., steht der perplexe Internetuser vor der Qual der Wahl. Gleiches ist bei einem Gang zum nächsten Kiosk zu erwarten. Nicht nur Lifestylemagazine mit so klangvollen Namen wie „Cosmopolitan“, „In Style“, „Matador“ oder „Fit for Fun“ konkurrieren um die Gunst der Leser, sondern auch nahezu alle Tageszeitungen locken mittlerweile mit eigenen Lifestyle-Rubriken und Lifestyle-Sonderbeilagen. Eines scheint allen Anbietern jedoch gemeinsam: Sie vermarkten und verkaufen Lifestyle.
Auch die Kommunikationsabteilungen von Wirtschaftsunternehmen aus der Sportbranche haben längst erkannt, dass Werbung keine Produkte mehr anpreist, sondern vielmehr konkurrierende Lifestyles. Nur so können Güter scheinbar den oft propagierten Mehr- und Erlebniswert erhalten, der den Konsumenten schließlich ansprechen und zum Kauf bewegen soll (vgl. MEINHOLD 2001, 8; SCHULZE 1997, 13). Ein Sportereignis dient schließlich längst nicht mehr nur der reinen Siegerermittlung und ein Turnschuh braucht heutzutage schon etwas mehr als eine rutschfeste Sohle. Technische Raffinessen werden mit angesagter Optik kombiniert und heraus kommt ein Produkt, das als vielversprechende Verbindung von Lifestyle, Sport und Technik vermarktet wird. Kreative unternehmerische Köpfe ersinnen ständig neue Wege, Lifestyle ökonomisch zu interpretieren und finden beispielsweise auch in Unternehmen anderer Branchen passende Kooperationspartner, die ihnen einen vermeintlichen Wettbewerbsvorteil ermöglichen.
Die Medien scheinen ebenfalls den Kapitalwert aus der Verbindung von Sport und Lifestyle entdeckt zu haben. Der Privatsender RTL platzierte und inszenierte im Sommer 2005 die Trendsportart Beachvolleyball mit buntem Rahmenprogramm als attraktives Entertainment. Radios, Zeitschriften und Zeitungen kommen – wie eingangs erwähnt - kaum noch ohne Lifestyle-Themenbereiche aus: We love to entertain you! (ProSieben) statt langweiliger Berichterstattung. [...]
Mit dem Begriff „Sport-Lifestyle“ hat sich inzwischen ein mehrdimensionales Phänomen etablieren können, sowohl in ökonomischer als auch in soziokultureller Hinsicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Konzeption
- 2. Lifestyle = Lebensstil?
- 2.1 Definition von Lebensstil
- 2.2 Definition von Lifestyle
- 2.2.1 Lifestylevarianten
- 2.2.2 Sport-Lifestyle
- 3. Sport und Lifestyle - eine Antwort auf die sich wandelnde Gesellschaft
- 3.1 Bedeutungszunahme der Freizeit
- 3.2 Veränderte Werteorientierung
- 3.3 Sport, der ideale „Lifestyle-Partner”
- 3.4 Schlussfolgerung
- 4. Analyse des Sport-Lifestyle-Marktes
- 4.1 Beschränkung auf den „profit sector”
- 4.2 Zielgruppenbetrachtungen
- 4.2.1 Sport-Lifestyle-Konsument als Erlebniskonsument
- 4.2.2 Jugendliche – eine wichtige Sport-Lifestyle-Zielgruppe
- 4.3 Der Einfluss kultureller Umgebungen auf den Sport-Lifestyle-Markt
- 4.4 Bereichs- und Anbieteranalyse
- 4.4.1 Sportartikelhersteller
- 4.4.2 Sport-Entertainment-Medien
- 4.4.3 Sportevent-Veranstalter
- 4.4.4 Trendsportanbieter
- 4.5 Schlussfolgerung
- 5. Einige Grundlagen zur Kommunikationspolitik
- 5.1 Kommunikationspolitik als Bestandteil des Marketingmix
- 5.2 Der Kommunikationsmix
- 5.2.1 Instrumente der Klassik
- 5.2.2 Below-The-Line-Instrumente
- 5.3 Integrierte Kommunikation und Corporate Identity
- 5.4 Kommunikationsinstrumente im Sport
- 6. Die Kommunikation von Sport-Lifestyle
- 6.1 Sport-Lifestyle heißt Erlebnis-Kommunikation!
- 6.2 Wie sollten die Kommunikationsmaßnahmen durchgeführt werden? Einige kommunikative Anforderungskriterien
- 6.2.1 Popkulturell vernetzend und Kooperationen nutzend
- 6.2.2 Alternativ und innovativ
- 6.2.3 Crossmedial und involvierend
- 6.2.4 Authentisch und aktuell
- 6.3 Zwischenfazit: Integrierte Kommunikation im Sinne von Sport-Lifestyle
- 6.4 Praxisbeispiele Sport-Lifestyleorientierter Kommunikation
- 6.4.1 Beispiel eines Sportartikelherstellers: Die „Puma Africa! Competition” -Kampagne
- 6.4.1.1 Analyse der kommunikativen Anforderungskriterien
- 6.4.1.2 Fazit
- 6.4.2 Beispiel eines Sportevent-Veranstalters: Der „Langnese Beach Soccer Cup”
- 6.4.2.1 Analyse der kommunikativen Anforderungskriterien
- 6.4.2.2 Fazit
- 6.4.3 Zusammenfassung der Beispiele
- 6.4.1 Beispiel eines Sportartikelherstellers: Die „Puma Africa! Competition” -Kampagne
- 6.5 Schlussfolgerung: Der entscheidende kommunikative Unterschied
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Beziehung zwischen Sport und Lifestyle, insbesondere unter sozioökonomischen Aspekten und den daraus resultierenden kommunikationspolitischen Implikationen. Das Ziel ist es, das Phänomen des Sport-Lifestyles branchenübergreifend zu analysieren und Handlungsempfehlungen für eine effektive Kommunikationsstrategie zu formulieren.
- Definition und Abgrenzung von Lebensstil und Lifestyle
- Analyse des Sport-Lifestyle-Marktes und seiner Zielgruppen
- Einfluss kultureller Umgebungen auf den Sport-Lifestyle-Markt
- Grundlagen der Kommunikationspolitik im Sport
- Entwicklung einer effektiven Kommunikationsstrategie für Sport-Lifestyle Produkte und Events
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sport-Lifestyle-Relation ein, beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Konzeption des Forschungsansatzes skizziert, der die sozioökonomischen Aspekte des Sport-Lifestyles und die daraus resultierenden kommunikationspolitischen Konsequenzen beleuchtet. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse dieses branchenübergreifenden Phänomens.
2. Lifestyle = Lebensstil?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung der Begriffe „Lebensstil“ und „Lifestyle“. Es werden verschiedene Lifestyle-Varianten vorgestellt und der Sport-Lifestyle als spezifische Ausprägung definiert. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten, um eine klare Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Die verschiedenen Definitionen werden kritisch hinterfragt und im Kontext des Sport-Lifestyles eingeordnet.
3. Sport und Lifestyle - eine Antwort auf die sich wandelnde Gesellschaft: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen dem wachsenden Sport-Lifestyle-Markt und gesellschaftlichen Veränderungen. Es analysiert die zunehmende Bedeutung von Freizeit, veränderte Werteorientierungen und die Rolle des Sports als idealer „Lifestyle-Partner“. Die Argumentation wird durch gesellschaftliche Trends und soziologische Beobachtungen gestützt, die die wachsende Nachfrage nach Sport-Lifestyle-Produkten und -Dienstleistungen erklären.
4. Analyse des Sport-Lifestyle-Marktes: Der Fokus liegt auf der Analyse des Sport-Lifestyle-Marktes, insbesondere im "profit sector". Es werden relevante Zielgruppen, wie der Erlebniskonsument und Jugendliche, betrachtet und der Einfluss kultureller Umgebungen beleuchtet. Eine detaillierte Bereichs- und Anbieteranalyse (Sportartikelhersteller, Sport-Entertainment-Medien, Sportevent-Veranstalter und Trendsportanbieter) gibt Einblick in die Marktstruktur und das Wettbewerbsumfeld. Der Einfluss von kulturellen Trends und Marken wird eingehend erläutert.
5. Einige Grundlagen zur Kommunikationspolitik: Dieses Kapitel stellt die relevanten Grundlagen der Kommunikationspolitik dar. Es beschreibt die Kommunikationspolitik als Bestandteil des Marketing-Mix, den Kommunikationsmix und die Bedeutung von integrierter Kommunikation und Corporate Identity. Der Abschnitt untersucht die Besonderheiten der Kommunikationsinstrumente im Sport und deren Anwendung im Kontext des Sport-Lifestyles.
6. Die Kommunikation von Sport-Lifestyle: Dieses Kapitel widmet sich der spezifischen Kommunikation von Sport-Lifestyle. Es betont die Erlebnisorientierung und formuliert Anforderungskriterien für erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen (popkulturelle Vernetzung, Innovation, Crossmedialität, Authentizität). Praxisbeispiele von Sportartikelherstellern und Sportevent-Veranstaltern veranschaulichen die theoretischen Konzepte und deren Umsetzung. Die Kapitel analysiert die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Kommunikation im Sport-Lifestyle Sektor.
Schlüsselwörter
Sport-Lifestyle, Lebensstil, Kommunikationspolitik, Marketing, Zielgruppenanalyse, Erlebniskonsum, Jugendliche, Sportartikelhersteller, Sportevent-Veranstalter, Markenkommunikation, sozioökonomische Faktoren, kulturelle Einflüsse, integrierte Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Sport-Lifestyle - Kommunikation im Wandel
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Sport und Lifestyle, insbesondere die sozioökonomischen Aspekte und die daraus resultierenden kommunikationspolitischen Implikationen. Sie analysiert das Phänomen des Sport-Lifestyles branchenübergreifend und entwickelt Handlungsempfehlungen für eine effektive Kommunikationsstrategie.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Lebensstil und Lifestyle, Analyse des Sport-Lifestyle-Marktes und seiner Zielgruppen (inkl. Erlebniskonsumenten und Jugendlichen), Einfluss kultureller Umgebungen auf den Markt, Grundlagen der Kommunikationspolitik im Sport, und die Entwicklung einer effektiven Kommunikationsstrategie für Sport-Lifestyle-Produkte und -Events.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung mit Problemstellung und Zielsetzung, ein Kapitel zur Definition von Lebensstil und Lifestyle, ein Kapitel zum Zusammenhang zwischen Sport-Lifestyle und gesellschaftlichen Veränderungen, eine Analyse des Sport-Lifestyle-Marktes (inkl. Anbieteranalyse), ein Kapitel zu den Grundlagen der Kommunikationspolitik und schließlich ein Kapitel zur spezifischen Kommunikation von Sport-Lifestyle mit Praxisbeispielen und Schlussfolgerungen.
Welche Zielgruppen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet insbesondere den Erlebniskonsumenten und Jugendliche als wichtige Zielgruppen im Sport-Lifestyle-Markt. Der Einfluss kultureller Umgebungen auf die Konsumpräferenzen dieser Zielgruppen wird ebenfalls analysiert.
Welche Anbieter werden im Markt analysiert?
Die Anbieteranalyse umfasst Sportartikelhersteller, Sport-Entertainment-Medien, Sportevent-Veranstalter und Trendsportanbieter. Es wird die Marktstruktur und das Wettbewerbsumfeld beleuchtet.
Welche Kommunikationsstrategien werden empfohlen?
Die Arbeit empfiehlt eine integrierte Kommunikationsstrategie, die popkulturell vernetzend, innovativ, crossmedial, involvierend und authentisch ist. Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Kommunikation im Sport-Lifestyle-Sektor werden detailliert diskutiert.
Welche Praxisbeispiele werden genannt?
Die Arbeit analysiert die Kommunikationskampagnen von einem Sportartikelhersteller (Puma Africa! Competition) und einem Sportevent-Veranstalter (Langnese Beach Soccer Cup) im Hinblick auf die formulierten Anforderungskriterien für eine erfolgreiche Sport-Lifestyle-Kommunikation.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Sport-Lifestyle, Lebensstil, Kommunikationspolitik, Marketing, Zielgruppenanalyse, Erlebniskonsum, Jugendliche, Sportartikelhersteller, Sportevent-Veranstalter, Markenkommunikation, sozioökonomische Faktoren, kulturelle Einflüsse und integrierte Kommunikation.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit hebt die Bedeutung einer ganzheitlichen und erlebnisorientierten Kommunikationsstrategie im Sport-Lifestyle-Bereich hervor und zeigt anhand von Praxisbeispielen auf, wie eine erfolgreiche Kommunikation aussehen kann. Der entscheidende kommunikative Unterschied wird auf die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe und die Integration verschiedener Kommunikationsinstrumente zurückgeführt.
Wo finde ich die vollständige Magisterarbeit?
Die Informationen in diesem FAQ basieren auf einer Zusammenfassung der Magisterarbeit. Der Zugriff auf die vollständige Arbeit ist abhängig von der Verfügbarkeit und den Zugangsrechten des jeweiligen Publikationsorts.
- Citar trabajo
- Jochen Heisel (Autor), 2006, Zur Sport-Lifestyle-Relation: Sozioökonomische Betrachtungen eines branchenübergreifenden Phänomens und kommunikationspolitische Folgerungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203594