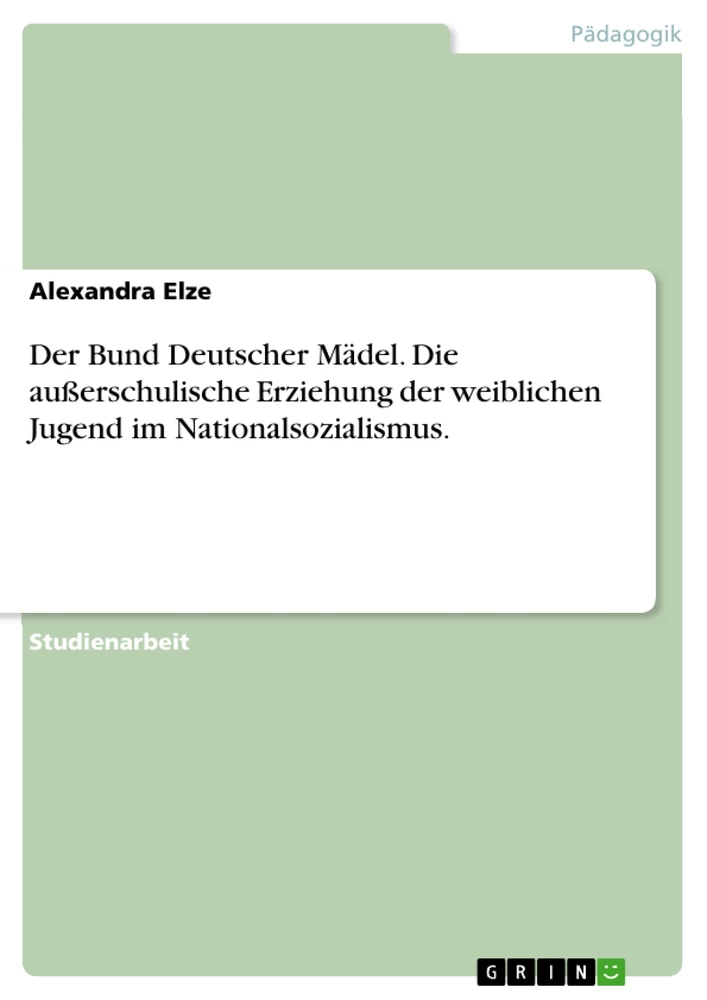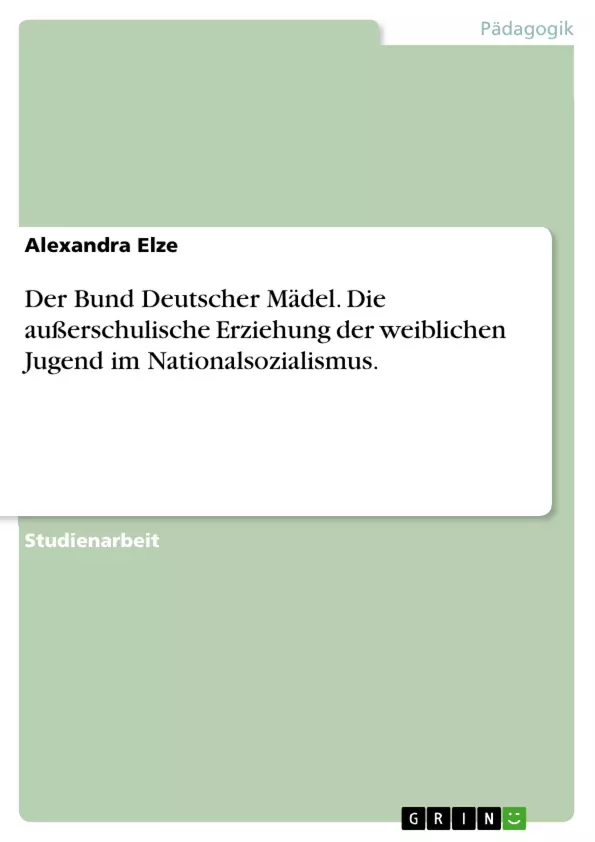1.Einleitung
2.Die Entstehung und Entwicklung des „Bundes deutscher Mädel“
3.Die Organisation der Institution für die weibliche Jugend im dritten Reich
3.1.) Gliederung und Gruppeneinteilung im BDM
3.2.) Die Führung des Mädelbundes
3.3.) Erziehungsinhalte der Mädchenarbeit
4.Weibliche Erziehungsleitbilder und -ideologien im Sinne Hitlers
4.1.) „Die künftige Mutter“
4.2.) Die ästhetische Manipulation im BDM
4.3.) Der Anti-Individualismus im Sozialgefüge des Mädelbundes
5.Fazit
In der vorliegenden Hausarbeit sollen die historischen Ursprünge des Bundes deutscher Mädel in der Hitlerjugend, deren Organisation hinsichtlich der Gliederung im Bund selbst, die Inhalte der
Mädchenarbeit im politisierten Alltag sowie die Lenkung und Führung der Formation aufgezeigt werden, um einen kleinen Einblick in das extrem durchstrukturierte Leben eines Mädel des Deutschen Bundes zu vermitteln. Das Hauptaugenmerk jedoch soll auf den diesen Prozessen zugrunde liegenden fanatischen Ideologien als Leitbilder der Erziehung liegen. Anhand ausgewählter markanter Grundsätze werden diese kritisch diskutiert, wobei die Wirkungskraft des propagierten Frauenbildes in diesem Kontext mehrmals mithilfe autobiographischer Belege aufgegriffen werden soll.
Die oft zitierte stolze Haltung der jungen Mädchen, dem Bund ein ehrenwertes und engagiertes Mitglied zu sein, wirft die Frage auf, inwiefern das Frauenbild der Nationalsozialisten, das der „künftigen Mutter“ und der „beistehenden Kameradin des Mannes“, den Mädeln näher gebracht werden konnte, ohne dass diese später eigenen, vom Regime und Mann unabhängigen Interessen und Neigungen nachgehen wollten. Diese besondere Form der Sozialisation musste sich demnach an einem intensiven Gemeinschaftsgefühl orientieren, welches die Grundlage bot, jegliche individuelle Bedürfnisse und eigenständige Entwicklungsorientierungen der Mädchen zu untergraben und paradoxerweise deren festen Glauben schüren, dass ohne sie als einzelnes Mitglied das System des gemeinschaftlichen Verbundes zusammenbrechen würde: War die getrenntgeschlechtliche Formationserziehung mit ihren propagierten „den Jungen ebenbürtigen“ sportlichen Leistungsanforderungen lediglich ein geschicktes Mittel zur Marionettierung der Mädchen, damit diese im von Männern geführten Krieg unterstützend „funktionierten“ und ihre eigentliche Zweitrangigkeit in der Geschlechterhierarchie gar nicht wahrnahmen?
Gliederung
1. Einleitung
2. Die Entstehung und Entwicklung des „Bundes deutscher Mädel“
3. Die Organisation der Institution für die weibliche Jugend im dritten Reich
3.1.) Gliederung und Gruppeneinteilung im BDM
3.2.) Die Führung des Mädelbundes
3.3.) Erziehungsinhalte der Mädchenarbeit
4. Weibliche Erziehungsleitbilder und -ideologien im Sinne Hitlers
4.1.) „Die künftige Mutter“
4.2.) Die ästhetische Manipulation im BDM
4.3.) Der Anti-Individualismus im Sozialgefüge des Mädelbundes
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was war der Bund Deutscher Mädel (BDM)?
Der BDM war die staatliche Organisation für Mädchen und junge Frauen im Nationalsozialismus und Teil der Hitlerjugend.
Welches Erziehungsideal verfolgte der BDM?
Das Ideal war die "künftige Mutter" und die "Kameradin des Mannes", die dem Regime ergeben war und ihre individuellen Bedürfnisse dem Gemeinschaftsgefüge unterordnete.
Was versteht man unter "ästhetischer Manipulation" im BDM?
Die Arbeit analysiert, wie durch Kleidung, Sport und Inszenierungen ein bestimmtes körperliches und ideologisches Erscheinungsbild erzwungen wurde.
Wie war der BDM organisiert?
Es gab eine strenge hierarchische Gliederung in Gruppen, Scharen und Ringe, um eine lückenlose Kontrolle und ideologische Schulung zu gewährleisten.
Diente der BDM der Gleichberechtigung?
Nein, sportliche Anforderungen, die denen der Jungen ähnelten, dienten laut Arbeit eher der "Marionettierung", um Mädchen für unterstützende Rollen im Krieg vorzubereiten.
- Quote paper
- Alexandra Elze (Author), 2010, Der Bund Deutscher Mädel. Die außerschulische Erziehung der weiblichen Jugend im Nationalsozialismus., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203644