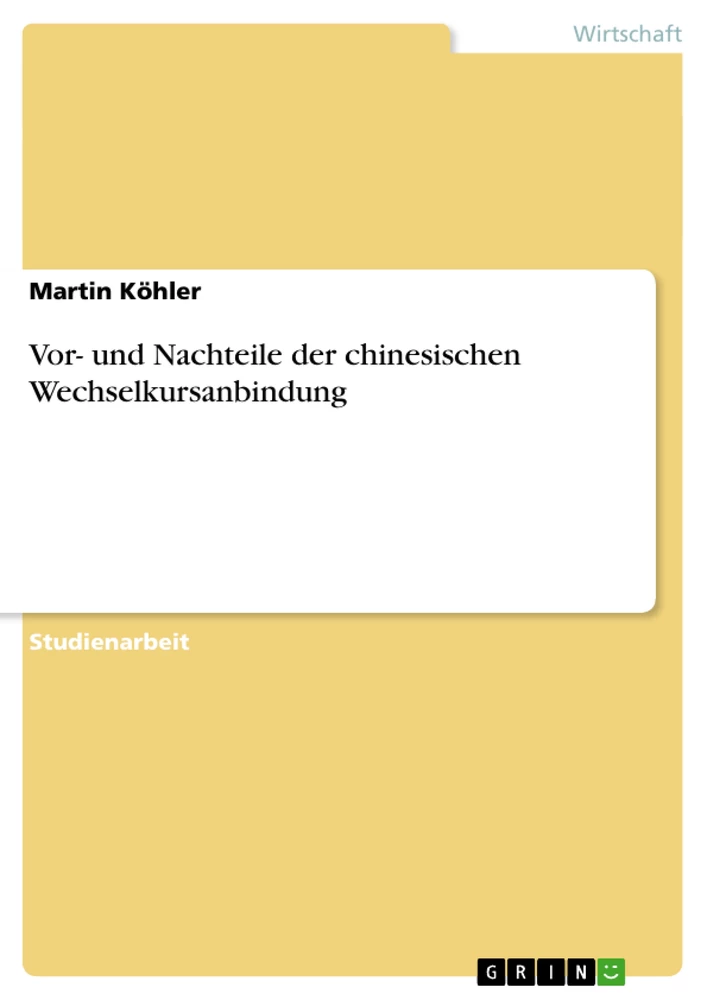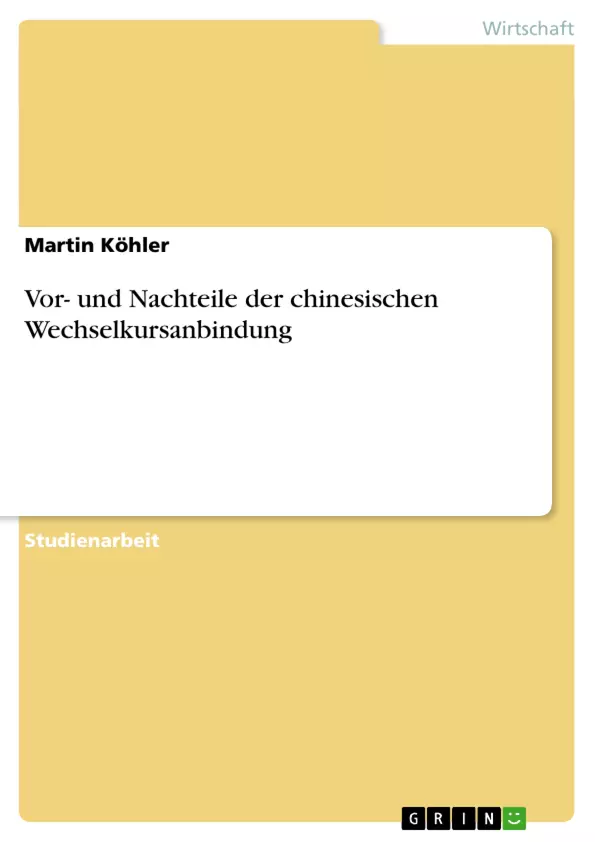In einem sind sich der amerikanische Notenbankchef Alan Greenspan und ehemalige EZBPräsident
Wim Duisenberg derzeit einig: Der Dollar muss abwerten. Nicht gegenüber dem
Euro, da ist schon genügend getan. Jetzt ist die chinesische Währung dran. Diese „Währung
des Volkes“, wie der Renminbi übersetzt heißt, soll endlich aufwerten. Seit 1994 wird sie faktisch
von der chinesischen Zentralbank in einem schmalen Band von 8,276 bis 8,28 Yuan zum
Dollar gehalten – und das auch durch turbulente Zeiten: während der asiatischen Finanzkrise
1998 hielt Peking dem Abwertungsdruck der Region stand und verhinderte damit die Ausweitung
der Abwärtsspirale. Dafür erntete China viel Lob aus dem Westen1. Zuletzt hat die People’s
Bank of China jedoch bis zu 600 Mio. Dollar täglich aufkaufen müssen, um das Verhältnis
der Währungen im angestrebten Band zu halten. Devisenmarktinterventionen in einer
derartigen Größenordnung gehen weit über das Maß hinaus, welches zur Glättung von täglichen
Kursschwankungen aufgewandt wird2. Ohne Zweifel würde das freie Walten der Märkte,
wie es der amerikanische Finanzminister Snow jüngst forderte, zu einer Aufwertung der
chinesischen Währung führen3.
Doch so bewertet der ehemalige EZB-Präsident die Wechselkurspolitik Chinas als eine der
größten Gefahren für die wirtschaftliche Erholung in Europa, EU-Kommissionschef Romano
Prodi sprach sogar schon von einer „neuen Welle des Protektionismus“. Das konstatierte
Problem besteht darin, dass der globale Devisenhandel zurzeit quasi „bipolarer Natur“ ist. Auf
der einen Seite steht der Dollar, in dessen Schlepptau sich die manipulierten Währungen Asiens
befinden, vom chinesischen Yuan über den japanischen Yen bis zum koreanischen Won.
Diese versuchen durch Interventionen, die eigene Währung billig zu machen und dadurch
Exportvorteile zu erlangen4. Die andere Seite dieser bipolaren Welt verkörpert der Euro, dessen
Kurs weitgehend dem Spiel der Marktkräfte überlassen wird. [...]
1 Financial Times Deutschland, 18.07.2003, „China lehnt Yuan-Aufwertung vorerst ab“
2 Damit sind allein im ersten Halbjahr 2003 die Währungsreserven der Bank um weitere 60 Mrd. Dollar auf 346
Mrd. Do llar gestiegen. DER SPIEGEL Nr. 35, 25.08.2003, 61
3Derzeitige Schätzungen bewegen sich zwischen 15 und 40%. DER SPIEGEL Nr. 35, 25.08.2003, 62
4 Financial Times Deutschland, 29.08.2003, „IWF kritisiert asiatische Devisenmanöver“
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Hauptteil
- 1. Die zwei währungspolitischen Grundmodelle
- 2. Vorteile des Flex- und Fixkurssystems
- 3. Die Ostasienkrise - Scheitern von Zwischenlösungen
- 4. Rückbesinnung auf die „two corner solutions“
- 4.1. Argentinien - Ecke der festen Wechselkurse
- 4.2. Osteuropa und Lateinamerika – Ecke der flexiblen Wechselkurse
- 5. Chinas Währungsoptionen aus der Sicht der Theorie optimaler Währungsräume
- 5.1. Arbeitsmobilität und Reallohnflexibilität
- 5.2. Größe und Offenheit der Volkswirtschaft
- 5.3. Der Diversifikationsgrad des Außenhandelssektors
- 6. Der Entwicklungsstand des nat. Finanzmarktes und die internat. Integration
- 6.1 Das chinesische Finanzsystem
- C Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob eine Abkehr vom Festkurssystem in der gegenwärtigen Situation für China sinnvoll wäre. Die zunehmende Integration Chinas in die Weltwirtschaft im Zuge des WTO-Beitritts stellt das Land vor die Herausforderung, eine geldpolitische Konzeption zu entwickeln, die sowohl interne als auch externe wirtschafts- und geldpolitische Stabilität ermöglicht.
- Vor- und Nachteile von festen und flexiblen Wechselkursen
- Analyse der Ostasienkrise als Beispiel für Fehlentwicklungen in Transformationsländern
- Bewertung der Auswirkungen von Kapitalverkehrskontrollen und Finanzsystemliberalisierung
- Chinas Währungsoptionen im Kontext der Theorie optimaler Währungsräume
- Der Entwicklungsstand des chinesischen Finanzsystems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um die chinesische Währungspolitik dar und führt die wichtigsten Argumente für und gegen eine Aufwertung des Yuan aus.
Das erste Kapitel erläutert die beiden grundlegenden währungspolitischen Modelle: das Festkurssystem und das Flexkurssystem. Dabei werden die zentralen Steuerungsgrößen, die kurzfristigen Zinsen und der Wechselkurs, betrachtet.
Das zweite Kapitel geht detailliert auf die Vor- und Nachteile beider Systeme ein, wobei insbesondere die Themen Spekulation, Volatilität, internationale Integration, Geldpolitische Disziplin und Allokationseffizienz beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der internationalen Wirtschaftspolitik und insbesondere der Währungspolitik, wobei der Fokus auf dem chinesischen Yuan und dessen Einfluss auf die globale Wirtschaft liegt. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Festkurssystem, Flexkurssystem, Währungspolitik, Kapitalverkehrskontrollen, Finanzsystemliberalisierung, Ostasienkrise, WTO, Theorie optimaler Währungsräume, internationales Finanzsystem, chinesische Wirtschaft.
- Quote paper
- Martin Köhler (Author), 2003, Vor- und Nachteile der chinesischen Wechselkursanbindung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20366