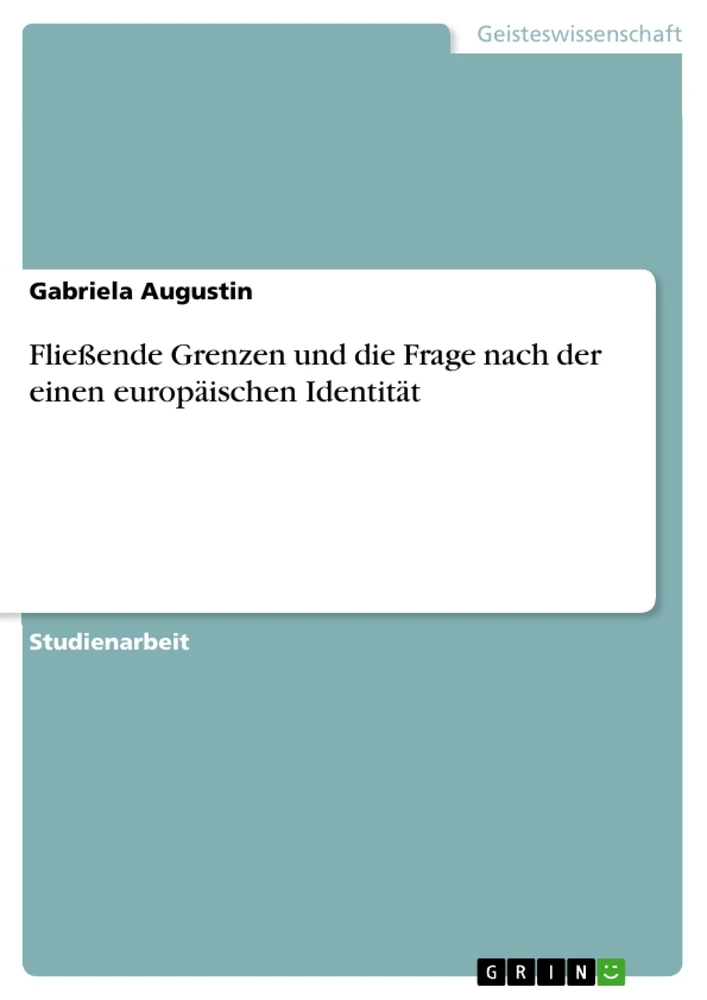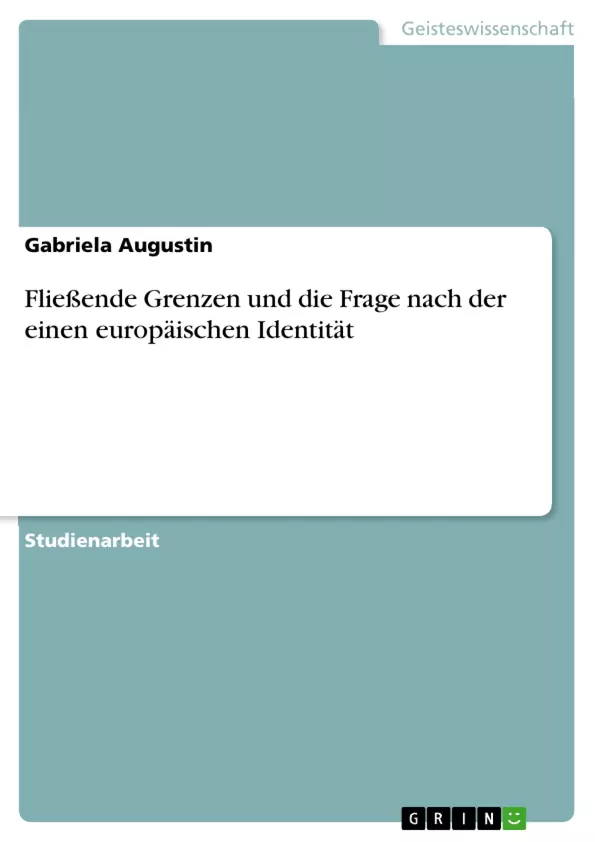Die japanische Autorin Yoko Tawada beschäftigt sich in ihrem Essay "Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht" intensiv mit dem Thema „Europa“ samt existierender Probleme hinsichtlich Integration, unterschiedlicher Nationalitäten mit jeweils eigenen Traditionen und Wertevorstellungen, Unsicherheit und Problemen; kurz: Mit der nicht enden wollenden Suche nach (einer europäischen) Identität.
Hieraus folgt die Analyse einer Auswahl kultureller sowie sozialer Probleme Europas, die aus der nicht optimal verlaufenen Entstehungsgeschichte Europas und der Europäischen Union resultieren. Im Fokus stehen kulturelle und soziale Schwierigkeiten wie auch die Konsequenzen für Europa als eine Vereinigung von 27 Staaten.
Ein denkbarer Lösungsansatz für dieses Dilemma wird abschließend im Ansatz skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europa als Illusion
- Yoko Tawadas Auffassung von Europa
- Sprache als Identifikationsmittel?
- Fließende Grenzen
- Europa – Das große Gegenprojekt zu den USA
- Kleine Geschichte der EU
- Homogenität bleibt Illusion
- In varietate concordia funktioniert nicht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kulturellen und sozialen Schwierigkeiten der Europäischen Union sowie die Konsequenzen für Europa als eine Vereinigung von 27 Staaten. Die Fokus liegt auf der nicht enden wollenden Suche nach einer europäischen Identität, insbesondere im Kontext von Yoko Tawadas Essay „Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht".
- Die Problematik der europäischen Identität und die Rolle von Sprache
- Kritik an der Idee von Europa als homogenes Konstrukt
- Die Bedeutung von Kultur und Tradition in der europäischen Integration
- Die Grenzen der europäischen Identität im Kontext von kultureller Vielfalt
- Die Rolle von Yoko Tawadas Werk in der Analyse europäischer Identitätsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung präsentiert die aktuelle Situation Europas, geprägt von Schuldenkrisen, Finanzierungsprojekten, Debatten um eine gemeinsame Verfassung und Zuwanderungswellen. Die Arbeit konzentriert sich auf die kulturellen und sozialen Schwierigkeiten, die aus der Vereinigung von 27 unterschiedlichen Nationalitäten entstehen.
2. Europa als Illusion
2.1. Yoko Tawadas Auffassung von Europa
Yoko Tawadas Essay „Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht“ stellt Europa als ein männliches und ein weibliches Individuum dar, was bereits von Beginn an ein Gefühl von Künstlichkeit und Fiktion erzeugt. Die Kritik an Fremdem und Anderen wird als Schutzmechanismus der westlichen Gesellschaft interpretiert, während Europa als eine Verlust-Figur dargestellt wird, die von der männlichen Figur, die den griechischen Gott Zeus repräsentiert, entführt und vergewaltigt wird.
2.2. Sprache als Identifikationsmittel?
Die Tatsache, dass Tawada Deutsch, eine fremde Sprache, für ihre Beschreibungen wählt, führt zu Schwierigkeiten, Sachverhalte objektiv darzustellen. Die deutsche Sprache spiegelt das Thema „Fremde“ bereits auf der Mikroebene des Erzählens wider. Die Autorin verwendet biologische Termini wie „Membran“ und „Osmose“, um den Prozess der Einverleibung des Fremden in das Eigene zu beschreiben.
3. Europa – Das große Gegenprojekt zu den USA
Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung nicht behandelt, um Spoiler zu vermeiden.
4. Fazit
Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung nicht behandelt, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen europäische Identität, kulturelle Vielfalt, Integration, Sprache als Identifikationsmittel, Yoko Tawadas Essay „Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht“, Kritik, Homogenität, Fließende Grenzen, Osmose, Membran, und die Grenzen der europäischen Integration.
- Citar trabajo
- Gabriela Augustin (Autor), 2011, Fließende Grenzen und die Frage nach der einen europäischen Identität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203921