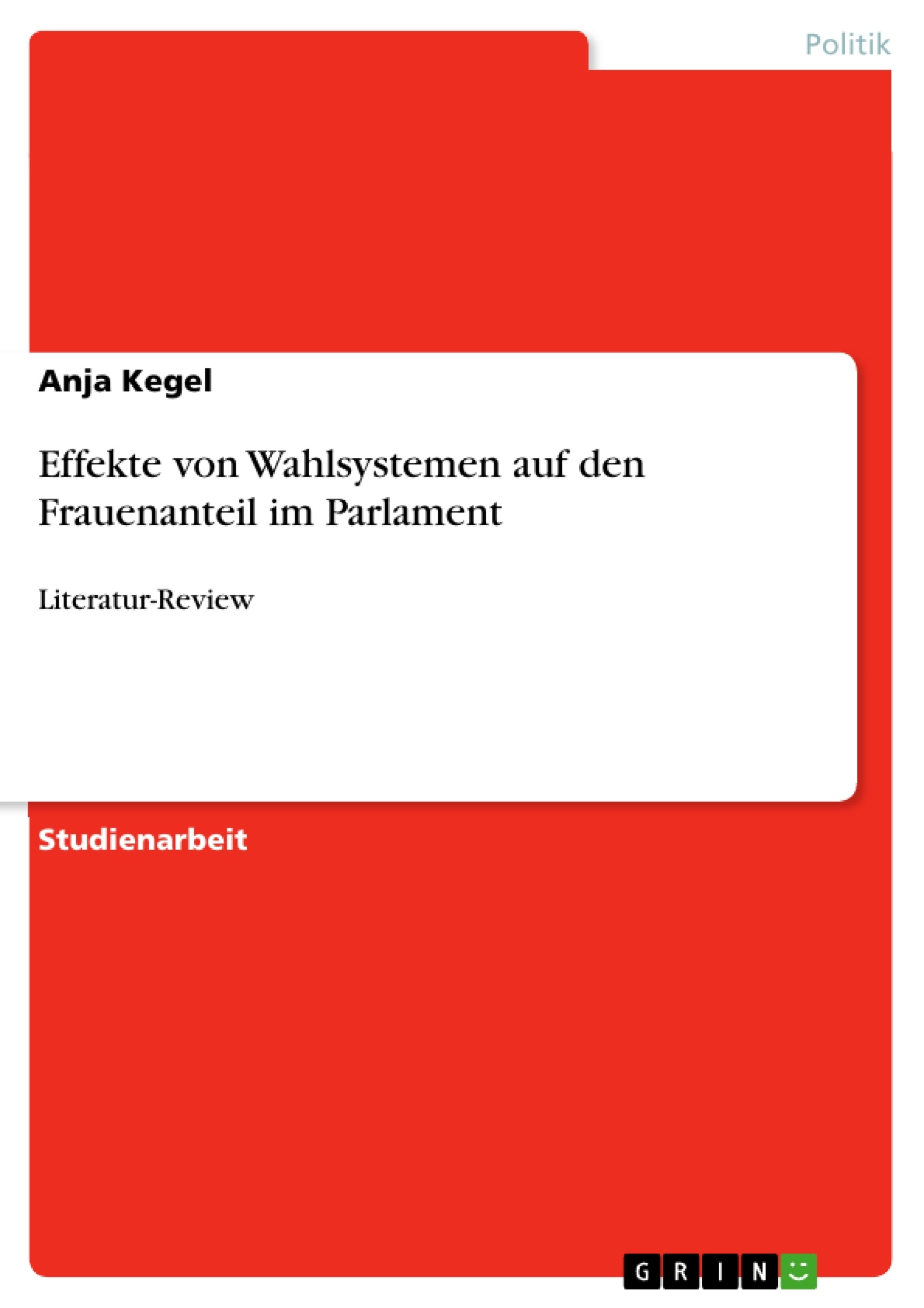Seitdem Maurice Duverger in seinem Bericht: „The Political Role of Women“, in welchem er sich auf die empirischen Ergebnisse einer Erhebung des damaligen Social Science Department der UNESCO für die beiden Jahre 1952 und 1953 stützte und diese kritisch hinterfragte, auf die geringe Anzahl an Frauen als Kandidatinnen bei Wahlen, im Parlament, in Ministerien sowie in politischen Führungspositionen aufmerksam machte (Duverger 1955: 123), gab es zahlreiche Studien und Analysen, in denen Politikwissenschaftler sowie Politikwissenschaftlerinnen erklären wollten, worin die Ursachen für den geringen Frauenanteil in Parlamenten liegen und inwiefern die unter-schiedlichen Wahlsystemtypen die Repräsentation von Frauen beeinflussen.
Insgesamt wird die Inklusion als einer der grundlegenden Werte von Demokratie verstanden (Habermas 1996; Young 2000), während die Inklusion von Frauen ins Parlament eine Dimension der gesellschaftlichen Vielfalt beinhaltet (vgl. Norris 2006: 198). Der Politikwissenschaftlerin Iris Marion Young zufolge kann Inklusion als ein grundlegender Wert von demokratischen Institutionen dahingehend erklärt werden, dass sie die Legitimität von denselben erhöht (vgl. Young 2000: 5f.). Denn je mehr Perspektiven in den politischen Entscheidungsprozess miteinfließen – „Input-Legitimität“ –, desto mehr können auch die demokratischen Ergebnisse verbessert werden – „Output-Legitimität“ (vgl. Dovi 2009: 1175).
Die normative Idee, welche dem Argument der Inklusion zugrunde liegt, ist die Annahme, dass die Zusammensetzung des Parlaments die Gesellschaft widerspiegelt, welche sie im politischen Entscheidungsprozess repräsentiert (vgl. Norris 2006: 198). Demnach geht es normativ bei der Umwandlung von Wählerstimmen in Mandate da-rum, die wahlpolitisch bedeutsamen Konfliktlinien abzubilden. Auf diese Weise treffen gewählte Institutionen auf das Kriterium „deskriptive Repräsentation“, ein Begriff der von der Politikwissenschaftlerin Hanna F. Pitkin (1967) stammt (vgl. Norris 2006: 198).
Die Dimension der Inklusion begreift demokratische Repräsentation in erster Linie als einen Prozess, bei dem die demokratischen Bürger (oder zumindest ihre Stimmen, Interessen und Ansichten) im politischen Entscheidungsprozess durch die gewählten Repräsentanten vertreten werden (vgl. Dovi 2009: 1172).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die normativen Ursprünge der Inklusion von Frauen im Parlament
- Effekte von Wahlsystemen auf den Frauenanteil im Parlament
- Überblick über den aktuellen Forschungs- und Literaturstand
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu den Effekten von Wahlsystemen auf den Anteil von Frauen im Parlament zu geben. Sie soll als ein „State of Art Report“ dienen, der verschiedene Ansätze und Argumente, methodische Vorgehensweisen, Ergebnisse und umstrittene Themen beleuchtet.
- Normative Ursprünge der Inklusion von Frauen im Parlament
- Einfluss von Wahlsystemen auf die Repräsentation von Frauen
- Zusammenhang zwischen Inklusion und demokratischer Legitimität
- Geschlechtsspezifische Demokratiedefizite und die Rolle von Frauen in politischen Ämtern
- Politische Partizipation von Frauen und die Bedeutung von Wahlsystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die normativen Ursprünge der Inklusion von Frauen im Parlament und stellt den Zusammenhang zwischen Inklusion und demokratischer Legitimität her. Sie diskutiert die Bedeutung der repräsentativen Demokratie und die Notwendigkeit, unterrepräsentierte soziale Gruppen, insbesondere Frauen, in politischen Entscheidungsprozessen einzubeziehen. Darüber hinaus wird der historische Kontext der weiblichen Partizipation in politischen Ämtern beleuchtet und der Forschungsstand zu den Ursachen der Unterrepräsentation von Frauen zusammengefasst.
Effekte von Wahlsystemen auf den Frauenanteil im Parlament
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu den Auswirkungen von Wahlsystemen auf den Anteil von Frauen im Parlament. Er befasst sich mit verschiedenen Ansätzen und Argumenten, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden, sowie mit den methodischen Vorgehensweisen, die zur Analyse dieser Zusammenhänge eingesetzt werden. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und die Erörterung von umstrittenen Themen und noch ungeklärten Fragen runden den Überblick ab.
Schlüsselwörter
Wahlsysteme, Frauenanteil im Parlament, Repräsentation, Inklusion, Demokratie, Geschlechtergleichstellung, Politische Partizipation, Forschung, Literaturstand, empirische Studien, methodische Ansätze, umstrittene Themen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben Wahlsysteme auf den Frauenanteil im Parlament?
Die Forschung zeigt, dass Wahlsysteme (z.B. Verhältniswahl vs. Mehrheitswahl) die Chancen von Frauen auf ein Mandat erheblich beeinflussen können, wobei Verhältniswahlsysteme oft höhere Frauenanteile begünstigen.
Was bedeutet „deskriptive Repräsentation“?
Dieser Begriff von Hanna F. Pitkin besagt, dass ein Parlament die Zusammensetzung der Gesellschaft (z.B. hinsichtlich des Geschlechts) widerspiegeln sollte.
Warum ist die Inklusion von Frauen für die Demokratie wichtig?
Inklusion erhöht die Legitimität demokratischer Institutionen. Mehr Perspektiven im Entscheidungsprozess verbessern laut Theorie sowohl die „Input-“ als auch die „Output-Legitimität“.
Wer leistete Pionierarbeit in der Erforschung von Frauen in der Politik?
Maurice Duverger machte bereits 1955 in seinem Bericht „The Political Role of Women“ auf die geringe Anzahl von Frauen in Führungspositionen aufmerksam.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Wahlsystemen und Legitimität?
Ja, wenn Wahlsysteme bestimmte Gruppen systematisch unterrepräsentieren, kann dies als geschlechtsspezifisches Demokratiedefizit wahrgenommen werden, was die Akzeptanz politischer Ergebnisse schwächt.
Was ist ein „State of Art Report“?
Es handelt sich um einen Bericht, der den aktuellen Forschungs- und Literaturstand zu einem Thema zusammenfasst, um methodische Ansätze und ungeklärte Fragen aufzuzeigen.
- Citation du texte
- M.A. Politikwissenschaft Anja Kegel (Auteur), 2012, Effekte von Wahlsystemen auf den Frauenanteil im Parlament, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204063