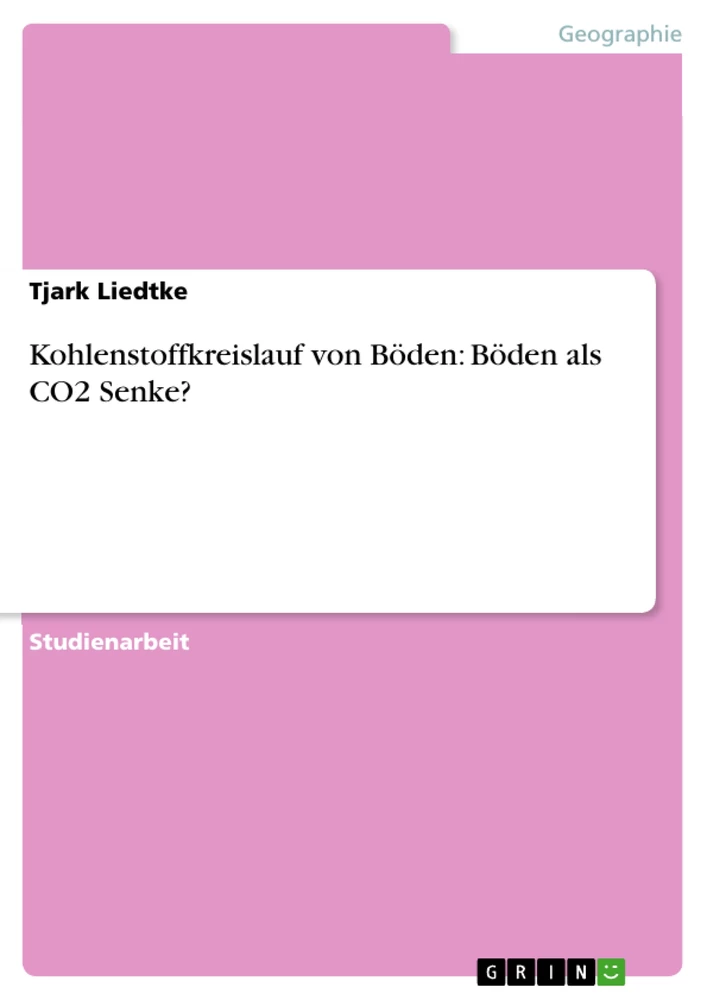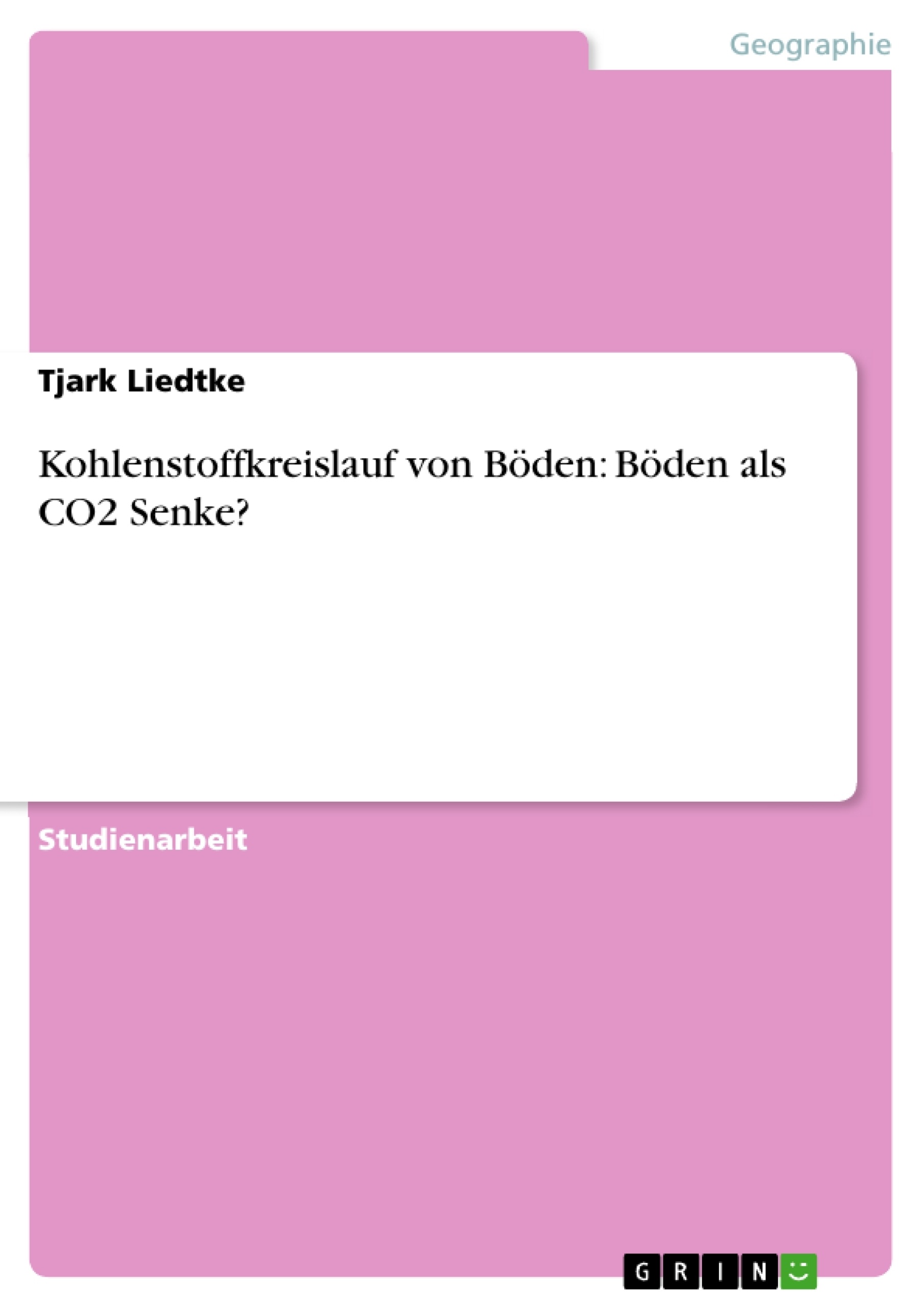Vor dem Hintergrund stetig steigender anthropogener Kohlenstoffdioxid-Emissionen (Atmosphärische Konzentration stieg im vergangenen Jahrhundert um etwa 30% an) und somit einer Verstärkung des Treibhauseffektes, der zu einem globalen Temperaturanstieg führt, stellen sich Herausforderungen dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.
Das Kyoto-Protokoll formuliert in diesem Zusammenhang, neben der Absicht den Ausstoß von CO2 signifikant zu verringern, ebenfalls die Maxime atmosphärischen Kohlenstoff in Landökosystemen zu binden (Hagedorn, S. 94).
Vorwort
Vor dem Hintergrund stetig steigender anthropogener Kohlenstoffdioxid-Emissionen (Atmosphärische Konzentration stieg im vergangenen Jahrhundert um etwa 30% an) und somit einer Verstärkung des Treibhauseffektes, der zu einem globalen Temperaturanstieg führt, stellen sich Herausforderungen dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Das Kyoto-Protokoll formuliert in diesem Zusammenhang, neben der Absicht den Ausstoß von CO2 signifikant zu verringern, ebenfalls die Maxime atmosphärischen Kohlenstoff in Landökosystemen zu binden (Hagedorn, S. 94).
Der Kohlenstoffkreislauf von Böden
Die terrestrischen Böden speichern etwa 80% der direkt am aktiven Kohlenstoffkreislauf teilnehmenden Kohlenstoffvorräte, wohingegen die Vegetation lediglich 20% speichert. Die Gesamtmenge des in Böden gespeicherten Kohlenstoffs beläuft sich auf etwa 1600 Gt und ist damit in etwa doppelt so hoch, wie der gesamte in der Atmosphäre befindliche Kohlenstoff (Scheffer & Schachtschabel 2002, S. 62).
Organismen wie zum Beispiel Pflanzen assimilieren Kohlenstoff, betreiben Photosynthese und wandeln somit anorganisches CO2 in organische Stoffe um. Nach Absterben der Pflanzen, gelangt die organische Masse, die u.a. aus Proteinen, Cellulose und weiteren Polysacchariden besteht als Streu auf den Boden. Dort beginnt die Zerlegung der organischen Stoffe durch die Primärzersetzer (Pilze, Regenwürmer etc.), deren Ausscheidungen wiederum von z.B. Milben (Sekundärzersetzer) umgesetzt werden. Bei beiden Mineralisierungsprozessen, also der Umwandlung organischer Materie zu anorganischen Stoffen, wird unter aeroben Bedingungen Kohlenstoff frei und gelangt zurück in die Atmosphäre. Dieser Prozess wird als heterotrophe Atmung bezeichnet.Von großer Bedeutung für einen etwaigen Verbleib von Kohlenstoff in den Böden sind unterschiedliche Faktoren. So gehen feine Korngrößen wie Schluff oder Ton Bindungen mit Proteinen und Polysacchariden ein, sodass sie gegen weiteren Abbau stabilisiert werden. Weiterhin ist die Mineralisierung von z.B. Lignin, einem Zucker der essentieller Bestandteil von pflanzlichen Zellwänden ist, nur unter aeroben Bedingungen möglich. Besteht Sauerstoffmangel wie z.B. in Mooren, kommt es zu Sedimentation und unter Umständen zu Torf- bzw. Kohlebildung (Scheffer & Schachtschabel 2002, S. 51ff).
Böden als CO2 Senke?
Um die Potenziale von verschiedenen Bodentypen zur Sequestrierung von Kohlenstoff analysieren zu können und auf Grund dieser Ergebnisse Handlungsmuster abzuleiten, sind in Deutschland Kohlenstoffinventare mit Hilfe unterschiedlicher Messmethoden bestimmt worden. Eines davon ist das sog. B Ü K200-Inventar. Laut einer Schätzung ließen sich für das Land Baden-Württemberg durch die sog. no-till agriculture, also einer Form der Landwirtschaft, bei der Boden nicht gepflügt wird, die durch die Landwirtschaft entstandenen Treibhausgasemissionen um 5-14% reduzieren (Neufeldt 2004, S. 202).
Eine weitere Treibhaus Mitigationsmaßnahme stellt die Renaturierung von Moorlandschaften oder Feuchtgebieten dar, da die hier gespeicherten Kohlenstoffvorräte (Soil organic carbon) pro Fläche Boden äußerst hoch sind (trotz hoher Varianzen), sowohl oberflächennah und insbesondere in tieferen Bodenschichten (vgl. Abb.1). Allerdings sind die Moorflächen mit nur 308 km2 oder etwa 1,64 % der Gesamtfläche relativ unbedeutend, sodass der Effekt von C-Sequestrierung eher als gering einzuschätzen ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Landflächen mit jeweiligen C-Vorräten in 0-0,3m und 0- 1m Tiefe. Quelle: Neufeldt 2004, S. 207.
Hierzu ist allerdings zu sagen, dass die Potenziale durch die oben beschriebenen Maßnahmen jedoch von verschiedenen Autoren unterschiedlich eingeschätzt und beziffert werden. So kommt der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) zu Werten, die teilweise doppelt so hoch sind, wie die Werte anderer Autoren (Neufeldt 2004, S. 209).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Können Böden als CO2-Senke fungieren?
Ja, terrestrische Böden speichern etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie die gesamte Atmosphäre und können durch gezielte Bewirtschaftung CO2 binden.
Was ist "no-till agriculture"?
Es handelt sich um eine Form der Landwirtschaft, bei der auf das Pflügen verzichtet wird, um den Kohlenstoffabbau im Boden zu verlangsamen.
Welche Rolle spielen Moore im Kohlenstoffkreislauf?
Moore speichern pro Fläche extrem viel organischen Kohlenstoff; ihre Renaturierung ist daher eine effektive Klimaschutzmaßnahme.
Was passiert bei der heterotrophen Atmung?
Organische Materie wird durch Mikroorganismen zu anorganischen Stoffen mineralisiert, wobei CO2 zurück in die Atmosphäre gelangt.
Wie viel Kohlenstoff ist in Böden weltweit gespeichert?
Die Gesamtmenge wird auf etwa 1600 Gigatonnen (Gt) geschätzt.
- Citation du texte
- Tjark Liedtke (Auteur), 2012, Kohlenstoffkreislauf von Böden: Böden als CO2 Senke?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204076