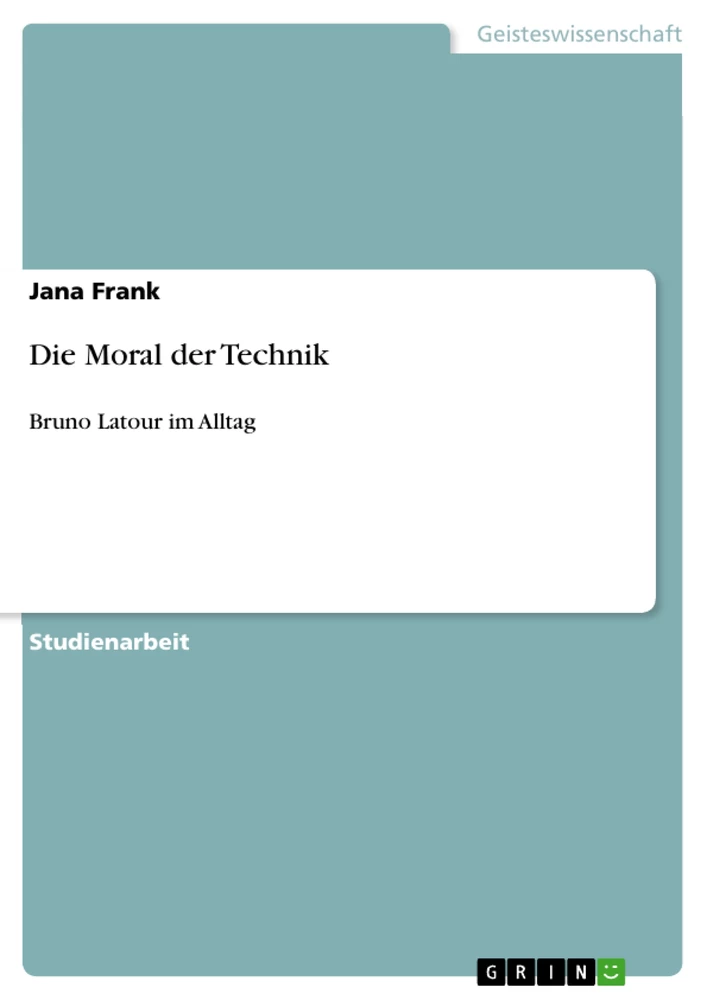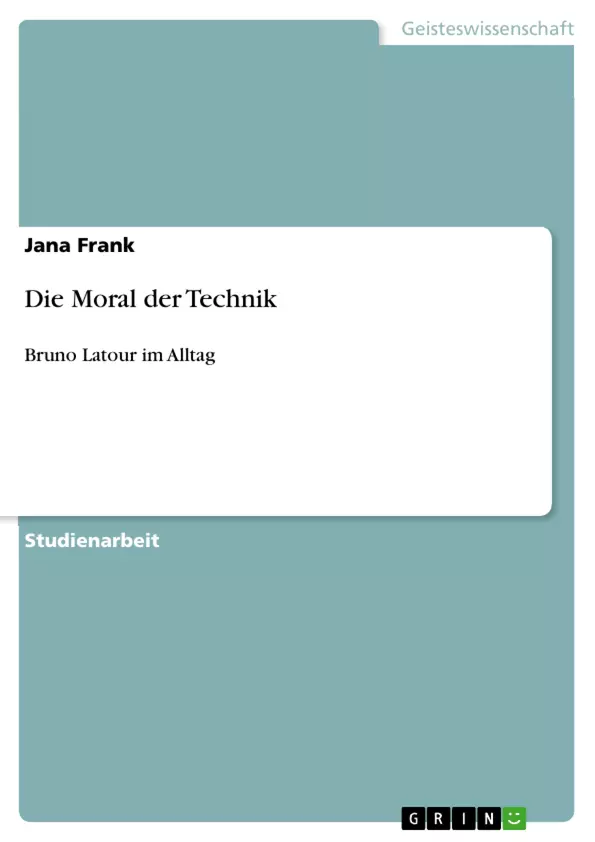(...) Diese Arbeit möchte die Argumentation von Bruno Latour bezüglich der Beschaffenheit von Alltagsobjekten aufgreifen und auf ein aktuelles Beispiel anwenden. Dabei versuchen wir folgende Fragestellungen zu beantworten: Wie begründet er das Verhältnis von Menschen und Technik? Welche besondere Bedeutung und welchen Einfluss hat Technik in Hinblick auf das soziale Handeln?
Dazu werden wir zunächst die wichtigsten Begriffe für die Analyse unseres Beispiels des eingesperrten Einkaufwagens erläutern. Im Anschluss versuchen wir die Theorie auf ein Praxisbeispiel anzuwenden. Wir wollen zeigen wie unnachgiebig die Moral der Technik ist und welche Konsequenzen sich daraus für die Handlung ergeben. Im Anschluss versuchen wir das Menschenbild Bruno Latours und die Rolle der Technik in diesem Verhältnis zu skizzieren. Im Fazit resümieren wir die Betrachtungen und wägen diese gegeneinander ab. (...)
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Begriffe für die Analyse
2.1. Akteur / Aktant
2.2. Programm – Gegenprogramm
2.3. Inskription
2.4. Übersetzung
3. Der eingesperrte Einkaufswagen
4. Abschließende Betrachtung
4.1. Bild der Gesellschaft und die Rolle der Technik
4.2. Fazit
5. Literatur
Häufig gestellte Fragen
Welche Theorie von Bruno Latour wird in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Latours Argumentation zur „Moral der Technik“ und der Beschaffenheit von Alltagsobjekten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Akteur und einem Aktanten?
In Latours Theorie können auch nicht-menschliche Wesen (Aktanten), wie technische Objekte, Handlungen beeinflussen und steuern.
Was verdeutlicht das Beispiel des „eingesperrten Einkaufswagens“?
Es zeigt, wie Technik durch ihre Gestaltung (z.B. Pfandsystem) ein bestimmtes soziales Handeln erzwingt und somit eine eigene „Moral“ besitzt.
Was versteht man unter „Inskription“ in diesem Kontext?
Inskription bezeichnet das Einschreiben von Verhaltensregeln oder Programmen direkt in die Gestaltung technischer Objekte.
Welches Menschenbild skizziert Bruno Latour?
Latour sieht den Menschen nicht isoliert, sondern in einem ständigen Wechselverhältnis mit der Technik, die sein Handeln mitbestimmt.
- Arbeit zitieren
- Jana Frank (Autor:in), 2009, Die Moral der Technik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204096