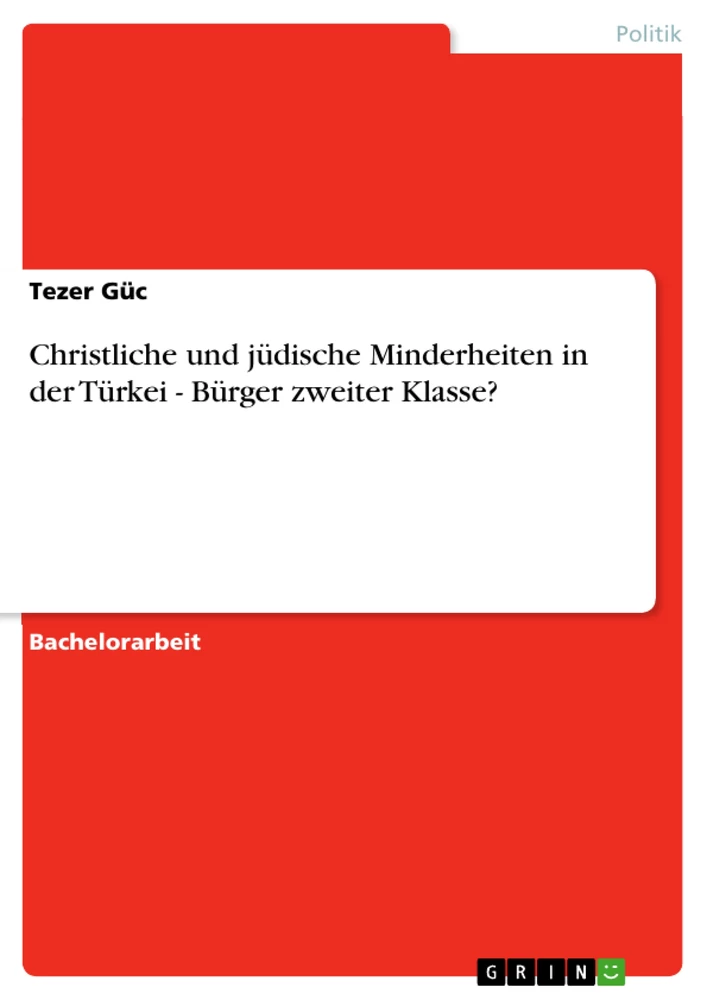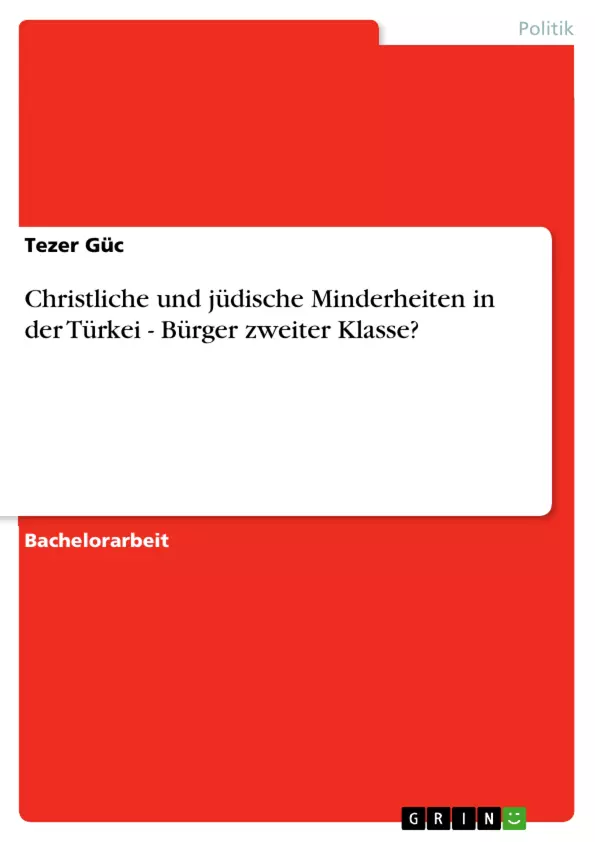Die Türkei ist seit Jahrhunderten die Heimat verschiedener Ethnien, Religionen und Kulturen. Bis dato beherbergte sie nicht nur verschiedene Turkvölker sondern etwa auch Kurden, Armenier und Griechen. Neben der vornehmlich dem sunnitischen Islam zuzurechnenden Bevölkerung, bilden die Alewiten die zweitgrößte Religionsgemeinschaft. In der sehr heterogenen Gesellschaft finden sich überdies Jesuiten, Schiiten, Drusen, Bahai, Juden und Christen , um nur einige zu nennen.
Von den zahlreichen in der Türkei ansässigen Minderheiten werden jedoch lediglich die zwei größten nicht-muslimischen Religionsgemeinschaften als solche anerkannt – die jüdische und die christliche, wobei letztere sowohl die griechisch-orthodoxe als auch die armenische Gemeinde umfasst. Zurückführen lässt sich dies auf das historisch begründete türkische Minderheiten- und Selbstverständnis. Für die anerkannten wie auch für die nicht anerkannten Minderheiten birgt dies vielfältige administrative, rechtliche und soziale Probleme.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Thema und Fragestellung
- 1.1.1. Strukturierung der Arbeit
- 1.1.2. Quellenkritik
- 2. Definition der Minderheiten
- 2.1. Politisch-soziologischer Definition
- 2.2. In der internationalen Politik
- 3. Türkisches Minderheitenverständnis seit der Gründung der Republik Türkei
- 3.1. Der Minderheiten im Osmanischem Reich und das Millet-System
- 3.1.1. Minderheiten im Lausanner Vertrag
- 3.1.2. Türkisches Minderheitenverständnis
- 3.1.3. Nationalismus- und Laizismusprinzip und deren Auswirkungen auf die Minderheiten
- 4. Religionsfreiheit der muslimischen Religionsgemeinschaften
- 4.1 Das Präsidium für Religionsangelegenheiten
- 4.1.1. Die muslimischen Ordensgemeinden
- 4.1.2. Der Militärputsch 1980 und die TIS
- 5. Anerkannte/ nicht-anerkannte nicht-muslimischen Minderheiten in der Türkei
- 5.1. Administrative Probleme
- 5.1.1. Das Wahlgremium
- 5.1.2. Die Stiftungen
- 5.1.3. Die Schulen
- 5.1.4. Die Berufe
- 5.1.5. Sonderfall: Die Katholische Kirche
- 5.2. Gesellschaftliche Probleme
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang der Türkei mit christlichen und jüdischen Minderheiten. Ziel ist es, die Auswirkungen der türkischen Staatsideologie auf diese Gruppen zu analysieren und zu ergründen, ob sie als Bürger zweiter Klasse gelten. Die Arbeit beleuchtet die historischen und aktuellen Herausforderungen, denen diese Minderheiten gegenüberstehen.
- Definition und historische Entwicklung des Minderheitenbegriffs in der Türkei
- Das türkische Minderheitenverständnis im Kontext von Nationalismus und Laizismus
- Religionsfreiheit und die Rolle des Präsidiums für Religionsangelegenheiten
- Administrative und gesellschaftliche Probleme nicht-muslimischer Minderheiten
- Die Frage der Diskriminierung und der Status als Bürger zweiter Klasse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor: die Situation christlicher und jüdischer Minderheiten in der Türkei und die Frage nach ihrem Status als Bürger zweiter Klasse. Sie beschreibt die ethnische und religiöse Vielfalt der Türkei und hebt hervor, dass nur die größten nicht-muslimischen Gemeinschaften (jüdische und christliche) offiziell anerkannt sind. Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit, wobei die historische Entwicklung des Minderheitenverständnisses und die Herausforderungen für die betroffenen Gruppen im Fokus stehen.
2. Definition der Minderheiten: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Minderheit“, sowohl aus politisch-soziologischer Perspektive als auch im Kontext der internationalen Politik. Es dient als Grundlage für die Analyse der Lage der Minderheiten in der Türkei und legt die theoretischen und begrifflichen Grundlagen der Arbeit fest.
3. Türkisches Minderheitenverständnis seit der Gründung der Republik Türkei: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des türkischen Minderheitenverständnisses vom Osmanischen Reich bis zur heutigen Republik. Es beschreibt das Millet-System des Osmanischen Reiches und dessen Einfluss auf das Verhältnis zwischen Staat und Minderheiten. Es untersucht die Rolle des Lausanner Vertrags, den türkischen Nationalismus und Laizismus und deren Auswirkungen auf die Behandlung von Minderheiten. Die Kapitel beleuchtet, wie diese Faktoren zu den gegenwärtigen Herausforderungen für die Minderheiten beitragen.
4. Religionsfreiheit der muslimischen Religionsgemeinschaften: Dieses Kapitel befasst sich mit der Religionsfreiheit in der Türkei, insbesondere im Hinblick auf muslimische Gemeinschaften. Es untersucht die Rolle des Präsidiums für Religionsangelegenheiten und den Einfluss muslimischer Ordensgemeinden, trotz ihres offiziellen Verbots, auf Politik und Gesellschaft. Der Militärputsch von 1980 und die TIS-Ideologie werden ebenfalls analysiert, um deren Auswirkungen auf die Stellung der Diyanet (Religionsbehörde) im türkischen Staatsapparat zu beleuchten.
5. Anerkannte/ nicht-anerkannte nicht-muslimischen Minderheiten in der Türkei: Dieses Kapitel untersucht die administrativen und gesellschaftlichen Probleme sowohl anerkannter als auch nicht-anerkannter nicht-muslimischer Minderheiten. Es analysiert systematische Diskriminierungspraktiken der türkischen Regierung und deren Folgen für die betroffenen Gruppen. Es beleuchtet die verschiedenen Bereiche, in denen die Minderheiten benachteiligt werden (Wahlrecht, Stiftungen, Schulen, Berufe etc.) und untersucht im Detail den Sonderfall der Katholischen Kirche.
Schlüsselwörter
Minderheiten, Türkei, christliche Minderheiten, jüdische Minderheiten, Religionsfreiheit, Laizismus, Nationalismus, Millet-System, Lausanner Vertrag, Diskriminierung, Assimilation, Bürger zweiter Klasse, administrativer Status, gesellschaftliche Integration, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Umgang der Türkei mit christlichen und jüdischen Minderheiten"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Umgang der Türkei mit christlichen und jüdischen Minderheiten und analysiert, ob diese als Bürger zweiter Klasse gelten. Sie beleuchtet die Auswirkungen der türkischen Staatsideologie auf diese Gruppen und die historischen und aktuellen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und historische Entwicklung des Minderheitenbegriffs in der Türkei, das türkische Minderheitenverständnis im Kontext von Nationalismus und Laizismus, die Religionsfreiheit und die Rolle des Präsidiums für Religionsangelegenheiten, administrative und gesellschaftliche Probleme nicht-muslimischer Minderheiten sowie die Frage der Diskriminierung und des Status als Bürger zweiter Klasse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Definition der Minderheiten, Türkisches Minderheitenverständnis seit der Gründung der Republik Türkei, Religionsfreiheit der muslimischen Religionsgemeinschaften, Anerkannte/ nicht-anerkannte nicht-muslimische Minderheiten in der Türkei und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen der türkischen Staatsideologie auf christliche und jüdische Minderheiten zu analysieren und zu ergründen, ob diese als Bürger zweiter Klasse gelten. Die Arbeit soll ein umfassendes Bild der Situation dieser Minderheiten zeichnen.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit erwähnt die Quellenkritik in der Einleitung (Kapitel 1.1.2), jedoch werden die spezifischen Quellen nicht im FAQ aufgeführt. Näheres dazu findet sich im Haupttext der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Minderheiten, Türkei, christliche Minderheiten, jüdische Minderheiten, Religionsfreiheit, Laizismus, Nationalismus, Millet-System, Lausanner Vertrag, Diskriminierung, Assimilation, Bürger zweiter Klasse, administrativer Status, gesellschaftliche Integration, Menschenrechte.
Wie wird der Begriff "Minderheit" in der Arbeit definiert?
Die Arbeit bietet eine umfassende Definition des Begriffs „Minderheit“, sowohl aus politisch-soziologischer Sicht als auch im Kontext der internationalen Politik (Kapitel 2).
Welche Rolle spielt das Millet-System im Kontext der Arbeit?
Das Millet-System des Osmanischen Reiches und dessen Einfluss auf das Verhältnis zwischen Staat und Minderheiten wird in Kapitel 3 analysiert, ebenso wie die Rolle des Lausanner Vertrags, des türkischen Nationalismus und Laizismus und deren Auswirkungen auf die Behandlung von Minderheiten.
Welche Rolle spielt das Präsidium für Religionsangelegenheiten?
Die Rolle des Präsidiums für Religionsangelegenheiten und der Einfluss muslimischer Ordensgemeinden wird in Kapitel 4 untersucht, ebenso wie die Auswirkungen des Militärputsches von 1980 und der TIS-Ideologie auf die Stellung der Diyanet.
Welche administrativen und gesellschaftlichen Probleme werden behandelt?
Kapitel 5 analysiert die administrativen und gesellschaftlichen Probleme anerkannter und nicht-anerkannter nicht-muslimischer Minderheiten, einschließlich systematischer Diskriminierung in Bereichen wie Wahlrecht, Stiftungen, Schulen und Berufe. Der Sonderfall der Katholischen Kirche wird ebenfalls untersucht.
- Citar trabajo
- Tezer Güc (Autor), 2012, Christliche und jüdische Minderheiten in der Türkei - Bürger zweiter Klasse?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204114