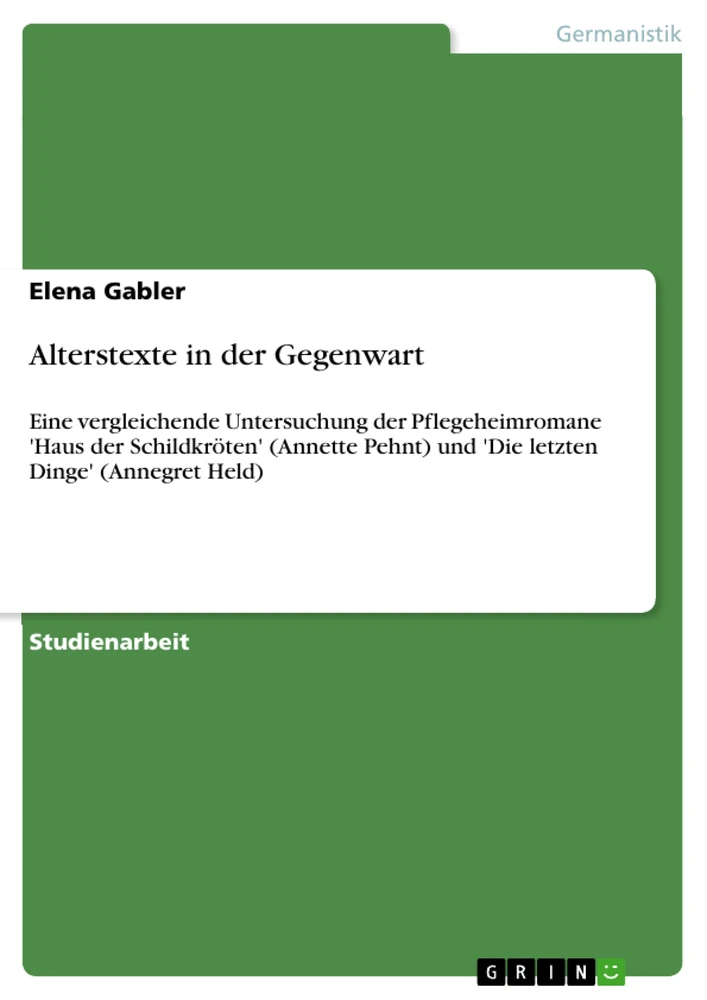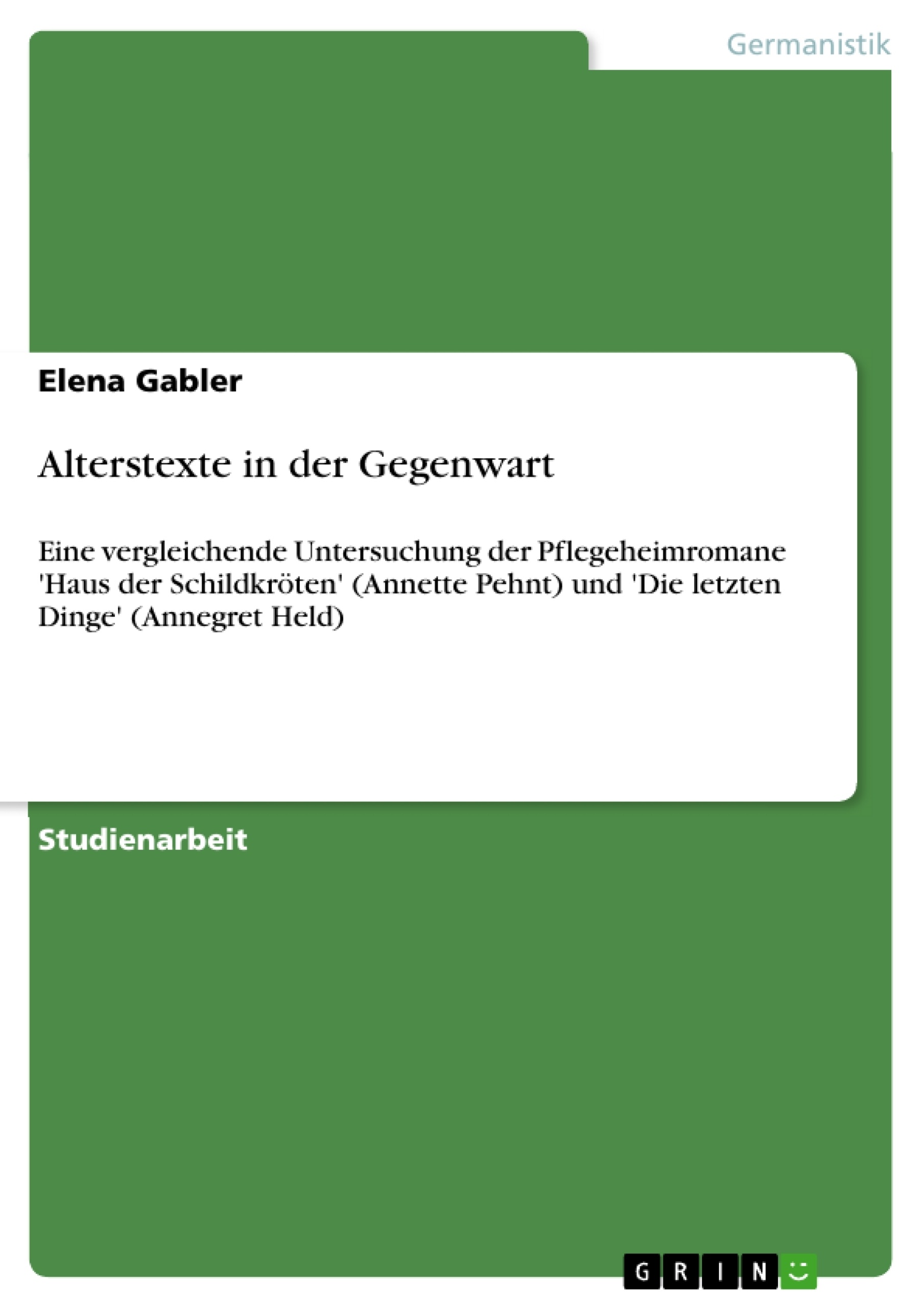Das literarische Interesse an der Thematik schlägt sich in erzählerischen Werken nieder, welche die Institution Altenheim vorrangig als Schauplatz der Handlung und somit auch als Gegenstand der Betrachtung in den Mittelpunkt rücken. Da es sich bei den Figuren der Heimbewohner meist um Menschen handelt, welche durch Krankheit und Bedürftigkeit charakterisiert sind, fokussieren jene Pflegeheimromane - um auf das Begriffsinventar Miriam Seidlers zurückzugreifen3 - die negativ besetze Seite des Alter(n)s. An Annette Pehnts Haus der Schildkröten und Die letzten Dinge von Annegret Held soll im Folgenden untersucht werden, wie das Lebensmilieu des Altenheims dargestellt wird und was die Romane im Einzelnen hervorheben und aufzeigen. Nach einer überblick-haften Gegenüberstellung, welche die groben Unterschiede und Schwerpunkte der Romane klar-legen soll, werden die Texte in Hinblick auf ihre formalen Darstellungsformen untersucht. Die narratologische wie sprachliche Gestaltung verleiht den zu behandelnden Pflegeheimromanen eine je eigene Wirkung und ein eigenes Deutungsspektrum. So sollen die Romane anschließend auch auf ihre mögliche Aussagekraft hin untersucht werden. Letztlich stellt sich die Frage, ob und inwiefern ein belletristisches Werk, das ein gesellschaftliches Phänomen wie die Pflegebedürftigkeit alter Menschen behandelt, Wirkung erzielen kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. „Alter“ in Gesellschaft und Literatur.
- B. Alterstexte in der Gegenwart: eine vergleichende Untersuchung der Pflegeheimromane Haus der Schildkröten (Annette Pehnt) und Die letzten Dinge (Annegret Held).
- I. Zum Überblick: Gegenüberstellung und Abgrenzung der beiden Romane.
- II. Verhandlung des Schauplatzes „Altersheim“
- 1. Literarische Darstellung der Lebenswelten als „drinnen“ und „draußen“ bei Annette Pehnt
- 2. Entwurf von „Haus Abendrot“ in Die letzten Dinge
- a, Räumliche Konstruktion und ihre literarischen Funktionen
- b, Darstellung des Pflegeheims aus rationaler Sicht
- III. Untersuchung der formalen Darstellung und ihrer Wirkung
- 1. Erzählerische Mittel und was sie im Einzelnen aufzeigen.
- 2. Die Wirkung der sprachlich-stilistischen Gestaltung.
- 3. Rezeptionsästhetische Wirkung und mögliche Aussagekraft.
- a, „Die letzten Dinge“ als Unterhaltungsliteratur oder Satire?
- b, „Haus Ulmen“ als Verhängnis des Lebens
- C. Überlegungen zur möglichen Wirksamkeit des Pflegeheimromans.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung von Pflegeheimen in der Gegenwartsliteratur. Anhand einer vergleichenden Analyse von Annette Pehnts „Haus der Schildkröten“ und Annegret Helds „Die letzten Dinge“ untersucht die Arbeit, wie das Lebensmilieu des Altenheims in literarischer Form vermittelt wird und welche Schwerpunkte die beiden Romane im Einzelnen setzen.
- Darstellung des Lebensmilieus des Altenheims in der Literatur.
- Untersuchung der literarischen Gestaltung des Schauplatzes „Altersheim“.
- Analyse der erzählerischen und sprachlichen Mittel in den beiden Romanen.
- Rezeptionsästhetische Betrachtung der Werke und ihrer möglichen Aussagekraft.
- Reflexion über die Wirksamkeit von Belletristik im Hinblick auf gesellschaftliche Phänomene.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die aktuelle Debatte um das Thema „Alter“ in Gesellschaft und Literatur beleuchtet. Dabei werden die ambivalente Wahrnehmung des Alters in der heutigen Gesellschaft sowie die wachsende Bedeutung des Themas in der Literatur hervorgehoben. Das zweite Kapitel widmet sich einer vergleichenden Untersuchung der beiden Pflegeheimromane „Haus der Schildkröten“ und „Die letzten Dinge“. Es wird gezeigt, dass sich die Romane hinsichtlich ihrer erzählerischen Struktur, ihrer Schwerpunktsetzung und ihrer Darstellung des Lebensmilieus des Altenheims unterscheiden. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Analyse der formalen Gestaltung der beiden Romane. Die Untersuchung fokussiert auf die erzählerischen Mittel, die sprachliche Gestaltung und die Rezeptionsästhetik der Werke. Schließlich werden im letzten Kapitel Überlegungen angestellt zur möglichen Wirksamkeit des Pflegeheimromans und seiner Bedeutung für das gesellschaftliche Bewusstsein.
Schlüsselwörter
Pflegeheimroman, Altersliteratur, Lebensmilieu, „drinnen“ und „draußen“, erzählerische Mittel, sprachliche Gestaltung, Rezeptionsästhetik, gesellschaftliche Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Pflegeheimromane“?
Pflegeheimromane sind literarische Werke, die das Altenheim als zentralen Schauplatz nutzen und sich intensiv mit Themen wie Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und dem Leben in einer Institution auseinandersetzen.
Wie wird das Altenheim in Annette Pehnts „Haus der Schildkröten“ dargestellt?
Pehnt nutzt eine starke Trennung zwischen „drinnen“ und „draußen“. Das Heim wird oft als ein Ort der Isolation und des Verhängnisses dargestellt, was eine beklemmende Wirkung erzeugt.
Welchen Ansatz verfolgt Annegret Held in „Die letzten Dinge“?
Held wählt eine eher rationale, teils satirische Perspektive auf das Pflegeheim „Haus Abendrot“ und beleuchtet die Abläufe und die räumliche Konstruktion oft aus Sicht des Personals oder distanzierter Beobachter.
Können solche Romane gesellschaftliche Veränderungen bewirken?
Belletristik kann durch ihre emotionale Kraft ein Bewusstsein für gesellschaftliche Phänomene wie Pflegebedürftigkeit schaffen, die in rein sachlichen Debatten oft ausgeblendet werden.
Warum wird das Alter in der Literatur oft negativ besetzt?
Literatur fokussiert oft auf Konflikte und Grenzsituationen. Das Alter bietet durch den drohenden Verlust von Autonomie und Gesundheit ein dramatisches Potenzial für existenzielle Erzählungen.
- Quote paper
- Elena Gabler (Author), 2012, Alterstexte in der Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204313